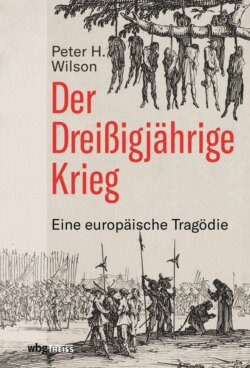Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Peter H. Wilson - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Prozess der Konfessionalisierung
ОглавлениеReligiöse Spannungen behinderten das Funktionieren der Reichsverfassung und trugen so zum Kriegsausbruch des Jahres 1618 bei. So direkt, wie es vielleicht scheinen mag, war der Zusammenhang jedoch nicht. Das 16. Jahrhundert war deutlich weniger blutig gewesen als weite Teile des Mittelalters, in denen nicht nur endlose Fehden gewütet hatten, sondern sogar Kaiser von ihren Vasallen abgesetzt worden waren. Um die Rolle der Religion dabei zu verstehen, müssen wir zuerst nachvollziehen, wie Debatten über Glaubensfragen mit Disputen über weltliche Herrschaftsansprüche verknüpft werden konnten – und dazu müssen wir den Prozess betrachten, in dem während der Nachreformationszeit die Ausformung unterschiedlicher konfessioneller Identitäten erfolgte. Natürlich bezogen sich alle christlichen Konfessionen auf gemeinsame Wurzeln, entwickelten jedoch bald getrennte Dynamiken: aufgrund von je eigenen Absichten und materiellen Interessen, aufgrund von Ängsten um sozialen Status und Prestige, aber auch aufgrund des psychologischen Bedürfnisses, sich als Mitglied einer Gruppe zu empfinden und dieses Zugehörigkeitsgefühl durch die Abgrenzung von Andersdenkenden zu definieren und festzuschreiben. Die theologischen Kontroversen im Anschluss an die Reformation zwangen die Gläubigen, Stellung zu beziehen, weshalb alle größeren konfessionellen Gruppen sehr schnell dazu übergingen, jeweils unterschiedliche Elemente ihres Glaubens als charakteristisch zu betonen. Der Katholizismus hob die Bedeutung der kirchlichen Organisation hervor und postulierte, dass die römische Kirche als einzige befähigt sei, das Wort Gottes für alle Christen auszulegen. Die Lutheraner unterstrichen die Bedeutung der christlichen Glaubenslehre und nahmen für sich in Anspruch, das Wort Gottes vor der Fehlinterpretation durch eine irregeleitete Kirche zu retten. Der Calvinismus wiederum stand für den Primat der Praxis: Luthers reformatio doctrinae müsse – damit Glaube und Verhalten endlich in Einklang stünden – durch eine reformatio vitae, eine Besserung des Lebens, ergänzt und vollendet werden.18
Die Katholiken Die Kampfansage Martin Luthers an die Adresse der kirchlichen Hierarchie stand ursprünglich im Zusammenhang mit verbreiteten Bemühungen um eine Erneuerung des Katholizismus, aber Luthers Bruch mit Rom zwang den Papst neben der theologischen auch zu einer politischen Reaktion. Die in den Jahren 1545–63 zu einem Konzil im oberitalienischen Trient einberufenen Kardinäle sollten den Riss schließen, der sich in der europäischen Christenheit aufgetan hatte; am Ende verwarfen sie die evangelischen Glaubenssätze dennoch als häretisch. Die abschließenden Dekrete des Tridentinums konzentrierten sich auf eine theoretische Definition des katholischen Glaubens und formulierten ein Programm zur Auslöschung der Häresie durch die praktische Erneuerung des katholischen Glaubenslebens. Ein Streitpunkt betraf die korrekte Auffassung der Eucharistie und damit die Frage nach dem richtigen Verständnis von Christi Einsetzungsworten über Brot und Wein beim Letzten Abendmahl. Der Grund dafür, dass diesem Punkt so große Bedeutung zugemessen wurde, lag letztlich in der zentralen Bedeutung der heiligen Messe als eines gemeinschaftlichen Aktes der Anbetung, der Priester und Gemeinde vereinte. Die tridentinischen Dekrete bestätigten den Primat der Kirche, indem sie darauf hinwiesen, dass es das liturgische Handeln des Priesters sei, durch das die Hostien geweiht und somit in den Leib Christi gewandelt würden, der hierauf inmitten der versammelten Gemeinde gegenwärtig sei. Eine Akzeptanz der in diesem Sinne verstandenen „tridentinischen Messe“ galt als Zeichen der Unterwerfung unter die Autorität des Papstes – und damit als Zeichen für eine Akzeptanz auch der anderen päpstlichen Lehrentscheidungen. Mit dem tridentinischen Ritus ging ein Wiederaufleben der eucharistischen Frömmigkeit des Mittelalters einher, etwa durch Fronleichnamsprozessionen der Gläubigen, die am Donnerstag nach Trinitatis, begleitet von liturgischen Bannern und Kultbildern, der Monstranz mit dem Sakrament durch die Straßen folgten, nachdem sie zuvor gemeinsam die Messe gefeiert hatten.
Das Konzil von Trient erließ eine Reihe von Dekreten, die Martin Luthers Kritik, der Klerus sei seiner Vermittlerrolle zwischen Gott und den Menschen nicht gewachsen, zum Schweigen bringen sollten. So wurde die Priesterausbildung erweitert, damit künftige Generationen von Klerikern die Lehren der Kirche besser verstehen und ihre Schäfchen nicht mehr in die Irre führen würden. Bischöfe sollten ihren Diözesen dienen, nicht sie ausbeuten. Zum Vorbild in dieser Hinsicht wurde der Kardinal Karl Borromäus (Carlo Borromeo). Dieser war nach 80 Jahren der erste Erzbischof von Mailand, der wieder in der Stadt residierte, regelmäßig die ihm anvertrauten Kirchen besuchte und die Angehörigen der diversen Orden in seinem Bistum nicht nur dazu aufforderte, sich im Sinne eines aktiven christlichen Lebens stärker in ihren Gemeinden einzubringen, sondern sie darin auch finanziell unterstützte. Der Kardinal erfand außerdem den modernen Beichtstuhl, was die Attraktivität des Beichtsakramentes deutlich erhöhte: Vorher ein Akt der Bloßstellung in aller Öffentlichkeit, wurde die Beichte nun immer mehr zu einer individuellen Seelsorgemaßnahme. Borromäus stand nicht nur an der Spitze des antihäretischen Gegenschlages in der Schweiz, sondern bald auch im Zentrum eines eigenen Kultes, der 1610 zu seiner Heiligsprechung führte. Überhaupt wurde eine intensivierte Heiligenverehrung zum Kennzeichen des nachtridentinischen Katholizismus, dem fromme Persönlichkeiten nicht mehr nur als Vorbilder, sondern als direkte Fürsprecher der Menschen bei Gott galten.
Die Verehrung von Lokalheiligen sorgte für eine weitere Verfestigung der konfessionellen Identität und unterstützte die katholische Antwort auf die reformatorische Schriftfixierung. Obgleich die Liturgie weiterhin in lateinischer Sprache gefeiert wurde, kamen in anderen Aspekten des Kultus die Volkssprachen zu ihrem Recht, so beim Singen unter musikalischer Begleitung und bei anderen Aktivitäten, die das Gemeinschaftsgefühl der Gemeinde stärken sollten. Das Wallfahrtswesen erfuhr eine Wiederbelebung, vor allem die Heilig-Blut-Wallfahrten nach Walldürn und Weingarten, deren Schreine die Reformation überstanden hatten. Indem sie das Patronat über diese Wallfahrten übernahmen, konnten die jeweiligen Landesherren – der Herzog von Bayern beziehungsweise der Mainzer Kurfürst – ihren Katholizismus unter Beweis stellen. Schon in den 1590er-Jahren überschritt die Anzahl der Teilnehmer an den beiden Wallfahrten die Marke von 100 000 Pilgern im Jahr und verdoppelte oder verdreifachte sich bis in die 1620er-Jahre noch einmal; während des Krieges blieben beide Orte – mit Ausnahme der dreijährigen schwedischen Besetzung – gut im Geschäft. Auch die Verehrung der Heiligen Familie trat stärker hervor als bisher. Der heilige Charakter von Jesu „Ziehvater“ Josef wurde betont, was mit seiner Darstellung als treuer Verteidiger und Beschützer aller christlichen Familien einherging. Die Marienverehrung erreichte ebenfalls neue Höhen, vor allem durch die Etablierung beziehungsweise wachsende Anziehungskraft von Pilgerstätten wie Altötting und Passau. Marienbruderschaften vergrößerten ihre Mitgliederbasis, indem sie neben Klerikern auch Laien aufnahmen, was die Verwurzelung des Katholizismus in den Gemeinden weiter vorantrieb. In Köln gehörten 1650 etwa 2000 von rund 45 000 Einwohnern der örtlichen Marienbruderschaft an.
Die tridentinischen Reformen rührten an das Innerste der römischen Kirche: Mit einer Reform der päpstlichen Kurie sowie der Ausweitung ihres diplomatischen Netzwerks reagierte der Papst nicht nur auf den Protestantismus, sondern auch auf Verschiebungen im europäischen Gleichgewicht der Kräfte.19 Der Sieg der Spanier über Frankreich brachte bis 1559 italienische Territorien zu beiden Seiten des Kirchenstaates unter spanische Kontrolle, was die Umklammerung der päpstlichen Territorien durch die Habsburger noch ein wenig enger werden ließ. Der Papst hatte indes nicht vergessen, dass es kaiserliche Truppen gewesen waren – und nicht etwa protestantische Horden –, die beim berüchtigten Sacco di Roma 1527 die Ewige Stadt verwüstet hatten. Auch erkannte er, dass die römische Kirche auf die habsburgische Herrschaft über Spanien und Österreich dringend angewiesen war – von den neuen habsburgischen Territorien in Übersee (Nord- wie Südamerika, West- und Ostindien) gar nicht zu reden. Sich selbst sah der Papst als padre commune, der seinen Einfluss nutzte, um innerhalb der Christenheit für Aussöhnung zu sorgen. Aber die politische Situation zwang ihn dazu, sich bei der Umsetzung seiner Pläne auf katholische Herrscher zu verlassen; und viele von diesen hatte der Papst im Verdacht, den eigenen dynastischen Vorteil im Zweifelsfall über ihre katholische Konfession zu stellen. Der Papst setzte auf Frankreich und die unabhängig gebliebenen Fürsten Italiens als Gegengewichte zur Vorherrschaft der Habsburger; schließlich sah er sich genötigt, die Initiative beim Vorantreiben katholischer Lokalinteressen an andere Herrscher abzugeben.
Die protestantische Propaganda stellte den Dreißigjährigen Krieg als einen päpstlichen Kreuzzug dar, die Jesuiten aber als die Sturmtruppe des Papstes. Der Jesuitenorden (offiziell als Societas Jesu bezeichnet) war 1540 auf Initiative des Ignatius von Loyola durch päpstliches Dekret gegründet worden.20 Die Jesuiten hatten den klaren Auftrag, den Protestantismus – den ihr Ordensgründer als „das Gift [einer] schlimmen Lehre“ bezeichnete – auszumerzen. Zuerst sollten sie die Ursache der „Infektion“ beseitigen, indem sie Protestanten – und unkooperative Katholiken – von einflussreichen Posten verdrängten, danach die „seelische Gesundheit“ wiederherstellen, indem sie die Vitalität der katholischen Lehre und Frömmigkeit förderten. Derartige Taktiken waren unverhohlen politisch; das unterschied die Jesuiten von anderen Orden wie etwa den Kapuzinern, die mit ihrer Arbeit die franziskanische Tradition der Armenpflege fortführten. Kardinal Borromäus entsandte die Kapuziner in die Bergdörfer der Alpen, wo sie von den 1580er-Jahren an die Rekatholisierung der Schweizer Bevölkerung sowie der habsburgischen Untertanen in Tirol betrieben. Die Jesuiten hingegen setzten bei ihren Bemühungen ganz an der Spitze der politischen Hierarchie an; sie glaubten nämlich, dass, wenn sie den Landesherrn und dessen Eliten erst einmal auf ihre Seite gezogen hätten, der Rest der Gesellschaft bald folgen würde. Auf Loyolas Anweisung wurde 1552 ein Jesuit Beichtvater des portugiesischen Königs, womit seitens der Gesellschaft Jesu eine regelrechte Jagd auf derartige Posten einsetzte. Die Protestanten sahen darin eine päpstliche Verschwörung und wiesen den jesuitischen Beichtvätern rasch die Rolle von hinterlistigbösen Beratern zu, die einen unangemessenen Einfluss auf ihre „Beichtkinder“ ausübten.
Selbst unter Katholiken stießen die Jesuiten nicht nur auf Wohlwollen. Die etablierten Orden verübelten es ihnen, dass sie sich überall „vordrängelten“, durch ihre politischen Beziehungen Kirchen, Schulen und andere Güter einfach an sich zogen. Viele beunruhigte auch der offenkundige Radikalismus der Jesuiten. Als 1594 ein geistig verwirrter ehemaliger Jesuit versuchte, den französischen König Heinrich IV. zu ermorden, und fünf Jahre später ein anderes Ordensmitglied in einem Buch den Tyrannenmord verteidigte, fiel es nicht mehr schwer zu glauben, dass die Jesuiten auch hinter anderen Intrigen wie der englischen Pulververschwörung (Gunpowder Plot) von 1605 stecken mochten. Allerdings mussten die Jesuiten ihren gegenreformatorischen Auftrag mit ihrem hierarchischen Weltbild in Einklang bringen und entwickelten eine ganz eigene Einstellung zu ihrer Rolle als Beichtväter der Mächtigen. Sie glaubten nämlich, der Teufel wolle die Fürsten dazu verführen, Häretikern gegenüber Zugeständnisse zu machen. War so etwas tatsächlich einmal vorgekommen, dann versicherten sie dem betreffenden Herrscher, dass Gott ihm gewiss vergeben werde – immer vorausgesetzt, dass diese Zugeständnisse politisch notwendig gewesen waren. Und dass sie selbstverständlich bei der nächsten Gelegenheit zurückgenommen wurden. Solche Argumente ermöglichten einen Pragmatismus, dessen Kompromissbereitschaft seine Militanz verschleiern konnte.
Das passte auch zu den vielfältigen Persönlichkeiten dieser Beichtväter, die immerhin eine sehr persönliche Beziehung zu ihrem jeweiligen Fürsten aufbauten. Der geschmeidige Pragmatiker Martin Becanus etwa diente ab 1620 als Vertrauter Kaiser Ferdinands II., wurde jedoch von dem Hardliner Wilhelm Lamormaini abgelöst, der bis zum Tod des Kaisers 1637 dessen Beichtvater blieb. Ferdinands gleichnamiger Sohn und Nachfolger entschied sich für den Jesuiten Johannes Gans, der dafür bekannt war, gern gut zu essen und einen weltlicheren Lebensstil zu pflegen. Eine solch lückenlose Kette von jesuitischen Beichtvätern gab es nirgendwo sonst in Europa, denn nirgendwo sonst hatte der Jesuitenorden so großen Einfluss wie in den durchlässigen politischen Strukturen des Heiligen Römischen Reiches.
Die Jesuiten breiteten sich rasch im Reich aus. Ihre Zahl stieg von 50 (von insgesamt 1000 Ordensmitgliedern) bei Loyolas Tod im Jahr 1556 auf 1600 (von 13 100 Jesuiten weltweit) im Jahr 1615 an. Die Hauptaufgabe des Ordens bestand jedoch überhaupt nicht darin, den Mächtigen Europas die Beichte abzunehmen, sondern in der Lehrtätigkeit an Schulen und Hochschulen. Darin – in der Rolle als Lehrer und Pädagogen der weltlichen und geistlichen Elite – lag der hauptsächliche Einfluss des Ordens auf die Gesellschaft. Bei Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges gab es im Rheinland 22 Jesuitenkollegien, für die Zeit bis 1630 sind weitere 20 in Süddeutschland und 23 in Österreich und Böhmen nachgewiesen. Die Schülerzahlen stiegen rapide an, in Trier etwa von 135 bei Gründung des Instituts im Jahr 1561 auf 1000 im Jahr 1577. Diese Schulen bildeten die Grundlage für eine Expansion des Ordens in den Hochschulbereich – genauer gesagt überredeten die Jesuiten einzelne Landesherren, bestimmten Einrichtungen den Status einer Universität zu verleihen, weil sie dadurch reichere und sozial bessergestellte Studenten anlocken konnten. Die Erfolge des Ordens sorgten für Aufsehen, und so wurden die Jesuiten bald eingeladen, wirtschaftlich angeschlagene Hochschulen zu übernehmen. Mitte des 16. Jahrhunderts wurden ihnen beispielsweise die Hohen Schulen von Ingolstadt und Dillingen anvertraut, beides humanistische Gründungen. Auch in Wien gelang es ihnen, durch geschicktes Agieren die dortige Universität unter ihre Kontrolle zu bringen. Diese bemerkenswerte Expansion verdankten die Jesuiten ihren Lehrmethoden, die nach heutigen Maßstäben nur logisch erscheinen, damals jedoch revolutionär waren. Alle Jesuiten besaßen selbst einen Hochschulabschluss und führten an allen ihren Kollegien einen gemeinsamen Lehrplan ein, der das bestehende Modell der humanistischen Gelehrtenschule mit einem vertieften, systematischen Unterricht in Theologie und Philosophie verband. Die jesuitischen Bildungseinrichtungen standen einem jeden offen, der die Aufnahmeprüfungen bestand; Schulgeld oder Studiengebühren waren nicht zu entrichten. Die Eleven wurden je nach ihren Fähigkeiten in Klassen eingeteilt, was dem Lernfortschritt zuträglich war, während die Tätigkeit von mehr als einem einzigen Lehrer pro Schule es zugleich ermöglichte, spezialisierten Fachunterricht und regelmäßige Stundenpläne anzubieten. Dieses Bildungsprogramm fand Zuspruch bei breiten Gesellschaftsschichten im ganzen deutschsprachigen Raum. Wer jedoch in der Kirche Karriere machen sollte, der wurde oft nach Rom geschickt, um seine Ausbildung an dem dortigen Collegium Germanicum fortzusetzen, das 1552 von den Jesuiten gegründet worden war und vom Heiligen Stuhl finanziert wurde. Obwohl die Zahl seiner Studenten während des Dreißigjährigen Krieges deutlich zurückging, hinterließ das Collegium in der Reichskirche deutliche Spuren: Über die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts hinweg hatte rund ein Siebtel aller Domherren des Heiligen Römischen Reiches dort studiert. Wie schon den Fall der jesuitischen Beichtväter, so muss man auch das Bildungsengagement der Jesuiten in seinem Kontext sehen: Es gab daneben durchaus andere katholische Universitäten. Zudem wurden in den 100 Jahren nach der Gründung der Universität Marburg 1527 auch in protestantischen Territorien insgesamt acht Universitäten eingerichtet. Die Studentenzahlen im gesamten Reich stiegen zwischen 1500 und 1618 von 2700 auf 8000 an – letzterer Wert sollte erst wieder im 19. Jahrhundert erreicht werden.21
Der jesuitische Einfluss wurde außerdem durch andere Traditionen innerhalb des deutschen Katholizismus verwässert. Zwar waren die weltlichen katholischen Fürsten sehr darauf bedacht, häretische Strömungen zu bekämpfen, da religiöses Abweichlertum gemeinhin als erster Schritt in Richtung Revolte galt; doch sorgte die Ausbreitung der Reformation dafür, dass der Katholizismus in der Hauptsache auf die geistlichen Territorien des Reiches zurückgedrängt wurde. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts waren, von den Gebieten der Habsburger einmal abgesehen, Bayern und Lothringen die einzigen weltlich regierten Reichsterritorien von nennenswerter Ausdehnung, die katholisch geblieben waren. Bayern und die Habsburger wurden denn auch die wichtigsten Förderer der Jesuiten im Heiligen Römischen Reich; viele geistliche Fürsten hingegen begegneten dem Orden mit Misstrauen. Wenn sie auch zahlreich waren, so waren die geistlichen Territorien doch eher klein, und ihre politischen Institutionen waren unterentwickelt. Die Regierungsgewalt lag zum größten Teil in der Hand eines Dom- oder Stiftskapitels, das den Fürstbischof oder -abt wählte. Die Jurisdiktion war nicht selten durch das Vorhandensein weiterer Stiftskirchen oder Klöster zersplittert. In Speyer zum Beispiel kontrollierten insgesamt fünf Stiftskirchen ein Viertel der Kirchsprengel, während gar die Hälfte des Erzbistums Trier auf Klöster und andere kirchliche Stiftungen entfiel, die sich der direkten Kontrolle des Kurfürstbischofs entzogen.22 Die tridentinischen Dekrete erweiterten die Machtbefugnisse der Bischöfe hinsichtlich ihrer Aufsicht über autonome Stiftungen und Gemeindepriester, die sich beide einer Einmischung in ihre Angelegenheiten oft widersetzten. Die meisten Angehörigen des mittleren und höheren Klerus im Reich verbanden mit ihrem Glauben vor allem einen bestimmten Lebenswandel und örtliche Interessen. Dieses katholische Establishment war den adligen oder patrizischen Eliten der jeweiligen Gegend eng verbunden und teilte deren diesseitige, vom Renaissancehumanismus geprägte Weltsicht. Nachgeborene Söhne oder unverheiratete Töchter auf einem Posten in der Reichskirche unterzubringen, das hatte beim Adel vielerorts Tradition, denn dort winkte neben dem gebührenden sozialen Prestige auch ein komfortables Einkommen. Als Institutionen des Reiches waren kirchliche Stiftungen und Domkapitel gleichsam in die Reichsverfassung eingewoben; daraus bezogen sie ihre Rechte und Privilegien. Sie übten eine weltliche Herrschaft aus, die lokal und partikular war, und die deshalb mit der ausgeprägten Romtreue der Jesuiten kollidierte. Die Wahl auf einen Abts- oder Bischofsstuhl setzte die Mitgliedschaft in dem entsprechenden Stifts- oder Domkapitel voraus, und die Kapitulare bevorzugten Kandidaten, deren Ansichten ihren eigenen glichen. Selbst der tridentinische Vorzeigebischof Kardinal Borromäus stand dem universalen Herrschaftsanspruch des Papsttums mit gemischten Gefühlen gegenüber – vertrat er doch die konziliare Tradition einer Kirche, die vom hohen Klerus gemeinschaftlich regiert wurde. Diese Tradition war durch die energische Durchsetzung der päpstlichen Autorität auf dem Konzil von Trient geradezu zerschlagen worden. Der politische Einfluss, der mit den Ämtern der Reichskirche einherging, ermunterte die führenden Vertreter der Geistlichkeit gleichwohl, auch weiterhin dem gewohnten Muster des Absentismus zu folgen, indem sie Bischofssitze und andere Pfründen sammelten, wo sie nur konnten, sich dann vor Ort aber nicht engagierten. Die tridentinischen Reformen wurden nur langsam und unvollständig umgesetzt – welche Bestimmungen Beachtung fanden, lag ganz im Belieben der jeweils Verantwortlichen. Die größten Auswirkungen des Tridentinums kamen daher erst im späteren 17. Jahrhundert zum Vorschein, lange nach dem Dreißigjährigen Krieg.
Auch in den Gemeinden traf die militante Reformbewegung auf starke Gegenwehr: Vor Ort, wo die Priester mitten unter ihren „Schäfchen“ lebten, wussten sie genau, dass ihre Stellung in der Gemeinschaft hauptsächlich davon abhing, ob die Gemeindemitglieder sie akzeptierten. Sie, die Gemeindepfarrer, hatten jenes menschliche Alltagsleben vor Augen, das radikalen Reformern, die sich um nichts scherten als um die konfessionelle Konformität, oftmals verborgen blieb. In der Praxis wurde die Glaubenslehre der Kirche großzügig ausgelegt, um sie an örtliche Gepflogenheiten sowie pragmatische und materielle Interessen anzupassen – und das trug letztlich sowohl zur Vielfalt als auch zur Stärke des Katholizismus im Heiligen Römischen Reich bei.
Die Lutheraner Gerade diese bunte Heterodoxie war es, deren Beseitigung sich die lutherische Reformation auf die Fahnen geschrieben hatte. Luther wollte die bestehende Kirche reformieren, nicht eine neue schaffen, und er stellte die päpstliche Autorität erst dann infrage, als der Papst seiner Interpretation der biblischen Lehre nicht zustimmen mochte. Es war die zentrale Bedeutung der Schriftlehre in der Theologie Luthers, die das Luthertum von der römischen Kirche unterschied und zum festen Boden für eine eigene, klar abgegrenzte Glaubensgemeinschaft werden sollte. Luther, der die Bibel als den Quell aller Wahrheit ansah, übersetzte diese nicht zuletzt deshalb ins Deutsche, um sie von der falschen Schriftauslegung der Päpste zu befreien. Luthers Anhänger betrachteten sich selbst als „evangelisch“, also als Anhänger des Evangeliums; erst mit der Zeit identifizierten sie sich auch als „Protestanten“ – eine Bezeichnung, die von der förmlichen Protestation zu Speyer herrührte, mit der lutherische Landesfürsten beim dortigen Reichstag 1529 gegen den Beschluss der katholischen Mehrheit, in Zukunft gegen die Anhänger der neuen Häresie vorzugehen, opponiert hatten. Der Streit zwang die Lutheraner, ihre Glaubenssätze in einer Reihe von Dokumenten schriftlich niederzulegen, angefangen mit der Confessio Augustana, dem Augsburgischen Bekenntnis, das dem Kaiser beim Reichstag zu Augsburg 1530 vorgelegt wurde.
Der lutherische Fokus auf das in der Bibel offenbarte Wort Gottes schmälerte die Vermittlerrolle des Priesters und veranlasste Luther, die Zahl der Sakramente von sieben auf zwei, nämlich Taufe und Abendmahl, zu reduzieren. Mit Blick auf Letzteres übernahm er weitgehend die katholische Lehre von der Realpräsenz, stärkte aber die Beteiligung der Gemeinde an der Messfeier. Andere Aspekte seiner Lehre gingen in ganz neue Richtungen, namentlich der Gedanke einer Rechtfertigung allein aus dem Glauben (sola fide). Dadurch wurden Rechtfertigung (Erlösung) und Heiligung (durch gute Werke) entkoppelt, denn schließlich sei, so Luther, die Aufnahme in den Himmel ein Gnadengeschenk Gottes und könne auch durch noch so gute Werke nicht „verdient“ werden. Das Individuum war nicht mehr in einem Kreislauf aus Sünde, Beichte, Reue und Buße gefangen – Gott allein entschied, wer errettet werden würde. Die Gläubigen sollten endlich aufhören, durch regelmäßiges Beichten, gute Werke und den Kauf von Ablässen auf einen „guten Tod“ hinzuarbeiten, und stattdessen lieber anfangen, ein gutes, christliches Leben zu führen. Diese Gedanken brachten Implikationen mit sich, die Luther so nicht im Sinn gehabt hatte. So stellte Luthers Überzeugung von einem „allgemeinen Priestertum der Gläubigen“ implizit sowohl die weltlich-politische als auch die geistlich-kirchliche Hierarchie infrage und schuf die Grundlage für einen populären Radikalismus, der schließlich im Bauernkrieg der Jahre 1524–26 kulminierte. Dieser – der ja ein Versuch gewesen war, zahllose lokale Missstände zu beheben – schloss auch die kraftvolle Vision eines Reiches ein, in dem keine Fürsten mehr zwischen dem „gemeinen Mann“ und seinem Kaiser standen. Obwohl der Aufstand mit beträchtlicher Brutalität niedergeschlagen wurde, und zwar von protestantischen wie von katholischen Fürsten, hinterließ er im Reich doch bleibenden Eindruck. Die Landesherren willigten ein, den Beschwerden ihrer einfachen Untertanen in Zukunft den Rechtsweg zu öffnen, was ihre Territorien nur noch fester in das Rechtssystem des Reiches einband und die hierarchische Reichsverfassung stärkte. Die Erfahrung des Bauernkrieges veränderte auch das Luthertum grundlegend, indem sie es in eine konservativere Richtung rücken ließ. Anstatt dem Individuum den Rücken zu stärken, bejahten die Theologen nun wieder den Anspruch der weltlichen Macht auf eine Kontrolle von Laien und Geistlichkeit gleichermaßen; die Geistlichen aber erklärten sie noch deutlicher als zuvor zu Hütern der reinen Glaubenslehre.23
Angesichts der zersplitterten politischen Landkarte des Heiligen Römischen Reiches folgte aus dieser Entwicklung beinahe zwangsläufig, dass in jedem Territorium, das den neuen Glauben annahm, eine eigene Form des lutherischen Kirchenregiments entstand. Der jeweilige Landesherr brach zunächst mit Rom und übernahm die Kirchenaufsicht, die zuvor der Bischof oder Erzbischof ausgeübt hatte, unter dessen geistlicher Jurisdiktion das fürstliche Territorium stand. In Anbetracht der strikten lutherischen Grenzziehung zwischen weltlicher und geistlicher Sphäre wurden die vormals bischöflichen Machtbefugnisse an zwei neu geschaffene Institutionen übertragen. Verantwortlich für die geistliche Führung war nun ein Konsistorium von Fachtheologen, die jeden einzelnen Gemeindepfarrer auf seine Konformität mit der herrschenden Lehre hin überprüften. Von jedem Pfarrer wurde erwartet, dass er 200 Predigten im Jahr hielt, darunter zwei an jedem Sonntag. Die Predigtentwürfe mussten dem Konsistorium zur Bewilligung vorgelegt werden, und an den Kanzeln installierte man, gut sichtbar, Sanduhren – nicht nur, damit der Prediger die ihm verbleibende Redezeit besser abschätzen konnte, sondern auch, damit die Gemeinde nicht um die ihr zustehende Predigtzeit betrogen wurde.
Das regelmäßige Predigthören stärkte das Gemeinschaftsgefühl der Gläubigen und schuf zugleich einen willkommenen Versammlungsanlass, bei dem die weltliche Obrigkeit ihre Dekrete verlesen lassen konnte. Auf diese Weise verzahnte sich mitunter der Konfessionalisierungsdrang des Luthertums mit den Anforderungen obrigkeitlicher Sozialdisziplinierung, wobei beide Autoritäten, geistliche wie weltliche, sich Gehorsam, Wirtschaftlichkeit und Sittlichkeit versprachen. Die neue Geistlichkeit wurde versorgt, indem man die Vermögenswerte der römischen Kirche, die sich auf dem Herrschaftsgebiet des betreffenden Landesherrn befanden, enteignete. Diesen Vorgang hat man als Säkularisierung bezeichnet, was aber in die Irre führt, denn er folgte nicht dem Muster etwa der englischen Reformation, in deren Verlauf Heinrich VIII. Klostergut einzog, um den Erlös der Staatskasse zuzuführen. Auch in den nun lutherischen Territorien des Heiligen Römischen Reiches wurde wohl ein wenig des so erlösten Geldes abgezweigt, etwa um die Musik bei Hofe zu bezahlen oder ganz allgemein als Beitrag zur fürstlichen Haushaltsführung; der größte Teil des enteigneten Besitzes wurde jedoch als lutherisches Kirchengut zusammengefasst und einem Kirchenrat anvertraut, der daraus die Finanzierung der Landeskirche bestritt.24 Frömmigkeitspraktiken, für die es in der lutherischen Lehre keine Grundlage mehr gab, wurden abgeschafft, so etwa das Lesen von Messen für die Verstorbenen in katholischen Klöstern, während man andere Dienste, die so oder ähnlich auch von katholischen Stiftungen geleistet wurden, wie etwa die Armenpflege oder den Unterhalt von Hospitälern und Schulen, erweiterte.
Der politische Führungsanspruch der Landesherren kam auch bei der Verteidigung des Luthertums innerhalb des Reiches zum Tragen. Kaiser Karl V. versuchte, den Streit der Theologen beizulegen, indem er diese zu Gesprächen zusammenkommen ließ. Als dies scheiterte, sah der Kaiser sich gezwungen, ein Verfahren nach dem Landfriedensrecht einzuleiten – schließlich beschuldigten die Katholiken unter den Reichsständen die Protestanten, Besitz ihrer Kirche gestohlen und unter ihren Untertanen aufrührerisches Gedankengut verbreitet zu haben. 1521 bestellte Karl V. Luther nach Worms, damit dieser sich vor dem Reichstag wegen der Anschuldigungen verantworte, die von katholischer Seite gegen ihn erhoben worden waren. Das abschließende Urteil des Kaisers beruhte auf dessen traditioneller Rolle als Schutzherr der Kirche und Verteidiger des Glaubens: Im Wormser Edikt wurde Luther der Häresie für schuldig befunden und unter die Reichsacht gestellt – die höchste weltliche Strafe, die dem Kaiser zu Gebote stand. Luther war nun vogelfrei; als verurteiltem Landfriedensbrecher drohten ihm Verfolgung und Strafe.
Die Ausbreitung des Luthertums unter den Reichsfürsten und -städten vertiefte den konfessionellen Graben noch weiter und zerschlug jene Einheit von Gesetz und Religion, auf welcher der kaiserliche Urteilsspruch gegen Luther ja gerade beruht hatte. Die Protestanten sprachen dem Papst ab, in Glaubensfragen überhaupt entscheiden zu dürfen, und behaupteten, ihre direkte Unterordnung unter Gott habe den Vorrang vor ihrer bisherigen Loyalität dem Kaiser gegenüber. Die politische Geschichte der Reformation ist im Wesentlichen eine Reihe von Versuchen seitens der Protestanten, die Wirkung des 1521 von Kaiser Karl V. erlassenen Edikts entweder aufzuschieben oder aufzuheben. Zu diesem Zweck setzten sie sämtliche ihnen verfügbaren Hebel der Reichsverfassung in Bewegung. Obwohl ihre Territorien größer waren und mehr Einwohner hatten, blieben die Protestanten in den Institutionen des Reichs unterrepräsentiert; die Oberhand hatten die kleineren, aber zahlreicheren katholischen Reichsstände. Drohende Rechtsverfolgung durch das Reichskammergericht brachte 1531 den sächsischen Kurfürsten, den hessischen Landgrafen sowie weitere lutherische Fürsten und Städte dazu, den Schmalkaldischen Bund zu schließen. Dies schuf den folgenschweren Präzedenzfall eines protestantischen Verteidigungsbündnisses außerhalb der Reichsverfassung. Probleme mit Frankreich und dem Osmanischen Reich beschäftigten den Kaiser bis in das Jahr 1546; dann erst kehrte er mit einer großen Streitmacht nach Deutschland zurück und schlug das Heer des sächsischen Kurfürsten in der Schlacht bei Mühlberg. Dieser Sieg erlaubte es dem Kaiser, seine Lösung für die Probleme des Reiches durchzusetzen.
Der Glaubensstreit zwischen Protestanten und Katholiken wurde 1548 durch das Augsburger Interim zum Schweigen gebracht, eine kaiserliche Verordnung, die unter anderem Kompromissformulierungen zentraler Glaubenssätze enthielt und die nur vorläufig gelten sollte, bis der Papst sein Einverständnis gegeben haben würde (deshalb „Interim“). Obwohl es in einigen Details auch Zugeständnisse an die Protestanten machte, vertrat das Interim doch in den meisten strittigen Punkten die katholische Position. Unterdessen wurde das Reich umstrukturiert, um den Habsburgern ein leichteres Regieren zu ermöglichen. Burgund und die habsburgischen Besitzungen in Italien wurden Spanien zugeordnet, wo Karls Sohn Philipp zum Thronfolger bestimmt worden war. Österreich, Böhmen und Ungarn wurden Karls Bruder Ferdinand anvertraut, während die übrigen, nichthabsburgischen Reichsstände in ein besonderes Bündnis mit dem Kaiser eintreten sollten. Der sächsische Kurfürstentitel wurde der älteren, ernestinischen Linie der Wettiner, die sich Karl widersetzt hatte, aberkannt und der jüngeren, albertinischen Linie zugesprochen. Deren Oberhaupt, der Herzog Moritz von Sachsen, hatte sich nämlich im Schmalkaldischen Krieg auf die Seite des Kaisers geschlagen.25
Ein solch machtvolles Durchgreifen des Kaisers konnte nur beunruhigen – selbst diejenigen, die davon profitierten. Durch ein Gemisch politischer und persönlicher Motive animiert – Karl V. hatte sich geweigert, Moritz’ Schwiegervater, den hessischen Landgrafen, freizugeben –, schloss der neue Kurfürst von Sachsen sich einem Komplott an, das die Regelung von 1548 zumindest in Teilen rückgängig machen sollte. Diese Fürstenverschwörung wurde zum Fürstenaufstand. Im Februar 1552 erkauften sich die Verschwörer die Unterstützung Frankreichs, indem sie eine französische Besetzung der Bistümer Metz, Toul und Verdun am westlichen Rand des Heiligen Römischen Reiches zuließen. Der Kaiser, dessen Unterstützung im Reich rapide abnahm, zog sich nach Innsbruck zurück und überließ es seinem Bruder Ferdinand, mit den Aufständischen zu verhandeln. Im Passauer Vertrag gewährte Ferdinand schließlich im Sommer 1552, was Moritz von Sachsen gefordert hatte: die Bestätigung seiner Kurwürde, Freilassung seines Schwiegervaters Philipp von Hessen, Aussetzung des Augsburger Interims sowie die Einberufung eines weiteren Reichstags, auf dem eine endgültige Lösung der Konfessionsfrage ausgehandelt werden sollte. Der zunehmend desillusionierte Kaiser übertrug die Initiative hierfür wiederum seinem Bruder, dem gemäßigteren, pragmatischeren Ferdinand. Und tatsächlich: Beim Reichstag zu Augsburg gelang es diesem 1555, den Augsburger Religionsfrieden zu schließen. Im Jahr darauf übertrug Karl V. die Regierungsgeschäfte des Reiches endgültig auf Ferdinand, der ihm als Kaiser nachfolgen sollte, dankte ab und zog sich nach Spanien zurück. Mit seinem Tod zwei Jahre später zerfiel das Haus Habsburg in eine österreichische und eine spanische Linie. Nur wenige Monate zuvor hatten die Kurfürsten Ferdinand I. als ihren neuen Kaiser anerkannt.
Für das Luthertum im deutschen Raum bedeuteten diese Entwicklungen eine tiefe Krise. Das umstrittene Handeln etwa eines Moritz von Sachsen stellte den Führungsanspruch des Adels innerhalb der lutherischen Bewegung infrage. Der bewaffnete Aufstand gegen den Kaiser brachte religiöse und politische Loyalitäten in Konflikt. Der Verlust gleich dreier Territorien an Frankreich wurde vom Kaiser nie anerkannt und zeigte allen, was passieren konnte, wenn man zur Verteidigung der Religionsfreiheit auf Hilfe von außen spekulierte. Noch wesentlicher war jedoch: Das Unvermögen, sich auf einen politischen Kurs zu einigen, befeuerte letztlich nur den Streit über Glaubensfragen. Der Tod Luthers fiel 1546 genau in diese Krisenzeit. Sollten seine Anhänger in zentralen Punkten ihres Glaubens Kompromisse eingehen? Oder sollten sie sich dem Kaiser widersetzen und das Reich damit in einen Bürgerkrieg stürzen? So oder so: eine krasse Wahl. Die Pragmatiker schlossen sich Philipp Melanchthon an. Melanchthon verkörperte eine Strömung innerhalb des Luthertums, die vom Humanismus eines Erasmus von Rotterdam geprägt war und sich bereit zeigte, gewisse Details der traditionellen Liturgie wieder einzuführen – wenn dafür im Gegenzug die Lutheraner auf der Reichsebene anerkannt würden. Die Gegner dieser „Philippisten“ nannten sich selbst „Gnesiolutheraner“, vom griechischen gnēsios, „echt“. Sie bestanden auf dem ursprünglichen Augsburgischen Bekenntnis von 1530 und lehnten die revidierte Confessio Augustana variata, die Melanchthon zehn Jahre später mit Luthers stillem Einverständnis ausgearbeitet hatte, strikt ab. Den Gnesiolutheranern schien das Augsburger Interim nur der erste Schritt zu ihrer Auslöschung; überhaupt neigten sie der apokalyptischen Vorstellung zu, der Endkampf zwischen den wahren Christen und dem Antichrist stehe kurz bevor. Als Fanal erschien ihnen der Fall Magdeburgs, das sich dem Interim widersetzt hatte und im November 1552 von kaiserlichen Truppen gestürmt worden war.
Im Zuge der Konfrontation zersplitterten die Konfliktparteien auch in sich. Die Gnesiolutheraner säuberten ihre Reihen von den extremeren Vertretern eines „echten Luthertums“, die allgemein als „Flacianer“ bekannt waren – nach dem Theologen Matthias Flacius, der wegen seiner kroatischen Herkunft auch „Illyricus“ genannt wurde. Diesen hatten solche ominösen Vorzeichen wie etwa die Geburt fehlgebildeter Kinder davon überzeugt, dass die Menschheit physisch degeneriere und das Weltende unmittelbar bevorstehe. Orthodoxeren Zulauf bekamen die Gnesiolutheraner aus den Reihen der Jungen, die seit der Reformation herangewachsen waren und nun in den neuen, lutherischen Landeskirchen Karriere machten. Die Hoffnung der Philippisten auf einen Ausgleich mit den Katholiken wiesen sie von sich; stattdessen, meinten sie, solle man die Katholiken lieber zum Luthertum bekehren. Aus Unsicherheit kehrten manche Lutheraner entweder in den Schoß der römischen Kirche zurück oder aber wandten sich radikaleren reformatorischen Strömungen zu. Als die führende Macht unter den evangelischen Fürsten des Reiches bemühte sich Kursachsen ab 1573 um Vermittlung zwischen den konkurrierenden Strömungen. Die kursächsischen Hofprediger stellten zwischen 1577 und 1580 das „Konkordienbuch“ zusammen, einen Kanon der wichtigsten lutherischen Bekenntnisschriften, der die gnesiolutherische Sicht der Glaubensdinge bestätigte und die Ansichten der Flacianer – wie auch den größten Teil des Philippismus – verwarf. Der sächsische Kurfürst machte es sich zur Aufgabe, die anderen protestantischen Reichsstände zur Unterzeichnung des Konkordienbuches zu bewegen, was ihm bis 1583 auch bei 20 Reichsfürsten, 30 anderen Herren und 40 Reichsstädten gelang.26
Die Calvinisten Nicht alle Protestanten waren mit dieser Entwicklung zufrieden. Manche sahen in dem zentralen Bekenntnisbuch der – wie es ihnen schien – aufgezwungenen Orthodoxie keinen liber concordiae, sondern vielmehr einen liber discordiae, ein „Buch der Zwietracht“. Damit meinten sie, dass das wahre Potenzial der Reformation, den christlichen Glauben von Grund auf neu zu gestalten, mit dem Konkordienbuch verschenkt worden sei. Die so dachten und eine „zweite Reformation“ einforderten, eine „Reformation der Reformation“, schlossen sich bald der Lehre des französischen Theologen Johannes Calvin an, dessen Ideen sich nach dem Augsburger Religionsfrieden auch im deutschen Raum verbreiteten. Die Konversion des pfälzischen Kurfürsten zum Calvinismus 1560 gab der neuen Bewegung gehörigen Auftrieb und sorgte außerdem dafür, dass der Calvinismus im Heiligen Römischen Reich vom Adel angeführt wurde – anders als im restlichen Europa, wo er meist die „Konfession des einfachen Mannes“ war. Bis 1618 waren etwa 20 Grafen und kleinere Fürsten dem Beispiel des Kurfürsten gefolgt und hatten den neuen Glauben öffentlich bekannt, doch besaßen unter diesen nur der Landgraf von Hessen (1603) und der brandenburgische Kurfürst (1613) nennenswertes politisches Gewicht.
Weil die Bezeichnung „Calvinisten“ zu sehr nach einer illegalen Sekte klang – und zudem von ihren lutherischen Kontrahenten geprägt worden war –, nannten sie sich selbst „Reformierte“. Ihr Ziel war es, Luthers Reformation zu vollenden, indem sie auch noch die letzten Überreste des „papistischen Aberglaubens“ beseitigen wollten – in der Liturgie wie in der Dogmatik. Hochaltäre und liturgische Gewänder wurden aus den Kirchen verbannt, Gemälde zerrissen und Skulpturen zerschlagen: Das sollte die Ohnmacht dieser Kultobjekte beweisen. Die reformierten Geistlichen trugen den schlichten Talar der Universitätsgelehrten; sie wollten als Spezialisten wahrgenommen werden, die für Predigt und Lehre bestens ausgebildet waren. Selbst altehrwürdige Glaubenstraditionen wie etwa der Exorzismus bei der Säuglingstaufe oder die Annahme der Realpräsenz Christi im Abendmahl wurden nun abgeschafft beziehungsweise verworfen – die Vorstellung, Leib und Blut Christi könnten durch die Verdauung der Hostie und des Messweins in den Gedärmen der Gläubigen zu Kot und Urin werden, erfüllte die Calvinisten mit Abscheu. Vielmehr wurde das Abendmahl zu einer Gedächtnisfeier, bei der die Gemeindemitglieder um einen Tisch saßen, um gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen; in Ostfriesland trank man dabei sogar Bier statt Wein.
Allerdings griff auch Calvin – wie zuvor schon Luther – einzelne katholische Ideen auf und entwickelte sie in eine neue Richtung weiter. Die politisch folgenreichste unter diesen Weiterentwicklungen war die ausgeprägte Prädestinationslehre, die dem Calvinismus sein dynamisches Selbstbewusstsein verlieh, in den Köpfen und Herzen mancher Anhänger Calvins zugleich jedoch nagende Zweifel säte. Die frühe Kirche hatte die Ansicht verurteilt, Christen könnten allein durch eigene Verdienste und die Befolgung der christlichen Lehren zum ewigen Heil gelangen. Der heilige Augustinus beispielsweise hatte erklärt, Gott allein entscheide darüber, wer erlöst werde – und da diese Entscheidung bereits vor der Geburt falle, seien manche Menschen eben vorherbestimmt („prädestiniert“), als Gottes „Erwählte“ gerettet zu werden. Diese katholische Lesart der Prädestinationslehre lehnte Calvin strikt ab, schien sie doch zu implizieren, dass Gottes Macht zur Rettung der letztlich Verworfenen schlicht nicht ausreiche. Stattdessen entwickelte Calvin seine eigene Lehre von der „doppelten Prädestination“, der zufolge Gott sowohl die Erwählten als auch die Verworfenen vorherbestimme. Spekulationen der Gläubigen über ihren eigenen Erlösungsstatus missbilligte Calvin: Sie müssten nur auf Gott vertrauen, dann werde ihr Glaube sie von der Sünde wegführen, hin zu einem Leben nach seinen Geboten. Und doch blieb da dieser nagende Zweifel, der die Selbstgewissheit vieler Calvinisten zermürbte: Was, wenn ein persönlicher Schicksalsschlag in Wahrheit ein Beleg dafür war, dass sie nicht zu Gottes Erwählten gehörten?
Ein neues Lebensmodell sollte diese Vorstellungen begleiten. Calvins Neuorganisation der Genfer Kirche schuf ein Vorbild, das seine Anhänger in ganz Europa nachahmten, wenngleich mit wechselnder Gründlichkeit. Der (hoch)adlige Charakter der „zweiten Reformation“ im Heiligen Römischen Reich brachte mit sich, dass die deutschen Calvinisten in der Regel bereits über protestantisch-landeskirchliche Strukturen verfügten, denn der neue Glaube fand seine Konvertiten vor allem unter Lutheranern, nicht unter Katholiken. Da die lutherischen Landeskirchen noch nicht lange bestanden, vertrauten die gerade konvertierten Neu-Calvinisten ihnen einfach neue Aufgaben an. Ein System der gegenseitigen Kontrolle wurde errichtet, indem man Gemeindemitglieder wie Geistliche ermunterte, über die dogmatische Konformität und die Tugendhaftigkeit der jeweils anderen Seite Bericht zu erstatten. Dieses sozialdisziplinierende Element des Calvinismus gefiel den Fürsten und Stadtoberen des späten 16. Jahrhunderts, die es mit einem kaum lösbar erscheinenden Problemkomplex von Inflation, Übervölkerung, Unterbeschäftigung und Armut zu tun hatten. Sicher: Lutheraner und Katholiken strebten ebenfalls Konformität und moralische Erneuerung an; aber die einmalige Kombination des Disziplinierungsdrangs mit anderen Bestandteilen der calvinistischen Theologie sorgte dafür, dass deren Anhänger sich als die einzig wahren Erben der frühen Christen fühlten.
Dass der Calvinismus international agierte, seine Anhänger über ganz Europa verstreut waren und sich nirgendwo in der Mehrheit befanden, leistete deren Fundamentalismus weiteren Vorschub. Die deutschen Lutheraner hatten sich auf eine national-humanistische Tradition berufen können, der zufolge Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit echte „teutsche“ Tugenden darstellten, während die Menschen im Ausland (vor allem südlich der Alpenlinie) durch ihre „welsche“ Verschlagenheit gekennzeichnet seien. Dänen und Schweden teilten diese traditionelle Ansicht weitgehend und konnten so, ganz wie ihre deutschen Glaubensbrüder, ihre neuen lutherischen Kirchen mit einer „nationalen Auflehnung“ gegen Rom in Verbindung bringen. Im Gegensatz dazu breitete sich der Calvinismus in einzelnen Städten und Adelshäusern aus, wodurch ihm die Ausbildung eines definitiven Zentrums versagt blieb. Jede neue Calvinistengemeinde verließ sich, was Rat und Hilfe betraf, auf andere, bereits etablierte. Als naheliegende Identifikationsfigur für die Calvinisten des deutschen Raums bot sich der pfälzische Kurfürst an – immerhin einer der einflussreichsten Fürsten des Reiches –, der den Einfluss Genfs ab den 1580er-Jahren merklich zurückdrängte. Zwischen 1560 und 1610 studierten mehr als 200 ungarische und 500 französische Studenten an der Heidelberger Universität, was das Ansehen der Kurpfalz bei den Calvinisten im Ausland noch erhöhte. Zur Ansiedlung von hugenottischen und anderen calvinistischen Glaubensflüchtlingen aus Frankreich und den Niederlanden gründete der Kurfürst zudem die Stadt Frankenthal, nachdem in den Heimatländern der Geflohenen 1562 beziehungsweise 1566 Religionskriege ausgebrochen waren. Da die Calvinisten dazu neigten, die Geschehnisse ihrer Gegenwart anhand biblischer Vorbilder zu deuten, identifizierten sie sich selbst mit dem Volk Israel. Glaubensflüchtlinge und Studenten verband die Erfahrung eines harten, unsteten Lebens auf den Landstraßen Europas sowie schließlich der Ankunft in einer neuen Gemeinschaft und Heimat. Die auf solcher Grundlage geknüpften Beziehungen überdauerten, auch wenn einzelne Personen nach Hause zurückkehrten oder weiterzogen. Die calvinistischen Gläubigen betrachteten ihre je eigenen, lokalen Beschwernisse als Teil eines allgemeinen Kampfs zwischen Gut und Böse. Das galt besonders, nachdem eine spanische Einmischung in die Bürgerkriege Frankreichs und der Niederlande den Eindruck verstärkt hatte, den international verstreuten „Erwählten“ stehe eine ebenso internationale katholische Verschwörung gegenüber, die jene auf Schritt und Tritt zu vernichten suche.
Die Grenzen der Konfessionalisierung Die Herausbildung rivalisierender Konfessionen im westlichen Christentum des 16. Jahrhunderts lässt vermuten, dass die europäische Gesellschaft jener Zeit in religiösen Fragen immer tiefer gespalten war. Zahlreiche Facetten des täglichen Lebens wurden nun konfessionalisiert, was unsichtbare Mauern zwischen oder sogar innerhalb von Gemeinschaften errichtete. Bald konnte man die Konfession eines Menschen fast schon an seinem Namen ablesen: „Maria“ und „Josef“ wurden unter Katholiken immer beliebter, während die Calvinisten diese und andere Namen als Ausdruck von Heiligenverehrung ablehnten. Sie bevorzugten Namen aus dem Alten Testament: „Abraham“, „Daniel“, „Zacharias“, „Rachel“, „Sarah“ und andere. Martin Luthers Bibelübersetzung trug zur Verbreitung einer auf dem sächsisch-meißnischen Kanzleideutsch basierenden Schriftsprache in ganz Mittel- und Norddeutschland bei. Im oberdeutschen Raum bewirkten die Bemühungen der Jesuiten um eine standardisierte hochdeutsche Schriftsprache Vergleichbares, nur eben auf katholischer Seite. Wenn nun ein Landesherr – und damit sein ganzes Territorium – die Konfession wechselte, dann wechselte auch die Schriftsprache. Man hat Entsprechendes sogar bei einzelnen Konvertiten nachgewiesen, etwa bei dem bereits erwähnten Schriftsteller Grimmelshausen, der, lutherisch erzogen, während des Dreißigjährigen Krieges zum katholischen Glauben übertrat. Andere Kunstformen waren zumindest teilweise ebenfalls konfessionalisiert. Das Theater zum Beispiel lehnten die Calvinisten strikt ab, während die Lutheraner es in ihren Schulen und die Jesuiten auf ihren Kollegien einsetzten. Katholische Predigten kreisten um die Muttergottes und die Heiligen, während Lutheraner und Calvinisten vorzugsweise moraltheologische Fragen erörterten.27
Nirgends waren die Unterschiede zwischen den Konfessionen jedoch augenfälliger als auf dem Gebiet von Zeitmessung und Kalenderrechnung. Papst Gregor XIII. ordnete 1582 gleich mehrere Kalenderreformen an. So folgte auf den 4. Oktober dieses Jahres kurzerhand der 15. Oktober – ganze zehn Tage „fielen aus“, um aufgelaufene Unregelmäßigkeiten des traditionellen julianischen Kalenders zu beheben. Außerdem sollte, um den Kalender zu vereinheitlichen, der 1. Januar Neujahrstag werden; zuvor hatte es lokal unterschiedliche Regelungen für den Jahresanfang gegeben, der teils auf Weihnachten oder Ostern gefallen war, teils aber auch auf den 25. März (Mariä Verkündigung) oder andere Termine. Bis 1584 übernahmen die Katholiken in den deutschen und allen habsburgischen Territorien des Reiches den neuen, „gregorianischen“ Kalender. Im protestantischen Europa sprachen sich zwar Gelehrte wie der Mathematiker und Astronom Johannes Kepler für die Reform aus; doch die lutherische und reformierte Geistlichkeit lehnte alles, was aus Rom kam, ab – mancher einfältigere Protestant glaubte gar, die „Papisten“ wollten ihm zehn Tage seines Lebens stehlen. Die Diskrepanz zwischen den beiden Kalendern wurde vor allem im Heiligen Römischen Reich deutlich, wo Lutheraner und Katholiken seit dem Augsburger Religionsfrieden auch offiziell zusammenlebten. Neun Zehntel der Einwohner Augsburgs waren Lutheraner, aber der Religionsfrieden hatte die Stadt – zumindest der Form nach – zu einer konfessionell paritätischen gemacht: Katholiken und Protestanten teilten sich Posten und Ämter. Nach schwierigen Verhandlungen führte der Augsburger Magistrat schließlich 1586 den gregorianischen Kalender ein, aber die Protestanten der Stadt hielten weiterhin „ihren“ Sonntag und besuchten Gottesdienste in Kirchen jenseits der Stadtgrenze.
Vieles deutet jedoch darauf hin, dass der Konfessionalisierungsprozess der Gesellschaft damals noch nicht so weit fortgeschritten war, wie es etwa im frühen 18. Jahrhundert der Fall war. In Augsburg beispielsweise waren gemischtkonfessionelle Ehen und soziale Kontakte zwischen Katholiken und Protestanten nichts Ungewöhnliches – zumindest vor der schwedischen Besatzungszeit in den 1630er-Jahren. Protestanten und Katholiken zechten in denselben Wirtshäusern, ohne dass deshalb gleich interkonfessionelle Massenschlägereien aktenkundig geworden wären. In den Gesellenherbergen des Handwerks erfolgte die Trennung der Konfessionen erst nach dem Westfälischen Frieden, als die Stadtoberen das paritätische Prinzip juristisch auf die Spitze trieben. Belege von anderen Orten legen nahe, dass die pragmatische Haltung der Augsburger Bürger keine Ausnahme war.28 Manche Menschen bekannten nach außen hin die eine Konfession, während sie hinter verschlossenen Türen eine andere praktizierten. Wieder andere suchten sich aus unterschiedlichen Quellen die Glaubenssätze und -praktiken zusammen, die ihnen am sinnvollsten und für ihren Alltag tauglichsten erschienen – ganz egal, ob die entstehende Mischung sich mit irgendeiner Orthodoxie deckte. Wer Handel trieb, stellte nicht selten den Profit über die Religion: Wenn ein Andersgläubiger etwas kaufen wollte, sollte man ihn wegschicken? Und obwohl es beinahe unmöglich war, der allgegenwärtigen Zensur zu entgehen, bot der politische Flickenteppich des Alten Reiches doch ausreichende Schlupflöcher, um alle Arten von Meinungen unters Volk zu bringen beziehungsweise kennenzulernen.
Vielleicht am wichtigsten war jedoch der Umstand, dass diese Gesellschaft, deren Denken und Handeln unzählige Fundamentalisten der unterschiedlichsten Bekenntnisse ihren Stempel aufdrücken wollten, nicht erst mit der Reformation ins Dasein getreten war, sondern über ein reiches vorreformatorisches Erbe verfügte. Das humanistische Bildungsideal, das sich im 15. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet hatte, prägte noch immer Schulen und Universitäten, gelehrte und literarische Gesellschaften, ganz unabhängig von der Konfession. Die Unterrichtsinhalte mögen sich unterschieden haben, aber die allseits vergleichbare Form des Unterrichts sorgte doch für eine gewisse gemeinsame Basis. Die Reichen und Mächtigen jedenfalls hielten weiterhin an der Tradition fest, im Zuge ihrer Ausbildung verschiedene Bildungsinstitutionen zu besuchen; auch hier spielte die Konfession oft keine Rolle. Die Bewunderung des klassischen Formenkanons, die beiden Seiten gemein war, trug dazu bei, den Gedankenaustausch zwischen Katholiken und Protestanten über das Niveau konfessioneller Streitigkeiten zu erheben; noch während des Dreißigjährigen Krieges ernannte der Kaiser protestantische Dichter zu poetae laureati des Reiches.29 Die humanistische Tradition hielt überdies das Beispiel eines Erasmus von Rotterdam bereit, der eine privatere, von klerikal-dogmatischer Aufsicht freie Glaubensauffassung vertreten hatte. Sowohl Kaiser Ferdinand I. als auch sein Nachfolger Maximilian II. förderten humanistische Gelehrte, die mit ihrer Suche nach überkonfessionellen Gemeinsamkeiten auf eine Wiedervereinigung der gespaltenen Christenheit hinarbeiteten. Dass Frankreich und die Niederlande in konfessionellem Hass und Gewalt versanken, während im Reich Frieden herrschte, gab den Zeitgenossen zusätzlich zu denken, besonders nach den Massakern der Bartholomäusnacht vom 23. auf den 24. August 1572, als französische Katholiken in Paris und Umgebung mehrere tausend Hugenotten ermordeten, angefangen mit einer hochadligen Hochzeitsgesellschaft. Lazarus von Schwendi, der einflussreichste Militärberater des Kaisers, schrieb damals, derartige Gewaltausbrüche würden die Verteidigungsbereitschaft des Reiches gegen die Osmanen schwächen – und damit alle Christen in große Gefahr bringen. Seine Vorschläge für mehr Toleranz ähneln jener Herangehensweise, die man im Frankreich der Zeit als Position der politique bezeichnete: Angestrebt wurde ein Frieden, der durch die Loyalität aller Untertanen zu einer starken, überkonfessionellen Monarchie gesichert sein würde. Andere gingen noch weiter. Der Reichspfennigmeister und Vorsteher der Reichskasse, Zacharias Geizkofler, etwa, dessen Vorname allein ihn ohne Weiteres als Protestanten kenntlich machte, brachte vor, die weltliche Obrigkeit habe kein Recht, irgendjemandem seinen Glauben vorzuschreiben. Überhaupt müsse jede echte Toleranz aus wechselseitigem Verständnis erwachsen und könne nicht das Werk politischer Berechnung sein.
Obgleich Geizkofler eine Minderheitenmeinung vertrat, bleibt doch unbestritten, dass die Europäer des 16. Jahrhunderts mehrere gedankliche Welten zugleich bewohnten und sich die unterschiedlichsten Vorstellungen zu eigen machen konnten, ohne sie zwangsläufig in Einklang bringen zu wollen. Sachverhalte, die uns heute widersprüchlich und unvereinbar erscheinen, stellten sich für die Zeitgenossen womöglich ganz anders dar. Gewiss, die konfessionelle Militanz nahm zu – vor allem als in den Jahren um 1580 mit den Angehörigen der „Generation Reformation“ jene in einflussreiche Positionen kamen, die in einer konfessionell gespaltenen Welt aufgewachsen waren und keine andere mehr kannten. Dennoch ist der Kriegsausbruch von 1618 unmöglich aus einer solchen gedanklichen Prägung allein zu erklären. Um die Beziehung zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und der Religion angemessen einschätzen zu können, müssen wir zunächst einen genaueren Blick auf den Augsburger Religionsfrieden werfen und insbesondere beleuchten, wie sich im Anschluss daran konfessionelle Differenzen mit Verfassungskontroversen verflochten.