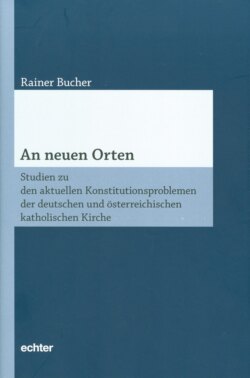Читать книгу An neuen Orten - Rainer Bucher - Страница 43
2.2 Die gesellschaftliche Entwicklung
ОглавлениеDie pastoraltheologische Relektüre des Synodenbeschlusses kann zudem die Entwicklungen rekonstruieren, die zur beschriebenen Irrelevanz kirchenoffizieller Diskurse im Feld von „Ehe und Familie“ führten. Hier dürften zwei an sich zu unterscheidende, sich aber wechselseitig verstärkende und zuletzt in ihrer gemeinsamen Grammatik verwandte Prozesse zu jener geradezu diametralen Spreizung von kirchlicher Norm und realen Praktiken auch bei praktizierenden Kirchenmitgliedern im Feld von Ehe, Familie und Sexualpraktiken geführt haben, die heute zu beobachten ist.
Zum einen hat in den letzten Jahrzehnten ein grundlegender Umbau der Vergesellschaftungsformen des Religiösen in der deutschen Gesellschaft stattgefunden. Religiöse Partizipation und religiöse Praktiken organisieren sich dramatisch abnehmend in den Kategorien von exklusiver Mitgliedschaft, lebenslanger Gefolgschaft und umfassender religiöser Biografiemacht, wie sie für die katholische Kirche lange nicht nur normativ, sondern in hohem Maße auch real galten. Im Zuge der globalen Durchsetzung eines liberalen, kapitalistischen Gesellschaftssystems geraten religiöse Plausibilitäten und die ihnen folgenden moralischen Normen und Praktiken unter den Zustimmungsvorbehalt des Einzelnen. Je näher diese Plausibilitäten und Normen die persönliche Lebensführung berühren, umso mehr wird diese Freiheit auch beansprucht.121 Dies bedeutet nichts weniger als die Verflüssigung der Kirchen als ehemals mächtige Heilsbürokratien.122
Der gleiche hintergründige Freisetzungsprozess hat auch zur Verflüssigung der früher mehr oder weniger ehernen Geschlechterrollen geführt. Es ist zwar erst seit kurzem, aber eben mittlerweile überaus wirksame gesellschaftliche Realität, dass Frauen gleichberechtigten Zugang zu Bildungsressourcen und damit zu Positionen mit eigenständigen Einkommens- und damit Selbsterhaltungschancen besitzen.123 Dies befreite Frauenbiografien von der früher praktisch unlösbaren (Ausnahme: Klostereintritt) Kopplung an Männerbiografien. Grundsätzlich entkoppelt wurden zudem mehr oder weniger zeitgleich Sexualität von Reproduktion sowie das patriarchale Schema, das Frauen der „Innenwelt“ von Gefühl, Haushalt und Religion, Männer aber der „Außenwelt“ von Öffentlichkeit, Herrschaft, Rationalität und Krieg zuwies.
Der daraus folgende irreversible Wandel der Familienformen ist Gegenstand intensiver soziologischer Forschung.124 Denn:
[Das] Ausmaß der Veränderungen ist verblüffend. An Stelle der fraglosen Realisierung der elterlich-traditionellen Lebensform ist deren Infragestellung getreten. Was bei den Eltern noch als kulturelle Selbstverständlichkeit galt, ist für die Kindergeneration zum Gegenstand von Aushandlungsprozessen zwischen den Partnern geworden. (…) Das Hochbemerkenswerteste dieses Wandels liegt in der Tatsache, daß er sich in einem Zeitabstand von nur einer familiaren Generation abgespielt hat.125
Die Zahl der Eheschließungen pro Tausend Einwohner etwa nahm von 1950 bis 2009 um mehr als die Hälfte von 10,8 auf 4,6 ab.126
Selbst auf einem Studientag der Deutschen Bischofskonferenz im Jahr 2008 wurde vom familiensoziologischen Referenten den kirchlichen Amtsträgern deutlich gemacht, dass unter diesen Bedingungen eine „Re-Traditionalisierung von Ehe und Familie, damit eine unweigerliche Re-Traditionalisierung der Geschlechterverhältnisse … ausgeschlossen“127 ist. Wobei die Geschichte belegt, dass etwa jenes vom kirchlichen Lehramt noch bis vor kurzem teilweise vehement vertretene Modell der „Hausfrauenehe“128 selbst erst neueren Datums ist, insofern „die in den letzten Jahrzehnten gestiegene Erwerbstätigkeit von Müttern kein neuartiges Phänomen [ist], sondern … nur die Rückkehr der Frauen in früher innegehabte Positionen des Produktionsprozesses [bedeutet]“129. Erst für die bürgerliche Ehe ab dem 19. Jahrhundert war es charakteristisch, dass die Ehefrau keiner Erwerbsarbeit nachgehen musste. Neu freilich ist heute die tendenzielle, wenn auch immer noch zögerliche, politisch aber gewollte und unterstützte Auflösung geschlechtsspezifischer Berufswahl und Statuslagen.
Die strukturelle Individualisierung, welche die Lagen und Interessen von Männern und Frauen gegeneinander freisetzt und einerseits zur Pluralisierung der Lebensformen führt, andererseits zu permanenten Aushandlungsprozessen zwingt, fördert nun aber umgekehrt die Sehnsucht nach Zweisamkeit. Ehe, Familie, Partnerschaft werden zum Ort, wo die emotionalen Defizite und Widersprüche einer durchmodernisierten Markt- und Wettbewerbsgesellschaft kompensiert werden sollen.
Betrachtet man die drei wichtigsten Partnerschaftsformen – Ehe, living apart together und nichteheliche Lebensgemeinschaften – zusammen, so wird im jungen Erwachsenenalter sogar eine zunehmende Bindungsquote über die Generationen hinweg sichtbar. Für fast 95 Prozent der … Großstädter ist die feste Zweierbeziehung nach wie vor das angestrebte Beziehungsideal.130
Familie und Paarbeziehung sind mit Abstand das Wichtigste im Leben der Deutschen und doch – oder eben gerade deshalb – stiegen die Scheidungszahlen131 und steigt weiterhin die Zahl der Alleinlebenden.132 Es gibt nach wie vor eine große Sehnsucht nach einer glückenden, dauerhaften Paar- und Familiengemeinschaft als Bereitschaft zu und Erfahrung von umfassender Solidarität zum anderen als Gesamtperson, inklusive gar der Bereitschaft, diese in eine verbindliche, etwa eheliche rechtliche Form zu bringen, was nicht zuletzt die in fast allen entwickelten Ländern zu beobachtende Institutionalisierung homosexueller Beziehungen in eheähnlichen Formen belegt. Wenn freilich die Partnerschaft die erhoffte Dichte der Erfahrungen und Gefühle nicht erreicht, dann wird die „Ehescheidung … immer öfter als legitime Form ehelicher Konfliktlösung und immer seltener als moralisches Versagen der Ehepartner interpretiert.“133
Dieser Befund markiert eine merkwürdige Umkehrung der Struktur von Intimität und Ökonomie. In vormodernen, agrarischen Gesellschaften war die Ehe ein (trieb-)ökonomisches Projekt, das zwar sexuelle, aber keineswegs personale Intimität voraussetzte. Nähe fand man in dem, was heute eher Öffentlichkeit heißt: bei Freunden, den eigenen Verwandten, im Wirtshaus, auch in der Geborgenheit einer stabilen religiösen Verortung. Die Ehe war ökonomisch, aber nicht notwendig personal intim. Heute soll sie nicht nur sexuell, sondern auch personal intim sein, aber gerade nicht mehr ökonomisch motiviert. Sie ist es auch tatsächlich immer weniger. Ökonomisch grundiert ist heute vor allem die Entscheidung für oder gegen Kinder. Das ist im Übrigen überaus rational, setzt die Entscheidung für Kinder wegen der „strukturellen Rücksichtslosigkeit“134 der Gesellschaft gegenüber Familien doch die Lösung von ausgesprochen schwierigen mittel- und langfristigen Ressourcen- und Vereinbarkeitsproblemen voraus. Kinder sind neben der Arbeitslosigkeit hierzulande schließlich das größte Armutsrisiko.