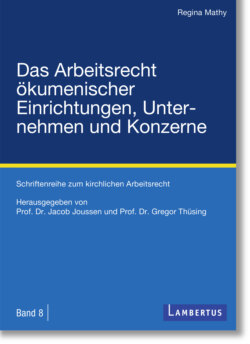Читать книгу Das Arbeitsrecht ökumenischer Einrichtungen, Unternehmen und Konzerne - Regina Mathy - Страница 49
e) Stellungnahme
ОглавлениеEine klare Empfehlung für die Rechtsformwahl kann nicht gegeben werden, vielmehr kommt es auf die Zwecksetzung der jeweiligen Einrichtung sowie den Tätigkeitsbereich an. Zudem bieten die Rechtsformen zahlreiche Ausgestaltungsmöglichkeiten für den Einzelfall – wie beispielsweise die Schaffung weiterer Organe oder spezifische Kontrollvorgaben in der Satzung bzw. dem Gesellschaftsvertrag.
Tendenziell ist wohl die GmbH vorzugswürdig für ökumenische Einrichtungen. Hierdurch werden klare Entscheidungsstrukturen geschaffen. Ehrenamtlich Tätige bzw. Gemeindepfarrer werden entlastet und auf eine reine Kontrolle des regelmäßig hauptamtlich tätigen Geschäftsführers beschränkt.287 Der Gesellschaftsvertrag bietet die Möglichkeit, Zustimmungsvorbehalte der Gesellschafterversammlung vorzusehen und es kann ein Aufsichtsrat als zusätzliches Organ geschaffen werden. Beim Verein kommt der Mitgliederversammlung im Gegensatz zur GmbH eine weitreichende Entscheidungskompetenz zu. Belässt man es bei dieser gesetzlichen Vorgabe ohne entsprechende Anpassung der Satzung, führt dies zu langwierigen Entscheidungsprozessen. Aufgrund einer entsprechenden Abänderung der Satzung könnten Entscheidungen weitgehend auf den (hauptamtlich tätigen) Vorstand übertragen werden. Die Stiftung sichert eine enge Bindung an den Stiftungszweck und die Verpflichtung zum Erhalt des Stiftungsvermögens. Die ökumenische Zwecksetzung kann hierdurch fest verankert werden, andererseits werden die Ausgestaltungsmöglichkeiten beschränkt. Das Haftungsrisiko für ehrenamtlich tätige Vorstände und Gesellschafter wurde durch das Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes weitgehend begrenzt. Insoweit unterscheiden sich die Rechtsformen, sofern die entsprechenden Voraussetzungen der Haftungsprivilegierung vorliegen, dahingehend kaum.