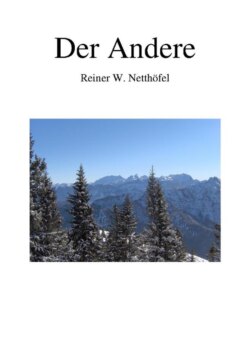Читать книгу Der Andere - Reiner W. Netthöfel - Страница 7
6.
Оглавление„Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, wird wohl was mit ‚M‘ gewesen sein. Wie viele Vornamen mit ‚M‘ gibt es, was meinst du?“, keifte Kyonna ihre Tochter an, „Ich weiß auch nicht mehr, wie er aussah, keinen Schimmer. Wahrscheinlich war ich stoned.“ Das Gespräch war beendet. So hatte ihre Mutter noch nie mit ihr gesprochen. Sie hatten immer ein gutes Verhältnis gehabt, gerade auch, seit Stefania auf der Welt war. Es schien fast so, als wolle Kyonna ihr schlechtes Verhältnis zu ihrer Enkelin durch ein besonders gutes zu ihrer Tochter kompensieren. Aber so etwas. Na ja, Stefanias Vater war wohl keine Schönheit gewesen, aber was ihre geistigen Gaben anbelangte, war deren Herkunft eindeutig.
Holly stand nackt vor ihrem Kleiderschrank und wusste nicht, was sie anziehen sollte. Hunger hatte sie auch, aber sie wusste nicht, ob sie vorher noch etwas essen sollte, oder ob es bei Montanus etwas gab. Der Mann war ja gestern ziemlich schweigsam, ja abweisend gewesen, nachdem sie ihm gesagt hatte, warum sie ihn sprechen wollte. Sie entschied sich für ein buntes, leichtes Sommerkleid, eine Strickjacke und elegante Schuhe. Sie lächelte. Vielleicht würde sie ein wenig mit ihm flirten. Er könnte zwar ihr Vater sein, aber ….
Sie wollte gerade ihre Tasche umhängen und vor das Haus treten, um auf ihn zu warten, als es klopfte. Sie öffnete die Tür und vor ihr stand Magnus Montanus in dem schummrigen Flur.
„Guten Abend, Mrs. Bryant, ich bin etwas früh, aber ich wollte nicht auf der Straße auf Sie warten, und … Ich war unterwegs und wollte nicht erst nach Hause fahren, na ja, kommen Sie?“ Er trug eine bequeme Leinenhose und ein ebensolches Hemd, dazu braune Slipper. Und er sah sie, geradezu demonstrativ, von oben bis unten an, allerdings ohne eine Miene zu verziehen oder in irgend einer Weise ihr Aussehen zu kommentieren. Sie war Blicke von Männern gewohnt, aber die waren meist nicht neutral, sondern sehr eindeutig. Sie wusste, wie sie auf Männer wirkte: begehrenswert. Umso erstaunter war sie über seine scheinbare Gleichgültigkeit, ja, sie war geradezu enttäuscht.
„Ja, ich bin gerade fertig geworden.“
„Hereinbitten dürfen Sie aber niemanden, das würde zu eng.“, bemerkte er mit einem kritischen Blick in ihr Zimmer.
„Das hatte ich auch nicht vor.“, entgegnete sie unfreundlicher, als sie wollte.
„Ja.“ Er wandte sich ohne einen weiteren Kommentar um und ging vor ihr her.
Sie hatte nicht so abweisend sein wollen, aber seine Bemerkung über die Größe ihres Zimmers schien ihr unangemessen. Sicher sah er auf sie herab, er, der reiche Unternehmer. Jetzt stapfte er arrogant davon. Na bitte.
Draußen hielt er ihr die Beifahrertür seines schwarzen SUV auf. Ein Gentleman ist er auch noch, dachte Holly spöttisch.
Sie fuhren schweigend dieselbe Strecke, die sie gestern zu Fuß genommen hatte.
Vor dem Tor hielten sie kurz an, das Tor öffnete sich und sie fuhren die geschotterte Einfahrt hinauf bis zu einer breiten Treppe, die in einigen Stufen zu einer mächtigen Eingangstür führte. Montanus ging voran, schloss auf und ließ Holly den Vortritt. Er warf die Schlüssel nachlässig auf ein kleines Tischchen in der Eingangshalle, die dunkel vertäfelt daherkam, dann ging er wieder voran, öffnete eine hohe Tür und sie befanden sich in einer Art Salon.
Alles wirkte alt und edel, aber gemütlich. Es hatte Stil. Und es war teuer.
„Lassen Sie uns auf die Terrasse gehen, solange es noch warm ist.“, sagte er und öffnete die entsprechenden Türen. Die Terrasse war groß, von einer niedrigen Mauer umgeben und lag etwas oberhalb eines leicht verwilderten, großen Gartens, der über eine breite Treppe erreichbar war. Montanus wies auf einen bequemen, geflochtenen Gartensessel, der an einem großen Tisch stand, zog ihn etwas zurück und ließ Holly Platz nehmen. Außer Vogelgezwitscher war nichts zu hören.
„Schön ruhig haben Sie es hier.“, meinte Holly.
„Ja, es ist ruhig. – Möchten Sie etwas trinken? Ich habe auch etwas zu essen vorbereitet, wenn Sie mögen.“
„Ich hatte gestern und vorgestern etwas viel Alkohol. Und ja, Hunger hätte ich schon.“
„Ich hole mal Wasser und Wein. Sie können das mixen, wenn Sie wollen. Ich trinke Bier.“
„Das müssen Sie ja wohl.“, lachte sie.
„Nein, nein, nicht wegen des Geschäfts, ich mag es eben.“ Er brachte die Getränke und setzte sich dann an die Kopfseite des Tisches, rechts neben sie.
„Das Essen dauert noch ein paar Minuten.“ Holly schaute an der imposanten Hausfassade hoch.
„Leben Sie hier alleine?“, fragte sie ohne Hintergedanken. Montanus räusperte sich.
„Ja.“
„Ist das nicht ein wenig einsam?“, lächelte Holly ihn an.
„Man kann alleine sein, ohne sich einsam zu fühlen.“ Das klang fast ein wenig trotzig.
„Sind Sie allein, haben Sie keine Familie oder Freunde?“ Nachdem sie die Worte gesprochen hatte, überfiel Holly ein schlechtes Gewissen. Sie war eine Fremde, hatte sich praktisch selbst eingeladen, der Mann hatte für sie gekocht und jetzt stellte sie ihm solche Fragen. Mit ausdruckslosem Gesicht sprang Montanus auf und eilte in das Haus, um wenig später mit Tellern und einer Auflaufform wiederzukommen. Holly hatte schon gedacht, ihre Unterredung sei beendet worden wegen ihrer vorlauten Fragen.
„Entschuldigung.“, murmelte sie.
„Wie bitte?“, fragte er verwirrt.
„Meine Fragen; ich wollte nicht persönlich werden.“
„Greifen Sie zu. – Ist schon gut. Es ist ja durchaus ungewöhnlich, dass jemand wie ich alleine lebt, aber Sie müssen sich keine Sorgen machen, ich bin wirklich nicht einsam. Ich habe ein paar Freunde, wirkliche Freunde, überall auf der Welt. Ich komme viel herum, wissen Sie.“
„Es schmeckt köstlich.“, meinte sie mit vollem Mund und meinte es auch so.
„Danke.“
„Sind diese Freunde Ihresgleichen?“ Einen kurzen Moment schien er mit der Antwort zu zögern, ja, er schien sich für einen Bruchteil einer Sekunde ertappt zu fühlen. Dann hellte sich seine Miene unmerklich auf.
„Unternehmer, meinen Sie?“ Holly nickte kauend und Montanus lachte.
„Nein, glücklicherweise nicht.“ Sie runzelte die Stirn.
„Warum ‚glücklicherweise‘? Was sind denn das für Leute, Ihre Freunde, meine ich?“ Montanus schüttelte kauend den Kopf.
„Alle möglichen Leute. Alle Hautfarben, jedes Alter, jede Schicht. Wissen Sie, ich kümmere mich nicht so sehr um das Unternehmen, für mich gibt es Wichtigeres.“ Für Satte gibt es auch Wichtigeres als Essen, dachte Holly. Da war sie wieder, seine – Abgehobenheit?
„Was ist wichtiger?“, fragte sie mit Neugier. Er sah sie seltsam an.
„Nun, ich bin sehr an Geschichte interessiert, Politik, Philosophie.“ Er interpretierte ihren Ausdruck, und zwar richtig. „Ich kann mir das leisten, das wollen Sie doch hören, nicht wahr?“ Holly fühlte sich ertappt und sah nieder.
„Entschuldigung, ich wollte Ihnen keinen Vorwurf machen. Ich …“
„Schon gut. Ich kann mir denken, dass ich einem Klischee entspreche. Aber ich habe mir selbst nichts vorzuwerfen. Diesen Luxus gönne ich mir erst seit einem kurzen Abschnitt meines Lebens.“ Den weitaus größten Teil davon habe ich mit Überlebenskampf und Versteckspielen verbracht, dachte er.
Holly schob ihren leeren Teller von sich und lehnte sich zurück.
„Puh, ich bin satt; das war sehr gut.“ Montanus schob ebenfalls den Teller nach vorn und betupfte sich die Lippen mit einer Serviette.
„Digestif?“, fragte er und trank sein Bier leer. Holly nickte verunsichert.
„Dann nehmen wir einen Grappa.“ Grappa. Was war das?
Er räumte ab und erschien mit zwei kleinen, langstieligen Gläsern, einer kleinen Flasche und einem neuen Bier. Holly verzog das Gesicht etwas, als die Flüssigkeit sich ihre Speiseröhre herunterbrannte.
„Was kann ich denn nun für Sie tun, Mrs. Bryant?“ Montanus lehnte sich entspannt zurück.
Holly nahm noch einen Schluck Wein ohne Wasser, um sich Mut zu machen, überlegte kurz und begann, wie sie es sich ausgedacht hatte, was im wesentlichen hieß, zunächst die harmlosere Variante zu erzählen.
„Mein Name ist Bryant, weil meine Großmutter mütterlicherseits einen Bryant geheiratet hat. Ihr Familienname hingegen war Montanus …“ Der Gastgeber hatte sich anscheinend an seinem Bier verschluckt.
„Entschuldigung.“, hustete er in seine Serviette und griff zur Zigarettenschachtel.
„Keine Sorge, wir sind nicht verwandt.“, lachte Holly und fuhr fort: „Die Namensgleichheit liegt ganz einfach daran, dass der Mann und die Frau, die am Anfang unserer Familiengeschichte stehen, als Sklaven einem Mann gehört hatten, der diesen Namen trug. Damals trugen die Sklaven die Nachnamen ihrer Besitzer.“ Sie wartete auf eine Reaktion, erhielt aber keine, außer, dass er sie bemüht ausdruckslos ansah. Sie zog Maddys Bilder aus ihrer Tasche und bekam schon wieder ein schlechtes Gewissen, als Montanus aufsprang und hineinging. Kurz darauf wurde es hell auf der Terrasse und er setzte sich wieder, so dass sie ihm die Bilder hinlegen konnte. Er beugte sich vor und schaute auf die Blätter, doch Holly schien es, als sähe er gar nicht richtig hin, als husche sein Blick nur flüchtig – pro forma? – darüber, er reagierte aber nicht.
„Dieser Mann hieß Magnus Montanus, wie Sie. Er hatte die beiden freigekauft.“ Jetzt, direkt angesprochen, musste er reagieren.
„Ja.“ Er machte eine Pause und sein Blick kehrte sich nach innen. Er war hundertfünzig Jahre jünger und verabschiedete sich von Sarah und Tom. Noch nie in seinem Leben hatte er so schmerzlich Abschied nehmen müssen. Minutenlangen Umarmungen folgte herzzerreißendes Weinen. Xavier musste Sarah davon abhalten, dem Zug hinterherzulaufen. Viele Jahre hatte Sarah ihm geschrieben, bis er umziehen musste und ihre Briefe nicht mehr kamen. Dafür kamen seine zurück, weil offenbar auch jenseits des Atlantiks Veränderungen stattgefunden hatten. Sarahs Briefe füllten zwei Karteikästen in seinem Tresor. Er hatte Mühe, seine Gesichtszüge zu kontrollieren, musste alle Willenskraft aufwenden, um die Tränen zurückzuhalten, doch irgendwann ging das nicht mehr. Zu viele Gefühle verbanden ihn mit Sarah und ihrem Freund. Montanus erhob sich mit abgewendetem Gesicht zum dritten Mal und ging zum dritten Mal hinein und ließ Holly ratlos zurück. Er begab sich in den Keller, schloss sich ein und ließ seinen Gefühlen ihren Lauf.
Nach unendlichen zehn Minuten kehrte er, scheinbar gelassen, wieder zurück und sah ein fragendes Gesicht.
„Sie müssen mich entschuldigen, aber im Keller musste etwas gerichtet werden und das Single-Dasein lässt mich manchmal die Höflichkeit vergessen. Wo waren wir stehen geblieben? – Ach ja. Nun, es ist möglich, nein, sogar wahrscheinlich, dass es sich um einen Vorfahren gehandelt hat, denn unser Name ist nicht so häufig und die Verbindung mit dem Vornamen wird in unserer Familie seit Jahrhunderten weitergegeben. Aber ich weiß nichts darüber, tut mir leid.“, bedauerte er. Holly legte ein anderes Foto auf den Tisch.
„Burt und Edna King, Edna eine geborene Montanus, waren begnadete Köche. Sie träumten von einem eigenen Restaurant, hatten in einem schwarzen Viertel New Yorks jedoch nur eine Imbissbude. Eines Tages erhielten sie die Chance, ein Restaurant in einem besseren Viertel zu mieten. Sie kratzten ihr Geld zusammen, richteten es neu ein und eröffneten ihr Lokal. Doch es kamen keine Gäste, die Fenster wurden eingeschlagen, Burt angegriffen. Das alles, weil sie Schwarze waren und nicht in dieses Viertel gehörten. Dann eröffnete ein paar Häuser weiter eine erlesene Weinhandlung mit Weinen und Schnäpsen aus Europa. Zur Eröffnung kam der Boss selbst. Er hörte von Burt und Edna und orderte das Eröffnungsbuffet bei ihnen. Es wurde ein voller Erfolg. Der Boss aß jeden Abend bei Burt und Edna und schon bald kamen die Gäste, die das Buffet kennengelernt hatten und sahen, dass Weiße auch bei Schwarzen essen können. Die Übergriffe hörten auf. Der Weinhandel belieferte Burt und Edna zu Vorzugspreisen. Der Boss des Weinhandels hieß Magnus Montanus.“ Holly goss sich noch ein Glas Wein ein und Montanus holte sich noch ein Bier.
„Ja, das Weinkontor haben wir immer noch. Hin und wieder bin ich dort, wenn ich mal in den USA bin.“ Kein weiterer Kommentar.
Einen weiteren Grappa lehnte Holly ab, was ihn nicht hinderte, sich noch einen doppelten zu genehmigen. Wenn er so weitermacht, dachte Holly, ist er gleich blau, vielleicht bekomme ich dann die Wahrheit aus ihm heraus. Holly legte das nächste Bild auf den Tisch.
„Washington 1963. ‚I had a dream‘, Martin Luther King. Meine Großtante Patty, damals verlobt mit Dick Bryant, war dabei. In ihrer Nähe befand sich aber auch ein durchgeknallter weißer Rassist, der eine Waffe zog und in die Menge schießen wollte. Ein Mann“, sie legte das Bild auf den Tisch, „ der aussah wie Sie, entwand ihm die Waffe, nachdem ein Schuss gefallen war, der aber scheinbar niemanden verletzte. Patty verdankt ihm sein Leben.“ Holly sah ihn herausfordernd an und er sah mit einem unschuldigen Blick zurück.
„Kann mein Vater gewesen sein, aber er hat nie darüber gesprochen; er war ein bescheidener Kerl.“ So einfach ist das also.
„Gibt’s eigentlich auch Mütter in ihrer Familie?“ Aufgrund des Alkohols klang Holly unwillentlich ein wenig aggressiv.
„Sicher, aber die haben sich immer sehr im Hintergrund gehalten.“ Ende der Information. Holly legte das nächste Foto auf den Tisch.
„Tennessee, 1985. Abraham Montanus wird vom KKK entführt und soll misshandelt werden. Ihr … Vater ist geschäftlich dort unterwegs und erfährt von seinem Namensvetter Lyndon Montanus, Abrahams Vater. Er sucht ihn gerade an dem Tag auf, als Abe entführt wird und bietet seine Hilfe an. Gemeinsam machen sie sich auf, den Jungen zu finden; Ihr Vater ist bewaffnet, zerschießt die Peitsche, mit der Abraham verprügelt werden soll und erschrickt die Kapuzenmänner durch ein paar Schüsse, die Party ist aus. Hat er davon auch nichts erzählt?“ Die Zweifel waren deutlich herauszuhören.
„Nein.“, beschied er sie knapp.
„Will Montanus will einen Magnus Montanus Ende des zweiten Weltkrieges in den Alpen getroffen haben; in einem Berggasthof – zusammen mit einer Partnerin, der ersten, die erwähnt wird.“
„Da sehen Sie‘s.“ Er sah sie triumphierend an und nun auf den Boden und faltete die Hände, die Ellenbogen auf seinen Oberschenkeln. Holly trank Wein.
„Unsere Familien treffen immer wieder aufeinander, seit einhundertfünfzig Jahren.“, resümierte sie.
„Und jetzt sitzen Sie hier.“, stellte er nachdenklich fest.
„Und jetzt sitze ich hier.“ Er sah sie an und sie glaubte, einen seltsamen und gleichzeitig vertrauten Ausdruck in seinen Augen zu erkennen. Sie kannte genau diesen Ausdruck von ihrer Tochter. Holly verscheuchte mit einem Kopfschütteln einen Gedanken.
„Es ist schön, dass Sie mir das alles erzählt haben, ich wusste es nicht. Jetzt kann ich auf meine Vorfahren noch ein wenig stolzer sein.“, gab er vor.
„Die sahen alle so aus, wie Sie.“, gab sie Bekanntes bekannt.
„Das ist bei uns so.“, war seine lapidare Antwort auf ihre Provokation.
„Das ist ungewöhnlich. Das ist sogar unmöglich. Über Generationen hinweg verändert sich das Aussehen.“, behauptete sie etwas lauter.
„Bei uns eben nicht.“, erwiderte er trotzig. Sie trank ihr Glas in einem Zuge leer und setzte es mit einem Knall ab.
„Ich glaube das nicht.“ Jetzt bin ich auf Dicks Linie, erkannte sie, und wusste nicht, ob das richtig, oder gut war. Sie goss ihr Glas erneut voll, wobei sie etwas von dem Wein verschüttete.
„Ihr Problem.“, gab er zurück.
„Mein Problem?“, schrie sie.
„Sicher.“
„Ich denke, Sie haben ein Problem.“ Montanus lehnte sich entspannt zurück.
„Das müssten Sie mir dann mal erklären.“, erklärte er herausfordernd.
Dann stand er auf und ging mit einem Kopfnicken, das sie überheblich fand, mit dem Geschirr hinein.
„Mist.“, befand sie. Etwas hatte sie falsch gemacht. Entschlossen stand sie auf und folgte ihm.
Sie fand ihn in der Küche. Er räumte gerade das Geschirr in die Spülmaschine und sah sie aus einer gebückten Haltung an. Sie erschrak, denn einen solchen Gesichtsausdruck hatte sie noch nie gesehen. Auch bei ihrer Tochter nicht. Es lag einerseits eine unendliche Traurigkeit darin, die fast schon schmerzvoll zu sein schien. Andererseits drückte er auch eine starke Entschlossenheit aus, einen unbedingten Willen. Die dritte Facette kannte sie allerdings von ihrer Tochter; es war der Ausdruck von Wissen. Holly lehnte am Türrahmen und sagte: „Es tut mir leid.“ Montanus richtete sich auf und sah sie an. Sein Blick war jetzt anders. Eisig. Undurchschaubar. Abweisend. Er zeigte drohend mit dem Finger auf sie.
„Sie kommen hierher, um mir schöne Geschichten zu erzählen. Gut. Interessant, dass unsere Familien in der Vergangenheit – und auch heute – einige Berührungspunkte hatten und haben. Prima, dass meine Vorfahren Ihren Vorfahren hier und da mal behilflich gewesen waren. Das ehrt sie und mich. Dass meine männlichen Vorfahren so aussahen, wie ich aussehe, ist ein Fakt und dafür kann ich nichts. Es ist eben so. Es gibt keine Veranlassung, mir das vorzuwerfen, oder ein Problem daraus zu machen.“
„Deshalb habe ich mich ja entschuldigt. Haben Sie noch nie darüber nachgedacht, dass diese Ähnlichkeit eigentlich unmöglich ist?“ Montanus lachte gekünstelt.
„Es ist manchmal lästig, für seinen eigenen Großvater gehalten zu werden.“
„Onkel Dick meint, es gibt nur einen Magnus Montanus und es gab nur einen Magnus Montanus.“ Montanus lachte nicht.
„Natürlich gibt es mich nur ein Mal, und meinen Großvater gab es auch nur ein Mal.“
Holly schüttelte ungeduldig den Kopf.
„Er meint, dass Sie ihr Großvater sind.“ Er lachte einmal kurz.
„Bitte?“ Sie schüttelte den Kopf heftig.
„Nein, natürlich nicht, sondern dass Ihr Großvater und Sie eine Person sind.“
„Aha.“ Er bückte sich wieder und fuhr fort, Geschirr einzuräumen.
„Dass Sie damals Tom und Sarah gekauft und freigelassen haben.“ Er erhob sich wieder und sah sie an.
„Sehe ich aus, als sei ich … über einhundertfünfzig Jahre alt?“
„Nein.“
„Danke.“ Er wollte sich wieder bücken.
„Er meint, Sie sind unsterblich.“, verhinderte sie dies.
„Machen Sie sich nicht lächerlich.“, rief er unwillig und aufrecht.
„Es ist Onkel Dicks Meinung.“, distanzierte sie sich.
„Ist Ihr Onkel Dick gesund?“, erkundigte er sich, scheinbar besorgt und tippte sich mit dem Finger an den Kopf. Holly trank aus ihrem mitgebrachten Glas und wurde wütend. Diese Temperamentsschwankungen hatte sie von ihrer Mutter.
„Danke, es geht ihm gut.“, antwortete sie schneidend.
„Ich meine, weiß er, was er da denkt?“ Der Finger fuhr wieder an die Stirn.
„Ein großer Teil meiner Familie denkt so.“, antwortete sie trotzig und trank Wein.
„Dann sollte die ganze Familie mal zum Arzt.“, riet er.
„Beleidigen Sie meine Familie nicht.“, schrie sie ihn an.
„Sie sind irre.“ Es war nicht ganz klar, ob er Holly meinte, oder ihre gesamte Sippschaft, aber Holly sah rot. Sie stellte ihr Glas ab, ergriff ein kleines Küchenmesser, das auf der Anrichte lag und stieß es ihm knapp unterhalb des Schulteransatzes in die Brust. Sein Gesicht verzerrte sich, was aber eher an der Überraschung als an einem Schmerzempfinden zu liegen schien. Fast gleichzeitig schlug Holly mit schreckgeweiteten Augen die Hände vor den Mund. Montanus sah sich scheinbar unbeteiligt den Messergriff an, ergriff diesen dann und zog es aus seinem Körper. Blut sickerte aus der Wunde, als er es herausgezogen hatte. Er warf das Messer in die Spüle und sah Holly an. In seinem Blick war keinerlei Vorwurf, sie sah nur wieder diese unendliche Tiefe, dann rannte er entschlossen aus dem Raum. Holly streckte die Hände nach ihm aus, aber er war schon auf der Treppe.
„Was habe ich getan?“, flüsterte die junge Frau entsetzt und Tränen liefen über ihr hübsches Gesicht, das ein einziger Ausdruck von Erschrecken über die eigene Tat war. Sie stützte sich zitternd auf der Arbeitsplatte ab und ließ den Kopf hängen. Von oben hörte sie Türenschlagen und dann Wasser laufen. Sie weinte still vor sich hin und war geneigt, dem Alkohol die Schuld für ihre Tat zuzuschreiben, doch die war nicht entschuldbar. Auch nicht durch Alkohol. Ich muss ihm helfen, dachte sie, wenigstens das. Mit weichen Knien machte sie sich auf den Weg.
Jetzt war alles aus. Vielleicht lag er oben und starb. Vielleicht rief er die Polizei. Niemals würde sie von ihm noch eine klitzekleine Information erhalten. Und das andere … Sie war bereit gewesen, den Gedanken zuzulassen, dass sie ein wenig in ihn verliebt war. Vorbei. Aus.
Oben konnte sie ihn nirgendwo entdecken, wahrscheinlich war er im Bad. Sie rief zaghaft nach ihm, erhielt aber keine Antwort.
„Herr Montanus. Bitte. Es tut mir leid. Kann ich Ihnen helfen? Wo sind sie? Bitte.“ Sie irrte umher. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Warum nur hatte sie das getan? Sie wischte sich mit den Handrücken die Tränen aus dem Gesicht.
Eine Tür stand offen. Offenbar sein Arbeitszimmer. Sein Schreibtisch. Bücher über Bücher. Zum großen Teil uralt. In allen Sprachen. Auf dem Schreibtisch das gerahmte Foto einer Frau. Einer sehr schönen Frau. Holly nahm es in die Hand. Lange, glatte, schwarze Haare, schwarze Augen, dunkler Teint. Der Blick melancholisch.
„Das ist Tanja.“, ertönte es sonor von der Tür. Holly drehte sich erschrocken um und ließ fast das Bild fallen, was er mit einem strengen Blick quittierte. Er knöpfte sich gerade ein sauberes Hemd zu. Auf seiner Brust klebte ein kleines Pflaster. Das Messer hatte fast bis zum Heft in seinem Körper gesteckt. Sein Gesichtsausdruck war seltsam. Jedenfalls passte er nicht zu dem gerade Geschehenen.
Wie in Trance stellte Holly das Bild wieder ab und zeigte mit dem Finger auf Montanus. Ihr Mund öffnete und schloss sich wie bei einem Karpfen. Zaghaft trat sie auf ihn zu.
„Es tut mir leid. Bitte verzeihen Sie mir.“, krächzte sie. Er machte eine wegwerfende Geste.
„Ist nur ein Kratzer.“ Sie sah ihn verwirrt an, denn er sah fast belustigt aus. Kein Vorwurf, keine Strafpredigt, nichts, was sie erwartet hätte.
„Ich wollte das nicht. Ich hätte Sie töten können.“ Hättest du nicht, dachte er.
„Es ist, wie gesagt, nur ein Kratzer.“ Sie ging auf ihn zu.
„Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein.“, flüsterte sie. Zaghaft berührte sie die Stelle, wo sie das Messer hineingestoßen hatte.
„Fangen Sie schon wieder an?“, schmunzelte er. Sie verstand nichts mehr. Sie hatte ihn provoziert, indem sie ihn mit Dicks abstrusen Ideen konfrontierte, die sie selbst für falsch hielt, sie hatte ihn angegriffen und schwer verletzt, und jetzt tat er das als Lappalie ab und scherzte. Er fasste sie sanft am Arm.
„Kommen Sie, ich erzähle Ihnen von Tanja.“ Er führte sie hinunter, nicht sie ihn. Obwohl er doch verletzt war …
Holly stand unschlüssig in der Bibliothek, die neben dem Salon lag und etwas kleiner war als dieser. Drei Wände waren deckenhoch mit Bücherregalen bestückt, die vierte Wand bildete die Fensterfront zum Garten, der im Dunkeln lag. So viele Bücher hatte Holly bei Privatleuten noch nie gesehen. Es handelte sich hauptsächlich um alte Bücher. Sie trat näher an die Regale heran. Bibeln, Korane, so weit sie das beurteilen konnte. Zum größten Teil konnte sie die Beschriftungen der Deckel nicht lesen, da sie die Sprachen nicht kannte. Philosophische Literatur. Keine Belletristik. Montanus kam und stellte Getränke auf einen niedrigen Tisch.
„Ich …“, wollte sie das Thema wieder aufgreifen, das sie im Augenblick am meisten beschäftigte, doch er war daran nicht interessiert.
„Lassen Sie es, es ist doch jetzt gut. Mir geht es gut, okay?“ Holly nickte, meinte es aber nicht so.
„Haben Sie die alle gelesen?“, fragte sie höflichkeitshalber und, seinem Wunsch entsprechend, ablenkend.
„Die meisten.“
„Verbringen Sie viel Zeit mit Lesen?“, fragte Holly leise, was Montanus lachen ließ.
„Davon habe ich wahrhaft genug.“ Dann schüttelte er den Kopf. „Nein, ich lese nicht mehr so viel wie früher. Das Wichtigste ist geschrieben und das habe ich gelesen.“
„Ich habe Sie angegriffen, habe Sie verletzt …“
„Jetzt ist aber gut. Ich habe Ihre Familie beleidigt. Ich will Ihnen von Tanja erzählen.“ Er wies auf einen freien Sessel.
Holly setzte sich widerwillig und zögernd.
„Mein Großvater war zum Ende des Krieges in eine Berghütte, einen Gasthof, gezogen, der dem Unternehmen gehörte, weil es da am sichersten war. Er hatte sich nie für Politik interessiert, fand aber das Naziregime abscheulich …“
„Interessieren Sie sich für Politik?“
„ Ja, ich bin an Politik interessiert, und das hängt mit Tanja zusammen und mit der Großmutter der beiden Israelis, die Sie kennengelernt haben. Mein Großvater beobachtete eines Tages, der Berggasthof gehört seit Jahrhunderten meiner Familie, eine Menschenschlange in einem Tal. Es handelte sich um Insassen eines KZ, die Anfang 1945 zu ihrer Ermordung an einen geheimen Ort gebracht werden sollten, ein sogenannter Todesmarsch. Wer unterwegs liegenblieb, wurde erschossen. Und es blieben viele liegen, denn es gab keine Verpflegung. Er folgte heimlich diesem schwerbewachten Marsch und sah, wie eine junge Frau, die sich barfuß durch den Schnee kämpfte, umfiel und nicht mehr aufstehen konnte. Ein Soldat legte bereits auf sie an, als Großvater ihn überwältigte, sich die Frau über die Schulter warf und mit ihr auf geheimen Wegen, die nur er kannte, zu seiner Berghütte stapfte. Er war stundenlang unterwegs und musste vom Tal sehr hoch hinauf. Die Frau war das, was man damals ‚Zigeunerin‘ nannte; deshalb war sie dem Tode geweiht. Er versteckte sie, nahm sie bei sich auf, und mit der Zeit wurden sie ein Paar. Sie starb in den Siebzigern.“
Holly hörte diese kleinen Lügen nicht mehr, hörte nicht mehr, wie seine Stimme brach, denn sie war eingeschlafen.
Holly erwachte in einem großen, luftigen Zimmer mit einer hohen Decke. Dankbar griff sie nach der Wasserflasche, die ihr jemand, natürlich Montanus, mit einem Glas auf den Nachttisch gestellt hatte und trank gierig. Die Vorhänge bewegten sich leicht vor dem geöffneten Fenster. Ihre Kleidung war sorgfältig auf einem Stuhl gestapelt. Ihre Kleidung? Bis auf den Slip war sie nackt. Langsam begriff sie und versuchte, den letzten Abend zu rekonstruieren. Monty, so nannte sie Montanus für sich, hatte von einer Tanja erzählt, die sein Großvater gerettet hatte, und Holly war dabei eingeschlafen. Noch so eine Unhöflichkeit. Seine Familie schien aus Samaritern zu bestehen. Sie hatte Monty angegriffen, ihn verletzt, und er hatte sie bei sich übernachten lassen. In diesem riesigen Gästezimmer. Was war er für ein Mensch? Zeitweise hatte sie Angst vor ihm gehabt, als er sie so angeschaut hatte. Dann hatte er ihr leid getan, als er so traurig geschaut hatte. Wie Stefania. Und sie hatte ihn für seine Überheblichkeit gehasst. Das Messer hatte tief in seiner Brust gesteckt, sie hatte es genau gesehen. Aber er schien keine größere Verletzung davongetragen zu haben, schien keine Schmerzen gehabt zu haben. Sie musste pinkeln. Wo war ein Bad? In dem Zimmer gab es nur eine Tür. Sie stand auf und ging hinaus und geradewegs auf eine Tür am Ende des Ganges zu. Monty hatte viel getrunken und schien doch nicht betrunken gewesen zu sein. Es war die Badezimmertür. Offensichtlich war dies nicht das Gästebad. Das war ihr aber egal. Sie musste dringend. Sie sah ins Waschbecken. Es war blutig. Sie setzte sich. In der Wanne lag ein blutgetränktes Hemd. Von wegen, nur ein Kratzer. Aber er hatte nicht gewirkt, als sei er so schwer verletzt. Am Rand des Waschbeckens lag ein gebrauchtes Pflaster. Es war nicht blutig.
Sie fühlte sich mies, schuldig, sie hatte sich eines Verbrechens schuldig gemacht gegenüber einem Mann, ohne dessen Ahnen es ihre Familie gar nicht geben würde. Sie konnte sich nicht ihr Spiegelbild ansehen.
Als sie die Tür öffnete, um in ihr Zimmer zu gehen, stand er vor ihr. Sie erschrak. Sie versuchte erst gar nicht, ihre Blöße zu bedecken, denn schließlich würde er es gewesen sein, der sie ausgezogen hatte. Er hob eine Hand, als ob er sie berühren wollte, und sie schloss schon die Augen und schob ihren Kopf vor, um diesen Augenblick zu genießen, doch es folgte keine Berührung; er ließ die Hand wieder sinken und sie öffnete die Augen wieder. Es war Enttäuschung in ihrem Blick.
„Guten Morgen.“, sagte er freundlich. Er trug Jeans, ein braunes Poloshirt und Sandalen und sah sie offen an. Seine Augen waren anders als gestern. Als habe er etwas beschlossen und sei zufrieden damit. „Ich habe den Frühstückstisch gedeckt und Ihre Sachen aus dem Hotel geholt.“
„Meine Sachen? Warum?“
„Weil ich meine, dass Sie hier besser aufgehoben sind.“
„Aber …“
„Machen Sie sich fertig. Sie können mein Bad benutzen, oder das Gästebad dort drüben. Ich warte unten auf der Terrasse.“
Holly duschte, zog sich an und dachte die ganze Zeit an diesen Mann, den sie gestern noch hatte umbringen wollen, in einem Aufwall von Gefühlen, der ihr aber andererseits äußerst sympathisch war. Ja. Sie musste sich eingestehen, dass sie Gefühle für ihn hegte, aber sie musste es ignorieren, zu widersprüchlich war diese ganze Situation.
Er musste zugeben, dass sie eine schöne, begehrenswerte Frau war. Er war tatsächlich versucht gewesen, sie zu berühren, sie zu streicheln, doch er wusste, dass es nicht dabei geblieben wäre. Es war nicht nur die sexuelle Anziehungskraft, die sie auf ihn ausübte, die sie zweifellos auf ihn ausübte, sondern da war mehr. Er spürte, dass, wenn er seinen Gefühlen freien Lauf ließe, eine große Zuneigung entstehen könnte, und das wollte er sich und auch ihr in ihrer letzten Konsequenz nicht antun. Die letzte Frau, die er geliebt hatte, war Tanja gewesen und der Abschied von ihr war außerordentlich schmerzlich gewesen. Er hatte gewusst, dass sie nicht gemeinsam alt werden könnten, aber diese Tragik hatte er sich nicht ausmalen können.
Die letzte Frau, mit der er Sex gehabt hatte, war eine Afroamerikanerin gewesen. Es war fünfundzwanzig Jahre her und noch nicht einmal wert, eine Episode genannt zu werden. Fand er.
Ihr Koffer lag auf diesem bequemen Bett, es war alles drin. Sie beeilte sich. Aus irgend einem Grunde wollte sie zu ihm. Nicht, weil sie immer noch glaubte, ein Geheimnis entdecken zu können, nicht, weil sie sich schuldig fühlte. Nicht, weil sie sich schämte und meinte, etwas gut machen zu müssen. Sie wollte zu ihm, weil sie seine Nähe angenehm fand.
Er hatte diese deutschen Brötchen besorgt, die so gut schmeckten, hatte Eier gekocht, Saft bereitgestellt und Kaffee, Käse, Aufschnitt, hatte dekoriert; beschämt nahm sie Platz.
„Ich …“ Er unterbrach sie.
„Nicht schon wieder.“ Er lächelte sie an und sah ein fragendes Gesicht.
„Was?“
„Nicht schon wieder entschuldigen. Bitte.“ Sie nickte zaghaft zu seiner Bitte, allerdings gegen ihre Überzeugung.
„Ich möchte Ihre Familie kennenlernen.“, sagte er. „Erzählen Sie von Ihrer Familie.“
„Sie wollen nach all dem meine Familie kennenlernen?“, fragte sie entgeistert.
„Gewiss.“, ermunterte er sie.
Musste sie das verstehen? Nein, natürlich konnte sie das nicht verstehen. Sie konnte nicht wissen, dass der Mann, den sie gestern angegriffen hatte, ein planvolles Vorgehen beschlossen hatte. Montanus wollte mehr über Sarahs Nachkommen erfahren. Vielleicht wollte er sie sogar kennenlernen. Auf jeden Fall wollte er aber versuchen, die Kontrolle über einen Prozess zu erhalten, der eine Phase erreicht hatte, in der er ihm gefährlich werden könnte.