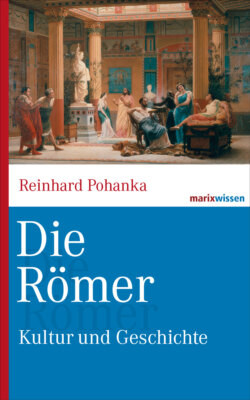Читать книгу Die Römer - Reinhard Pohanka - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Flavier (69–96 n. Chr.)
Titus Flavius Vespasianus stammte aus einer bürgerlichen Familie aus der Gegend des sabinischen Reate; er selbst stand viele Jahre als Offizier und Verwaltungsbeamter im Dienste der Kaiser. Er galt als harte, arbeitsame und sparsame Natur. Als er von den Legionen zum Kaiser ausgerufen wurde, befand er sich im Krieg gegen Iudaea, das 67 n. Chr. einen Aufstand gegen die römische Besatzung unternommen hatte. Als er nach Rom ging, überließ er den Krieg seinem Sohn Titus, der mit großer Härte gegen die Juden vorging. Er eroberte nach wochenlanger Belagerung die Stadt Jerusalem und zerstörte den Tempel Salomons, der letzte jüdische Widerstand wurde 73 n. Chr. mit der Eroberung der Festung von Masada beendet. Die Niederlage der Juden war so vollständig, dass viele danach das Land verließen und sich in verschiedene Teile des Reiches zerstreuten, der Beginn der jüdischen Diaspora. Niedergeschrieben wurden diese Ereignisse in der Geschichte des jüdischen Krieges (Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς Ῥωμαίους) vom jüdischen Geschichtsschreiber Josephus Flavius (37–100 n. Chr). Als Sieger erhielt Titus einen Triumph in Rom und den steinernen Titusbogen am Forum zum Gedenken.
Ein zweiter Aufstand beschäftigte Vespasian in Germanien. Im Rheindelta waren die Bataver 69 n. Chr. unter Iulius Civilis gegen Vitellius aufgestanden und hatten zahlreiche Kastelle am Rhein zerstört. Erst unter Petilius Cerealis, einem General Vespasians, konnten die Bataver wieder befriedet werden.
Vespasian bemühte sich auch um den Ausbau des Reiches, im Norden von Britannien schob er die Grenze bis zum schottischen Hochland vor und in Germanien erreichte er den Oberen Neckar und verband die Donaulinie mit dem Rhein mit einer Straße.
Da die Kassen des Reiches unter Nero geleert worden waren, sparte er wo immer er konnte und ließ sogar die öffentlichen Latrinen in Rom besteuern. Als ihm sein Sohn Titus daraufhin Vorwürfe machte, soll er geantwortet haben: Non olet (Es – das Geld – stinkt nicht1.
In Rom ließ er die Domus Aurea zum Teil abtragen, die 36 m hohe Kolossalstatue Neros wurde in eine Statue des Sonnengottes Sol invictus umgewandelt. Vespasians größtes Vermächtnis ist das Amphitheatrum Flavium, heute als Kolosseum bezeichnet, das er aus der Beute des jüdischen Feldzuges erbauen ließ. Es ist mit einer Grundfläche von 77 x 46 m und einer erhaltenen Höhe von 48 m eines der größten noch bestehenden römischen Bauwerke.
Als er 79 n. Chr. den Tod nahen fühlte, stellte er sich auf die Füße und sagte, imperatorem … stantem mori oportere (dass ein Imperator im Stehen sterben müsse)2.
Er hinterließ seinem ältesten Sohn und Nachfolger Titus Flavius Sabinus Vespasianus (39–81 n. Chr., Kaiser ab 79 n. Chr.) ein geordnetes Reich und dieser war in den zwei kurzen Jahren seiner Regierung amor et deliciae generis humani (Liebe und Wonne des Menschengeschlechts)3, der von sich selbst sagte, dass der Tag verloren sei (diem perdidi … esse), an dem er niemandem eine Wohltat erwiesen hätte4.
In seiner Regierungszeit kam es zu einer der größten Katastrophen, von der wir aus der antiken Welt Nachricht haben. Am 24. August 79 n. Chr. wurden durch einen Ausbruch des Vesuv die Landstädte Pompeii und Herculaneum an einem einzigen Tag völlig zerstört, es sollen dabei mehr als 50 000 Menschen den Tod gefunden haben. Eine Beschreibung der Vorkommnisse findet man bei C. Plinius, dem Neffen des Naturforschers und Kommandanten der kaiserlichen Flotte des westlichen Mittelmeeres. Plinius der Ältere selbst fand bei dem Ereignis den Tod5.
80 n. Chr. weihte Titus das von seinem Vater begonnene Kolosseum mit hunderttägigen Spielen ein und stiftete für die Bevölkerung die Thermae Titianae. Als er im dritten Jahr seiner Regierung mit nur 42 Jahren starb, trauerte ganz Rom um ihn.
Gänzlich anders geartet war sein Bruder und Nachfolger Titus Flavius Domitianus (51–96 n. Chr., Kaiser ab 81 n. Chr.). Zwar war er ein ausgezeichneter Verwalter des Reiches und kümmerte sich um Gesetze und Rechtsprechung, allerdings hielt er nicht viel von der Regierungsform des Prinzipates wie sie Augustus eingeführt hatte. Dafür ließ er sich mit der lebenslänglichen Zensur ausstatten und setzte danach den Senat nach seinen Wünschen zusammen, wer ihm im Wege stand wurde beseitigt und dessen Vermögen eingezogen. Seine Stütze in der Politik waren die Ritter und das gemeine Volk, die er mit großzügigen Spenden und Spielen auf seine Seite brachte. Der Senatsadel hasste ihn dafür und die Historiker seiner Zeit (wie etwa Tacitus)6, haben kein gutes Haar an ihm gelassen.
In der Außenpolitik ging er den vorsichtigen Weg seines Vaters weiter. In Britannien schob er die Grenze mit General Julius Agricola bis zur Linie Firth of Clyde – Firth of Forth vor, in Germanien besetzte er das Land zwischen Oberrhein und oberer Donau und sicherte es mit einem Wall, Kastellen und Wachtürmen (obergermanisch-rätischer Limes) ab. Das eroberte Land wurde als agri decumates (Zehntland) mit Veteranen besiedelt.
Einen schwierigen Feldzug hatte er gegen den dakischen König Decebalus zu führen, der Dakien (das heutige Rumänien) verlassen und die römische Provinz Moesien angegriffen hatte. Domitian, der selbst am Kriegsschauplatz erschien, konnte keine militärische Entscheidung herbeiführen und musste Decebalus durch die Zahlung von Jahresgeldern zum Abzug bewegen. Einen Aufstand der obergermanischen Legionen konnte er hingegen niederschlagen.
Diese Misserfolge erschütterten seine Stellung im Reich und die Gegnerschaft im Senat lebte wieder auf. Domitian antwortete darauf mit großer Härte und Grausamkeit, er führte die zwischenzeitlich ausgesetzten Majestätsprozesse wieder ein und versuchte die erschöpften Kassen mit Vermögenseinziehungen zu füllen. Als sein Wüten immer unberechenbarer wurde, bildete sich eine von seiner eigenen Gemahlin Domitia Longina geführte Verschwörung, der er am 18. September 96 n. Chr. zum Opfer fiel, damit war das Ende des flavischen Kaiserhauses gekommen.
1 Sueton, Vespasian 23.
2 Sueton, Vespasian 24.
3 Sueton, Titus 1.
4 Sueton, Titus 7.
5 Plinius, Epistulae 6,16.
6 Tacitus, Agricola 2,2.