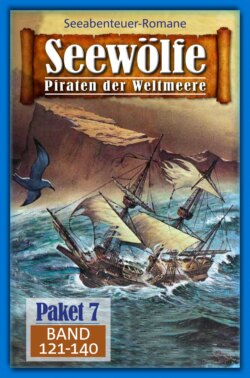Читать книгу Seewölfe Paket 7 - Roy Palmer, Fred McMason - Страница 26
1.
ОглавлениеEiner der bärtigen, eisengepanzerten Eindringlinge hob die Waffe, die die malaiischen Fischer als Feuerrohr zu bezeichnen pflegten. Er stieß mit dem hölzernen Kolben zu, und Otonedju, der Dorfälteste, hatte das furchtbare Gefühl, ein Wasserbüffel oder ein ähnlich großes Tier habe ihn in den Rücken getreten.
Otonedju taumelte aus seiner Hütte. Vier, fünf unstete Schritte weit, dann strauchelte er und stürzte von dem flachen, überdachten Vorbau in den Staub. Obwohl er seine Hände vorstreckte, schlug er hart auf. Ein ächzender Laut der Qual und des Entsetzens löste sich von seinen Lippen.
Die spanischen Soldaten eilten ihm nach. Aus allen Richtungen tauchten sie auf. Sie schienen überall zu sein und alles ihrer Willkür zu unterwerfen. Jeden Funken des Widerstandes brachten sie zum Erlöschen.
Sie umringten Otonedju und schrien auf ihn ein.
„Wo ist der Tiger?“
„Wo hält sich der Hund versteckt?“
„Rede, elender Bastard, oder du bist des Todes!“
Otonedju hörte durch ihr Gebrüll hindurch das Rufen der Frauen, Kinder und alten Leute des Dorfes. Nein, er gab sich keinen Illusionen hin. Die Spanier würden sie bei dem wilden Bestreben, das zu erfahren, was sie wissen wollten, nicht verschonen. Zuerst befragten sie die Männer, die die Spitze des Dorfes darstellten, dann die niedrigeren Chargen aus der Hierarchie der kleinen, fest zusammenhaltenden Gemeinschaft, die Krieger und die Fischer – zuletzt schließlich die Schwachen, Wehrlosen.
Dennoch war Otonedju nicht gewillt, über irgend etwas Auskunft zu geben. Er wußte, was das Ziel der weißgesichtigen, schwarzbärtigen Männer mit den Brustpanzern und Eisenhelmen war. Doch selbst wenn sie ihn über die Ausbeute des Fischfanges der vergangenen Tage hätten aushorchen wollen, so hätte er ihnen kein Sterbenswörtchen darüber verraten. Schweigen war keine Notwendigkeit, sondern eine Tugend, und mit jedem Zugeständnis, das man dem weit überlegenen Gegner gewährte, verlor man einen Teil seiner Manneswürde.
Otonedju fühlte sich von großer Ruhe erfüllt.
Er trachtete davonzukriechen, ein Stück weiter auf den rondellartigen Platz inmitten der Hütten des Inseldorfes zu. Ganz einfach nur, um dem Feind zu beweisen, daß er sich nicht fürchtete und seinen Stolz aufrechterhielt.
Aber ein Fuß zuckte vor, ein Stiefel traf Otonedjus rechte Körperseite, und der alte Mann blieb unter großen Schmerzen liegen.
Otonedju blickte durch wallende Schleier vor seinen Augen zu dem Stiefel. Der schwingende Fuß hatte sich wieder zu dem anderen, zweiten gesellt, und die Stimme, die zu dem Leib über den beiden gehörte, schrie noch einmal: „Rede!“
Otonedju verstand dieses spanische Wort, wenn er auch sonst nur noch ein paar Brocken von dem kannte, was die Männer sagten. Otonedju begriff, denn ihm war von Anfang an klar gewesen, wen diese Männer suchten und was sie vernichten wollten, doch er erwiderte nur ein Wort in seiner Sprache: „Stirb!“
Der Sprecher, ein hochgewachsener und ehrgeiziger Teniente namens Savero de Almenara, schaute auf und wandte den Kopf.
„Der Dolmetscher soll kommen!“ rief er. „Ich glaube, dieser Kerl will sagen, was er weiß. Das würde uns viel Arbeit ersparen.“
Sofort näherte sich der Batak Siabu. Er hatte sich von den Fremden bekehren und überzeugen lassen, trug spanische Kleidung und tat alles, aber auch alles, um den Spaniern untertan zu sein. Otonedju hatte schon vor dem Auftauchen des Trupps von Siabu gehört, und er verachtete ihn aus tiefstem Herzen. Nichts war in Otonedjus Augen fluchwürdiger als das Verhalten eines solchen Überläufers und schäbigen Opportunisten.
Siabu, der sich seines Ansehens bei den Eingeborenen durchaus bewußt war, kniete neben dem alten Mann nieder und sagte: „Also sprich. Erzähl uns, was du über den Tiger weißt, wo er sich aufhält. Wir wissen, daß er ein Versteck auf dieser Insel hat. Du kannst dir und deinem Stamm viel Ärger ersparen, wenn du mitarbeitest, Otonedju.“
Otonedju stemmte sich hoch, drehte sich und setzte sich auf den trockenen Untergrund. Es hatte den Anschein, als sei er geläutert und würde sich nun nicht mehr widerspenstig zeigen wie vorher, aber das war eine Fehldeutung seines Mienenspiels.
„Mitarbeiten?“ wiederholte er in seiner Muttersprache.
„Du wirst es nicht bereuen“, entgegnete Siabu.
„Erkläre mir, um welche Art von Arbeit es sich handelt.“
Siabu glaubte, einen höhnischen Unterton aus den Worten des Dorfältesten zu vernehmen, aber er erwiderte trotzdem: „Das weißt du doch. Wir suchen den Tiger. Du kennst ihn.“
„Ja.“
„Gut. Ist er hier?“
„Ihr habt euch im Dorf umgesehen“, sagte Otonedju. „Ihr seid in unsere Hütten eingedrungen und habt keine Achtung gezeigt, vor keinem von uns. Habt ihr einen Tiger entdeckt?“
„Nein. Er muß sich irgendwo auf der Insel verkrochen haben“, sagte Siabu. „Wo?“
„Ein Tiger ist eine große, gefährliche Bestie mit vier Beinen und gestreiftem Fell“, sagte der alte Mann auffallend ruhig. „Ein solches Tier hat auf dieser Insel nie existiert. Hast du sonst noch Fragen, Verräter, den die Rache der Götter zerreißen wird?“
Siabu fuhr hoch. „Teniente, er hält uns zum Narren!“ schrie er in schlechtem Spanisch. „Und er beschimpft mich!“
„Die Dämonen des Wassers werden eure Schiffe verschlingen“, sagte Otonedju, und er spürte, wie ihn Genugtuung durchströmte. Sie war so groß, daß er sogar seine Schmerzen vergaß.
„Ich bringe dich um!“ brüllte der Batak, immer noch auf spanisch, so daß Otonedju den Wortlaut nicht verstehen konnte.
Das war auch nicht erforderlich. Der Dorfälteste konnte sich denken, was dem Batak vorschwebte, es gehörte keine besonders reiche Phantasie dazu.
„Gut“, erwiderte der Teniente de Almenara in diesem Augenblick. „Ich überlasse den Kerl dir. Du weißt, wie du ihn zum Sprechen bringen kannst. Gibt er nach, läßt du ihn auspacken und erledigst ihn anschließend. Bleibt er störrisch, hältst du dich nicht mehr lange mit ihm auf.“
„Ich danke Ihnen, Teniente“, erwiderte Siabu.
Er zog seinen Parang, ein kurzes, vorn breit auslaufendes und leicht gekrümmtes malaiisches Schwert. Es war das einzige Zeichen seiner eigentlichen Abstammung, mit dem er sich noch versah. Mit dieser Waffe wußte er ausgezeichnet umzugehen.
Otonedju hatte bei früheren Stammesfehden ebenfalls den Parang geführt und sich damit Respekt und Siege verschafft. Auch im Umgang mit dem Kris, dem schlangenförmig gewundenen Dolch, war er gut. Immer noch. Nur hatten ihm die Spanier seinen wertvollen, alten Kris abgenommen, als sie gelandet und in das Dorf eingedrungen waren. Mit vorgehaltenen Feuerwaffen war das keine Schwierigkeit gewesen.
Scheinbar entrückt blickte Otonedju zu der Bucht unterhalb des Dorfes. Dort lagen die Schiffe, von denen aus die spanischen Soldaten übergesetzt waren, drei Dreimaster, dort, unter mildblauem Himmel auf silbrig glitzerndem Wasser. Nicht weit entfernt in seichteren Gefilden ragten die Bambusgestelle aus der See, mit denen sich die Eingeborenen ihren Fang zu sichern pflegten. Dort waren sie noch vor kurzem gewesen, um alles für die Nacht vorzubereiten, dort drüben jenseits des felsigen Ufers und der Landzunge, wo vor einer Stunde noch keiner von ihnen geahnt hatte, daß der Nachmittag das Böse, das vernichtende Unheil bringen würde.
Dann waren die drei Schiffe plötzlich dagewesen, sehr nahe. Sie hatten sich um die Insel herumgeschlichen. Ihre Besatzungen hatten den Bewohnern des Dorfes nicht die Chance gelassen, sich zurückzuziehen. Kein Gedanke etwa daran, Körbe, Gitter und Reusen loszulassen und mit den Booten die Flucht zu ergreifen. Wie schnell hätten die Spanier ihre Beute zu Wasser gestellt.
Ins Dorf hatten sich die Fischer zurückgezogen, und allein dies war in den Augen der Spanier ein halbes Schuldgeständnis.
Der Teniente und die Soldaten wichen etwas zurück. Otonedju schien Siabu willenlos ausgeliefert zu sein.
Aber dann, als keiner mehr damit rechnete – selbst der Batak nicht –, schnellte der alte Mann hoch. Er tat das erstaunlich flink und mit einer Gewandtheit, die man ihm gar nicht mehr zugetraut hätte. Eben das war es, was sich jetzt zu Siabus Nachteil entwickelte. Der Dolmetscher hatte nicht damit gerechnet, von dem Alten angesprungen zu werden.
Otonedju hatte das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Er schoß an der Gestalt des Bataks hoch, seine knochigen Finger packten das Handgelenk und die Hand, die das Heft das Parangs hielt. Ein Ruck, ein Schrei aus Siabus Mund, und Otonedju hatte ihm das scharfe Kurzschwert entrungen.
Die Klinge zuckte durch die Luft. Der Batak reagierte jetzt. Er krümmte sich, verlagerte dabei das Körpergewicht nach hinten und versuchte, dem Bereich des Parangs zu entgehen.
Es gelang nur ansatzweise. Der Parang zeichnete ein rotes Mal in Siabus Gesicht, quer über die Wange. Dann raste er über seine Schulter wie ein Dämon, der brennende Spuren sät.
Brüllend ließ sich der Batak auf den Rücken fallen. Nur so rettete er sein Leben.
Der Teniente hatte seine Miqueletschloß-Pistole gezückt, spannte den Hahn und legte auf Otonedju an. Die Musketen und Arkebusen der Soldaten hoben sich in Zielrichtung auf den alten Mann. Otonedju konnte bereits das tödliche, hohle Auge ihrer Mündungen sehen.
Ein Schrei gellte durch das Dorf. Eine schöne junge Frau hatte ihn ausgestoßen – Otonedjus Tochter.
Otonedju ließ von dem Batak ab, obwohl er ihm, dem Verräter und verhinderten Mörder, gern das Herz durchbohrt hätte. Wieder schimmerte die Klinge in der Luft, dann, ganz unversehens, verließ das Heft des Parangs Otonedjus Hand. Ein Blitz zuckte über den Dorfplatz und traf den ungeschützten Hals eines Soldaten, der gerade mit der Muskete auf den alten Mann abdrükken wollte.
Otonedju duckte sich und stürmte seiner Tochter entgegen, die von zwei Soldaten gehalten wurde.
Der Parang steckte tief im Hals des Musketenschützen, der Mann sank zu Boden. Schüsse krachten. Der Teniente brüllte wie verrückt. Kugeln umzirpten Otonedju, trafen ihn aber nicht.
Otonedjus Tat löste im Dorf eine Kette von Reaktionen aus. Krieger zückten ihre Waffen, die sie vor den Spaniern hatten verbergen können. Aus Verstecken, die die Eindringlinge noch nicht entdeckt hatten, brachen plötzlich die Gestalten junger Männer hervor. Im Nu tobte ein säbelndes, schrilles Inferno.
Otonedjus Tochter riß sich mit der Wildheit eines verzweifelten, in die Enge getriebenen Raubtiers von ihren Bewachern los. Ehe die beiden Soldaten sie wieder packen konnten, hatte der Dorfälteste sie erreicht und warf sich ihnen ohne Waffe entgegen.
Es wäre sein Ende gewesen, hätten nicht zwei junge Krieger in das Handgemenge eingegriffen.
Die Männer, Frauen, Kinder und Greise des kleinen Fischerdorfes brachten es fertig, sich von der Übermacht zu lösen und die Flucht in den Urwald der Insel anzutreten. Sie entwischten den Schüssen, die ihnen nachpeitschten, den Piken und Speeren, die ihnen nachgeschleudert wurden.
Kochend vor Zorn fuchtelte der Teniente Savero de Almenara mit seiner leergeschossenen Pistole in der Luft herum. Für einen Augenblick stand er unschlüssig. Dann wies er auf die leeren Hütten.
„Anzünden“, stieß er keuchend hervor. „Alles niederbrennen!“
Von kristallklarer Bläue war der Himmel über der „Isabella VIII.“. Er schien hier höher als anderswo zu sein, und auf unerklärliche Weise schien man der überirdischen Bestimmung näher zu sein.
„So klar und heiter war die Luft nur in Peking“, sagte Ben Brighton auf dem Achterdeck der großen Galeone. „Dabei befinden wir uns hier in den Tropen.“
Hasards Finger lösten sich von der Five-Rail. Er drehte sich zu seinem ersten Offizier und Bootsmann um. „Du darfst nicht die Jahreszeit vergessen, Ben. Der Frühling beginnt gerade erst, außerdem haben wir Wind aus Nordosten.“
„Ja, vielleicht weht er von Korea und dem Gelben Meer herüber. Alles in allem scheint ein ruhiger Törn vor uns zu liegen, bis wir den Indischen Ozean erreichen.“
Hasard musterte Ben nachdenklich, bevor er antwortete. „Sag mal, glaubst du wirklich, daß die Malakkastraße so friedlich und paradiesisch ist? Bist du allen Ernstes davon überzeugt?“
„Na, Sturm scheint uns jedenfalls nicht bevorzustehen.“
„Davon spreche ich auch nicht.“
Ben kratzte sich am Hinterkopf, wobei sich seine Mütze ein wenig tiefer in die Stirn schob. „Also schön, ich geb’s zu. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wir sind schon in viele paradiesische Gegenden geraten, die sich dann als wahre Hölle entpuppt haben. Am besten sage ich gar nichts mehr.“
Big Old Shane war zu ihnen getreten. „Nach Borneo, nach diesem elenden, von Kopfjägern verseuchten Kalimantan, kann uns so leicht nichts mehr erschüttern.“
Auch Old Donegal Daniel O’Flynn, der gerade aus Richtung Heck anmarschierte und sich erstaunlich geschickt auf seinen Krücken über Deck bewegte, pflichtete dem bei.
„Praktisch bedeutet das, daß wir uns von dem guten Wetter und den feinen Windverhältnissen nicht verblenden lassen dürfen“, sagte er mit säuerlicher Miene. „Hinter jedem Inselchen, auf das wir von jetzt an stoßen, können Kannibalen, Kopfjäger oder irgendwelche Freibeuter lauern. Oder Dons.“
„Meinetwegen, aber hör mit den Kopfjägern auf“, erwiderte Ferris Tucker. „Von denen habe ich gründlich die Nase voll, und ich kriege immer so ein merkwürdiges Jucken am Hals, wenn ihr die Hundesöhne erwähnt.“ Er rieb sich tatsächlich am Hals – was einige Heiterkeit bei den Männern hervorrief.
Keiner von ihnen dachte mit Begeisterung an Kalimantan zurück. Nach dem Abenteuer in Manila, nach mehr als tausend Meilen Törn, nach Stürmen, Kalmen, hundert Entbehrungen hatten sie im März 1585 endlich die große Insel erreicht und sich dort etwas mehr erhofft als nur menschenfeindliche Umgebung und mörderische Gefahren, die im Verborgenen lauerten.
Aber sie hatten die bittere Realität hinnehmen müssen.
Zunächst hatte sich Kalimantan als gänzlich ungeeignet zum Proviant- und Wasserfassen erwiesen. Undurchdringliche Mangrovendikkichte überwucherten die Ufer, dahinter erstreckten sich feuchtheiße Urwälder, scheinbar bis ins Unendliche.
Der Seewolf war mit seiner „Isabella“ weitergesegelt und hatte auf diese Weise das Dorf entdeckt, das zu sehen er sich im nachhinein nie wieder gewünscht hätte. Offensichtlich panikartig waren die eingeborenen Dajaker vor ihnen geflüchtet – und zu spät hatten die Männer der Galeone die Fallen gewittert: getarnte Gruben, Fallnetze, Würgeseile und aus den Palmenwipfeln niederfallende Bambusgitter. Nur mit Mühe hatten sie sich wieder freikämpfen können.
Hasard zuckte mit den Schultern. Warum noch darüber herumgrübeln? Vermeiden ließen sich solche unliebsamen Begegnungen nun einmal nicht, man mußte immer darauf vorbereitet sein. Deswegen war er auch froh, wenn seine Männer ihre gesunde Skepsis beibehielten.
Er stieg auf das Quarterdeck hinunter und suchte das Ruderhaus auf. Hier stand Pete Ballie in Gesellschaft all der Karten, die der Seewolf seit Formosa und den Philippinen an der Rückwand des Decksgebäudes festgepinnt hatte.
Ausgezeichnete Karten waren das. Ohne sie wäre Hasard auf die Straße von Malakka gar nicht aufmerksam geworden. Er warf einen prüfenden Blick auf den Kompaß, nahm seine Hilfsmittel für die Navigation zur Hand und stellte noch einmal die Position fest. Dann verglich er die Position mit dem Kurs, den er auf den Karten abgesteckt hatte. Soweit es die Berechnung der Route und deren Einhaltung betraf, verlief alles genau nach Plan.
Eine der Karten hatte Hasard von Sun Lo, dem Mönch von Formosa, als Geschenk erhalten. Die anderen hatten ihm die Spanier in Manila „ausgehändigt“, höchst unfreiwillig allerdings. Sie mußten noch immer eine Höllenwut auf ihn haben, und sie würden alles daransetzen, ihn wieder zu stellen.
Vorläufig allerdings hatten sie den Anschluß verloren. Die Spur der „Isabella“ verschwand für die Verfolger irgendwo zwischen den Sunda-Inseln. Die Chance, daß sie ihn wiederfanden, war äußerst gering. Genausogut konnten sie nach der bekannten Nadel im Heuhaufen suchen.
Hasard hätte sie herausfordern oder ihnen irgendwo eine Falle stellen können. Aber er war nicht scharf darauf, die Kriegsschiff-Verbände von Manila wiederzutreffen. Früher oder später würden sich die Dons ohnehin wieder präsentieren, wenn auch mit anderen Schiffen, in Form anderer Gesichter, anderer Taktiken und Hinterhältigkeiten – er rechnete damit, sie noch vor dem Erreichen des Indischen Meeres wiederzusehen.
Ohne die Karten, soviel stand fest, hätte Hasard sich statt durch die Malakkastraße eher durch jene Passage getastet, die zwischen den Inseln Sumatra und Java lag.
„Na ja“, sagte der Seewolf. „So ein großer Umweg wäre das eigentlich auch nicht gewesen, Pete.“
„Was denn, Sir?“
„Die Selat Sunda. Die Sunda-Straße.“
„Bestimmt nicht.“
„Dann frage ich mich, welchen Vorteil wir jetzt gewinnen.“
Pete stülpte die Unterlippe vor und blickte voraus. „Wahrscheinlich ist es der bequemere Törn. Und das ist doch sehr wichtig für uns.“
„Möglich, daß wir auch um ein paar Erfahrungen reicher werden, die uns die Sunda-Straße nicht bietet.“
Old O’Flynn war Hasard nachgestakt, er schaute zum Ruderhaus herein und grinste.
„Du hast ja auch einen ganz schönen Sarkasmus am Leib“, meinte er.
Hasard begegnete seinem Blick. „Mußt du denn immer alles negativ auslegen?“
„Du kennst mich doch.“
Hasard lachte. „Donegal, du bist wirklich unverbesserlich. So wie du die Dinge siehst, erreichen wir Old England sowieso nie wieder, oder?“
„Nun fang du nicht auch noch an“, entgegnete der knorrige Alte wider Erwarten. „So ein Miesmacher bin ich ja nun auch wieder nicht. Wenn wir nicht auf Grund laufen, von einem Sturm zerschmettert werden, ersaufen, an einer Seuche krepieren oder von den Dons massakriert werden – dann laufen wir garantiert heil und unversehrt die Heimat an.“
„Aha. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir die Spanier unterwegs wieder um einige ihrer Reichtümer erleichtern? Wäre das nicht nach deinem Geschmack?“ erkundigte sich der Seewolf.
„Klar“, erwiderte O’Flynn. Dann pochte er jedoch mit einer seiner Krücken auf die Decksplanken. „Nur einen Haken hat die Sache. Wir liegen schon zu tief. Unsere Lady hat ihren Bauch schwer vollgeladen und geht mit einem Riesenschatz schwanger. Wenn du noch mehr dazulädst, säuft sie glatt ab und überläßt uns den Haien zum Fraß.“
Sie grinsten sich an, und auch Pete Ballie fing an zu lachen. Die Stimmung an Bord war ausgezeichnet, und das war die wichtigste Voraussetzung für ein harmonisches Leben auf See, wenn alles ruhig verlief und Langeweile sich einzustellen drohte. Stürme und Kämpfe schmiedeten die Männer so fest zusammen wie nie, aber wenn allzu lange Stille und Müßiggang herrschten, wurde die Crew leicht mürrisch. Dann war es gut, zu flachsen und zu unken und von Dear Old England zu reden, als läge sie nicht Tausende von Meilen entfernt, sondern gleich hinter der nächsten Ecke.
Carberry, seines Zeichens Profos und unumschränkter Herrscher über die Kuhl, hatte seine ureigene Art, den Gegebenheiten zu begegnen. Wenn so ein „Schlabbertörn“ gefahren wurde wie heute, ließ er entweder die „Isabella“ von vorn bis achtern aufklaren, brüllte die Crew an, daß die Schotten aus ihren Fassungen zu fallen drohten, brachte Sir John, dem karmesinroten Aracanga, neue Unanständigkeiten bei oder gab seine ewigen Kalauer zum besten.
Hätte man ihn wegen dieser allenthalben bekannten Geschichten als schrullig bezeichnet, wäre er sofort explodiert. Keiner sollte es sich einfallen lassen, Edwin Carberry, den Zuchtmeister und Hüter der Borddisziplin, zu kritisieren oder gar zu beleidigen. Die Bande hatte zu kuschen und ergebenst zu lauschen, wenn Carberry sein Seemannsgarn spann.
So dachte er jedenfalls.
Dem Äquator waren sie jetzt wieder nahe, wie Carberry nach eingehendem Studium der Karten im Ruderhaus festgestellt hatte. Obwohl der Monatserste verstrichen war, konnte man durchaus noch jemanden in den April schicken. Zweifacher Anlaß für den Profos also, nach einem willfährigen Opfer Ausschau zu halten.
Carberry schritt nicht, er stapfte über Deck. Sein Blick verharrte auf Bill. Der Schiffsjunge schickte sich gerade an, in den Großmars aufzuentern. Dort sollte er den Ausguck Bob Grey ablösen.
Carberry stoppte den Moses.
„He!“ rief er. „Bill, komm mal her, Söhnchen!“ Er blieb mit gegrätschten Beinen stehen und glich die Schiffsbewegungen aus. Als Bill, der schon nach den Luvhauptwanten gegriffen hatte, sich jetzt umdrehte und anmarschierte, setzte Carberry seine bedeutungsvollste Miene auf und sagte: „Hör zu, halte nach den Wegweisern Ausschau, die uns die Richtung zum Äquator zeigen, verstanden?“
„Mister Carberry“, erhob Bill einen schwachen Einwand.
Der Profos ließ sich nicht bremsen. „Wir sind jetzt nahe dran, und du kriegst was hinter die Löffel, Söhnchen, falls du die Hinweisschilder verpennst, die überall in der See aufgestellt sind“, fuhr er fort.
Bill nahm seinen ganzen Mut zusammen. „Mister Carberry, ich habe meine Äquatortaufe schon hinter mir.“
„Wie? Was? Als ob ich das nicht wüßte. Halt den Mund und rede nur, wenn du gefragt wirst.“ Carberry holte zu einem schwungvollen Vortrag über den Zaun aus, durch den der Verlauf des Äquators rund um die Erde gekennzeichnet war, über das Gatter, das hier ganz aus Bambusrohr gearbeitet war und das man erst durchbrechen mußte, um auf die andere Seite zu gelangen.
Aber Bill holte ganz tief Luft und rief: „Also nein, bei allem Respekt, auf die Geschichten falle ich nicht mehr herein. Tut mir leid, Mister Carberry. Bitte mich abmelden zu dürfen.“
Der Profos war richtig erschüttert. Eine Weile stand er finster schweigend da, und Bill befürchtete schon das Schlimmste. Dann sagte Carberry aber nur: „Also gut, hau ab, mein Sohn.“
Bill kehrte zu den Luvwanten zurück und kletterte in den Webeleinen hoch, froh, einem brüllenden Donnerwetter des Profos’ entgangen zu sein.
Sir John ließ sich auf der Profosschulter nieder, aber sein Herr scheuchte ihn weg.
„Verschwinde, du Schnarchhahn“, fuhr er den bunten Vogel an. „Sieh zu, daß du Land gewinnst.“ Wirklich, um Carberrys Stimmung war es jetzt nicht mehr zum besten bestellt.
Er trat zu dem jungen Dan O’Flynn, der sich gerade auf dem Rand der Kuhlgräting niedergelassen hatte.
„Jetzt wird der Bengel auch schon frech“, sagte Carberry verdrossen. „Das hat er von dir gelernt. Seit du nur noch selten als Ausguck oben im Mars hockst, läßt die Disziplin zu wünschen übrig. Eines Tages stauche ich euch Kakerlaken alle zusammen, daß euch Hören und Sehen vergeht.“
Dan hatte den Dialog zwischen Carberry und dem Schiffsjungen natürlich verfolgt. Ihm lag schon eine spöttische Erwiderung auf der Zunge, aber dann sagte er sich, daß man’s nicht übertreiben solle.
„Ed“, entgegnete er daher beinah sanft. „Laß doch. Bill ist dabei, sich zum vollwertigen Decksmann zu mausern. Gerade du hast ihn doch sonst immer unter deine schützenden Fittiche genommen.“
„Meine was? Der Teufel soll den Burschen holen.“
„Na ja. Jedenfalls mußt du verstehen, daß Bill an deine haarsträubenden Schauermärchen nicht mehr glauben will.“
Der Profos wollte einen lauten Fluch loslassen, aber Dan redete weiter, ehe er dazu kam: „Außerdem – wir berühren den Äquator sowieso nicht. Es erübrigt sich also, davon zu sprechen. Wir segeln knapp nördlich an ihm vorbei, bevor wir durch die Straße von Malakka stoßen. Erst später, in der Indischen See, werden wir ihn wohl überqueren.“
„O’Flynn, du Schlauberger“, sagte der Profos. „Du hältst dich wohl für oberklug, was, wie?“
Sie hätten sich jetzt doch gestritten, wenn sich Bill, der Bob abgelöst hatte, nicht aus dem Großmars gemeldet hätte. Klar drang seine Stimme aufs Deck hinunter.
„Land in Sicht! Steuerbord voraus!“