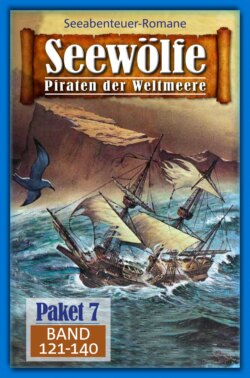Читать книгу Seewölfe Paket 7 - Roy Palmer, Fred McMason - Страница 37
2.
ОглавлениеIn dieser warmen Mainacht 1585 drang ein spanischer Schiffsverband von Norden her tief in die Malakkastraße ein. Aus einer 300-Tonnen-Galeone mit dem Namen „Santa Trinidad“ sowie zwei leichteren, jedoch gut armierten Kriegskaravellen bestand dieser kleine Verband, und er wurde von dem Kommandanten Francisco Lozano der Dreimast-Karavelle „San Rafael“ befehligt, dessen Order sich der Kapitän der Zweimast-Karavelle „Estremadura“, Raoul Souto Alonso, und der Kapitän der „Santa Trinidad“, Rafael de Cubas, zu unterwerfen hatten.
Vor zwei Nächten waren die drei Schiffe in Ban Na Kah am Isthmus von Kra ankerauf gegangen, und den Berechnungen des Comandante Francisco Lozano zufolge hätten sie eigentlich bereits am Nachmittag dieses heutigen Tages die spanische Niederlassung Bengkalis erreichen müssen. Doch der wechselhafte, ständig umspringende Wind bei der Überfahrt und ein kurzer, jäh über die Andamanensee fegender Sturm hatten Lozano einen dicken Strich durch die Rechnung gezogen.
Er konnte noch froh sein, nur die Verzögerung in Kauf nehmen zu müssen. Es hätte schlimmer kommen können – was wäre gewesen, wenn die „Santa Trinidad“ in Havarie geraten wäre, was, wenn sie im Sturm den Kontakt mit ihrem Geleitschutz verloren hätte und möglicherweise Piraten in die Hände geraten wäre?
Lozano grauste es, wenn er nur daran dachte. Im Grunde genommen durfte er zufrieden sein. Bengkalis war fast erreicht und die kostbare Fracht der „Santa Trinidad“ somit nahezu vor allen Unbilden der Natur und menschlichen Hinterhältigkeiten bewahrt.
Der Verlust dessen, was in den Frachträumen der „Santa Trinidad“ ruhte und ihr ansehnlichen Tiefgang verschaffte, hätte sehr ernste Konsequenzen für den Kommandanten nach sich gezogen. Man hätte ihn nicht nur degradiert, sondern mit größter Wahrscheinlichkeit auch vor ein Gericht gestellt. Seine unrühmliche Rückkehr ins Mutterland wäre unabwendbar gewesen.
Die „San Rafael“, ein wendiges Schiff mit Lateinersegeln wie die „Estremadura“ und wie diese ein guter Am-Wind-Segler, führte den Verband und geleitete ihn auf die Einfahrt der langgestreckten Bengkalis-Bucht zu. Die Pulau Rupat, die Insel Rupat, Sumatra im Nordosten vorgelagert, lag bereits achteraus. Bald mußte jene Passage erreicht sein, die zwischen Sumatra und der Insel Bengkalis hindurch auf den nördlichen Einlaß der großen Bucht zu verlief.
Auf dem Achterdeck der „San Rafael“ trat der etwas untersetzte Comandante mit dem gewellten Haupthaar und dem sorgfältig gestutzten Knebelbart zu dem Steuermann, der sich hinter dem Rudergänger postiert hatte und ihm immer wieder Kurskorrekturen angab.
„Wir laufen Bengkalis ohne Aufenthalt an“, sagte Francisco Lozano. „Wenn nötig, werden wir die Wassertiefe ausloten.“
„Comandante …“
„Ich weiß, was Sie sagen wollen, Timonero. Wir haben den Wind aus OstNord-Ost. Wir müssen sehr hoch darangehen, um die Buchteinfahrt bis zum Hafen Bengkalis durchsegeln zu können. Aber glauben Sie mir, die Passage ist breit genug, auch bei Nacht.“
„Trotzdem ist es ein Wagnis.“
„Das Mondlicht reicht aus, uns den rechten Weg zu weisen, Timonero.“
„Im westlichen Bereich der Bucht befinden sich tückische Korallenriffe“, erwiderte der Steuermann. „Ich fahre diese Strecke nicht zum erstenmal.“
„Ich auch nicht!“
„Es ist meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, daß wir durch den Wind auf die Korallenbänke gedrückt werden könnten.“
„Danke, das reicht“, entgegnete Francisco Lozano scharf. „Weitere Ausführungen können Sie sich ersparen, Senor. Ich führe das Kommando, und ich lasse mir nicht gern aufschwatzen, was ich zu tun oder zu lassen habe.“
Die Augen des Steuermannes verengten sich ein wenig, aber er gab sich Mühe, so freundlich wie irgend möglich zu bleiben. „Comandante, das lag auch nicht in meiner Absicht …“
„Dann halten Sie den Mund“, fuhr Lozano ihn an. „Ich trage die Verantwortung, nicht Sie. Haben Sie vergessen, was wir durch eine von Piraten verseuchte Gegend transportieren? Ich habe in Ban Na Kha stundenlang gedrängt, man solle mir mehr Kriegsschiffe zur Verfügung stellen, damit eine ausreichende Sicherung der Galeone gewährleistet sei. Spanien könne mit seinen Schiffen keine Verschwendung treiben, hat mir der hochverehrte Generalkapitän geantwortet, der dort den Ton angibt und für die Verladung der Ausbeute aus den Minen sorgt. Was hätten Sie dem entgegengehalten, Timonero?“
Der Steuermann schwieg, er hatte weder Lust, sich die Rechtfertigungen des Kommandanten anzuhören, noch dasVerlangen, sich auf größere Diskussionen einzulassen. Lozano war ein hitziger, streitsüchtiger Mensch, der seine Position rücksichtslos ausnutzte.
„So müssen wir uns also mit zwei lächerlichen Karavellen zufriedengeben!“ rief der Kommandant anklagend aus. „Falls wir dem gefürchteten Tiger von Malakka und seiner Horde begegnen, haben wir wenig Chancen, die Nacht zu überleben. Dieser hartgesottene, mit allen Wassern gewaschene Pirat und Schlagetot soll ein ganzes Dutzend Schiffe zur Verfügung haben, mit denen er immer wieder unsere Konvois angreift und spanische Siedlungen überfällt.“
Der Timonero konnte sich jetzt doch nicht verkneifen, zu entgegnen: „Das ist mir bekannt. Der Kerl stammt von der Landenge von Kra. Einmal, unter anderem Kommando auf einem anderen Schiff, habe ich das zweifelhafte Vergnügen gehabt, an einer Jagd auf seine Prahos teilzunehmen. Fast hätte er den Spieß umgedreht und uns arg in die Klemme gebracht. Dann aber verschwanden seine Schiffe irgendwo zwischen den Inseln. Die Ortskenntnis und die seemännischen Fähigkeiten dieses Tigers sind phänomenal, das versichere ich Ihnen, Comandante.“
„Schon gut, schon gut“, wehrte Lozano ab. „Ich habe jetzt anderes im Sinn, als die Taten dieses Halunken aneinanderzureihen. Fest steht jedenfalls, daß wir ein ungeheures Risiko eingehen, wenn wir Station einlegen, etwa eine geschützte Bucht suchen und dort bis zum Morgengrauen vor Anker gehen. Es braucht uns nur ein Späher der malaiischen Bastarde zu bemerken, dann sind wir geliefert und sitzen in der Falle.“
„Der Schatz muß nach Bengkalis“, erwiderte der Steuermann, der sich von dem im Bauch der „Santa Trinidad“ verstreuten Reichtum viel lieber selbst einen kleinen Anteil eingesteckt hätte.
„Recht so, Timonero“, sagte Lozano. „Sie begreifen jetzt also doch, wie richtig meine Entscheidung ist.“
Der Steuermann äußerte sich nicht zu dieser Bemerkung, er wußte, daß man sich mehr schlecht als recht durch die Bucht tasten würde. Aber wenn der Kommandant es so brandeilig hatte — bitte.
Wertvoll und daher hochbrisant war die Fracht der „Santa Trinidad“ allemal, das mußte jeder Mann an, Bord der drei Schiffe eingestehen. Erst vor kurzem war es den Spaniern gelungen, auf dem Isthmus von Kra die Minen zu entdecken, die von den Eingeborenen als Geheimnis gehütet wurden. Jetzt waren die Malaien zu Sklaven der neuen Herrscher herabgewürdigt worden und mußten unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Minen arbeiten, um Steinchen um Steinchen aus dem rauhen Erdreich zu lösen.
Diamanten!
Hunderte – nein, Tausende davon lagen in den Truhen und Kisten, die die „Santa Trinidad“ beförderte. Wie groß der Wert dieser einzigen Schiffsladung hochkarätiger Edelsteine war, vermochte vorerst keiner zu ermessen. Erst viel, viel später würden die Beamten der Casa de Contratación das Meer glitzernder „Tränen der Götter“ durchwühlen, Listen anfertigen und Schätzungen anstellen.
Bis dahin war noch ein weiter Weg. Von Bengkalis aus mußten die Diamanten innerhalb der nächsten Tage unter strenger Aufsicht weiterverschifft werden, nach Manila, wo alle asiatischen Kostbarkeiten bis zur nächsten Reise der legendären „Nao de China“ gehäuft wurden. Mit der Manila-Galeone würde der Schatz nach Acapulco hinübertransportiert werden, dann auf dem Landweg nach Vera Cruz, von dort aus nach Havanna hinüber, wo die großen Geleitzüge, die Konvois dickbäuchiger Galeonen, zusammengestellt und nach Spanien auf Reise gesandt wurden.
Der Timonero befand im stillen, daß es bei allem Wert der Ladung doch besser gewesen wäre, die Bucht bei Tageslicht zu durchsegeln. In diesem Punkt ließ er sich nicht beirren. Aber selbstverständlich fügte er sich der Willkür von Francisco Lozano. Anderenfalls wäre er vielleicht noch als Meuterer bezeichnet worden.
Die Kapitäne Rafael de Cubas und Raoul Souto Alonso schienen keine Einwände gegen das Unternehmen zu haben, sonst hätten sie mit den Hecklaternen ihrer Schiffe herübersignalisiert.
So komme denn, was will, dachte der Steuermann gottergeben.
Leise, eigentümliche Musik, von den Europäern unbekannten Instrumenten erzeugt, wurde vom Wind gegen die Hänge Rempangs gedrückt, die Höhen hinaufgetragen und verlor sich irgendwo wieder im Regenwald, der alles schluckte. Mädchen aus Otonedjus Stamm und aus den Reihen der Seenomaden tanzten mit Seewölfen und malaiischen Freibeutern um die zuckenden Feuer, es wurde gescherzt, gegessen, getrunken, ohne daß einer der Beteiligten auch nur einen Augenblick über das Maß hinausging, das die Ausgelassenheit erreichen durfte.
Hasard hatte sich mit dem Tiger, Yaira, Otonedju und einigen anderen Malaien an einem der Feuer niedergelassen.
Am Rand der Lichtung erhob sich jetzt ein aus starken Baumästen und Rohr gezimmerter Käfig, in dem der Tiger Bulbas schlummerte. Ferris Tucker hatte bei der Herstellung des Gitterbaues tatkräfig mitgeholfen.
Hin und wieder blickten die Männer zu dem Käfig hinüber, aber noch gaben die dort postierten Wachen kein Zeichen, noch regte die große Raubkatze sich nicht und bestand kein Anlaß zur Besorgnis. Ließ die Wirkung des Betäubungsmittels nach, würde der Tiger sich erheben und im Nachlassen seiner Benommenheit gewiß den ersten Ausbruchsversuch unternehmen. Dann mußte sich zeigen, ob der Käfig seiner Wut standhielt.
Hasard schaute den Mann an, der seinen Beinamen von Bulbas’ Rassenbezeichnung ableitete. „Wie lautet dein wirklicher Name? Jetzt kannst du ihn mir verraten.“
„Sotoro. Und deiner?“
„Philip Hasard Killigrew.“
Sotoro lachte auf. „Dreimal so lang wie der meine. Bist du etwa adliger Abstammung?“
„Wenn man es genau nimmt, ja. Aber meine Feinde nennen mich gern einen Bastard, wobei sie sich auf gewisse Tatsachen berufen.“ Hasard setzte dem Tiger auseinander, warum das so war.
Sotoro nickte ernst und nahm nach dem Seewolf einen Becher mit Reiswein aus den Bordbeständen der Prahos entgegen, der von Yaira aus einem Krug eingeschenkt wurde.
Sotoro nahm einen Schluck zu sich, setzte den Becher dann wieder ab und entgegnete: „Ich bin als Sohn eines malaiischen Reisbauern und einer Inderin auf der Halbinsel Kra zur Welt gekommen. Aber ich will mich kurz fassen, was meine Kindheit betrifft.“ Sein Mund verzog sich zu einem Ausdruck der Bitterkeit und des tiefen Hasses. „Bei einem Überfall auf mein Dorf wurden meine Eltern von Spaniern getötet. Man verschleppte mich an Bord eines spanischen Seglers, wo ich als Aufklarer und Decksjunge die niedrigsten Arbeiten verrichten mußte. Ich wurde wegen meiner Herkunft und Hautfarbe verhöhnt, getreten und geschlagen. Aber ich lernte die spanische Sprache, ein paar Brocken Englisch und die Kunst, ein Segelschiff sicher übers Meer zu lenken. Später bin ich auf und davon, habe mich zu den Freibeutern von Malakka durchgeschlagen und wurde einer der ihren. Nach verschiedenen Machtkämpfen, Verrat und Intrigen bin ich der geworden, den die Spanier zu respektieren gelernt haben.“
„Der Tiger von Malakka“, murmelte Hasard. „Als Rebell hast du es dir nun zum Ziel gesetzt, Malakka, Sumatra und die übrigen Teile Inselindiens nach und nach von allen Fremdländern freizufegen.“
„Nur von den Besatzern“, stellte Sotoro richtig. „Für weiße Freunde wie dich und deine Männer ist in unserer künftigen Republik immer Platz.“
„Eine gerechtere Art, die Geschikke eines Volkes zu leiten“, sagte Hasard. „Das sind hochgesteckte Ziele, aber Rempang könnte ein echter Anfang sein. Nur darfst du den Gegner nicht unterschätzen.“
„Tue ich das?“
„Ich habe den Eindruck, die Spanier haben ein regelrechtes Kesseltreiben begonnen, dem du früher oder später zum Opfer fallen mußt“, erwiderte der Seewolf gedämpft. „Übersetze das weder Yaira noch jemand anderem, behalte es für dich. Der Überfall auf Otonedjus Insel, die Vertreibung der Seenomaden – es sind die ersten Zeichen, daß etwas Einschneidendes im Gang ist.“
„Das ist mir durchaus klar. Was du nicht weißt: In Bengkalis nutzt ein elender Verräter jede Gelegenheit aus, die Spanier gegen mich aufzuhetzen und ihnen Hinweise zu liefern, wie sie mich stellen könnten.“
„Siabu? Der ist tot.“
„Nein, nicht der Batak. Es handelt sich um einen Atjeh aus dem Norden Sumatras. Sein Name ist Uwak. Früher hat er zu uns gehört, aber dann ist er zu den Spaniern übergelaufen. Wegen Geldes ist er zum Abtrünnigen geworden, sie haben ihn gekauft wie Siabu. Wir mußten daraufhin unser Versteck wechseln, denn auch das hat er seinen neuen Herren natürlich sofort verraten.“
„Ich verstehe jetzt, warum du so unendlich mißtrauisch bist“, erwiderte der Seewolf. „Tausend Tücken und Intrigen, Repressalien und Verrat durch Männer aus den eigenen Reihen – so was zermürbt und kann einen Mann innerlich zerbrechen. Wie kannst du trotzdem ein so großer Idealist sein?“
„Weil die Zahl derer, die für mich den Tod riskieren, größer ist als die Zahl der räudigen Hunde, die es nur verdienen, für alle Zeiten von uns ausgestoßen zu werden. Man muß die Spreu vom Weizen trennen.“
Diese Sätze klangen vielleicht etwas zu markig, aber Hasard wußte ihnen den richtigen Stellenwert zu verleihen. Er konnte nicht umhin, Sotoro zu bewundern, denn nach allem, was er bisher erfahren und von ihm gesehen hatte, schienen die Ziele dieses Mannes völlig uneigennützig zu sein. Der Tiger war weniger darauf aus, sich durch blitzschnelle Raids gegen die Spanier zu bereichern, als vielmehr ihren Machteinfluß in und um Malakka zu schmälern.
„Uwak hat dem Kommandanten Escribano den Tip gegeben, Otonedjus Insel anzulaufen und nach dir und deinen Männern abzukämmen“, sagte Hasard.
„Ja.“
„Uwak wußte also, daß Otonedju zu euch Rebellen hält?“
„Ja. Er nahm richtig an, daß wir wieder auf der Insel landen würden“, antwortete der Malaie. „Erst jetzt wird mir richtig klar, welchen Dienst du uns erwiesen hast, indem du die drei Kriegsschiffe der Spanier versenkt hast. Sie sind ja tatsächlich gesunken, und damit hast du den Spaniern einen empfindlichen Hieb versetzt.“
Hasard lächelte. „Die Dons werden mich deswegen noch inniger verehren. Ich habe sie mal wieder bis aufs Blut gereizt. Etwas anderes, Sotoro. Welche Rolle spielen die Orang Laut, die Seenomaden?“
„Ich habe ihren Stamm erst durch diese dramatische Begegnung auf Rempang kennengelernt. Sie kommen von einer der kleinen, südöstlich der Pulau Bintan gelegenen Inseln, zu denen wir bislang noch keinen Kontakt hatten. Übrigens habe ich von ihrem Häuptling Kutabaru erfahren, daß sie von Escribanos Verband aufgescheucht wurden, bevor dieser Otonedjus Insel heimsuchte. Im Gegensatz zu Otonedju und dessen Leuten gelang den Nomaden jedoch die Flucht. Nur ein paar Krieger fielen dem Angriff der Spanier zum Opfer.“
„Weiß Kutabaru, weshalb dies geschah?“
„Ich habe ihm auseinandergesetzt, warum die Spanier überall nach mir suchen. Ich glaube, ich kann die Orang Laut, die von Insel zu Insel ziehen, für meine Sache gewinnen.“ Er hob die Hände leicht an und ballte sie. „Und ich werde Uwak, diesen Hund, töten, dann sind wir wieder beweglicher, weil die Spanier allein nicht alle Verstecke kennen können, in denen wir immer wieder unterschlüpfen.“
Hasard sagte: „Du willst also nach Bengkalis?“
„Ja. Ich werde dieses Nest überfallen. Und du? Was hast du vor, Seewolf?“
„Eigentlich wollen wir morgen früh aufbrechen und weitersegeln, in den Indischen Ozean. Wir wollen nach England zurückkehren.“ Hasard grinste plötzlich, und in seinen eisblauen Augen tanzten jene tausend Teufel, die bei ihm immer eine kühne Initiative ankündigten.
„Doch ich sehe nicht ein, warum wir nicht mit dir zusammen einen Abstecher nach Bengkalis unternehmen sollten“, sagte er. „Das liegt schließlich auf unserem Kurs, wenn ich nicht irre.“
Er schaute auf, weil der aus Ost-Nord-Ost wehende Wind plötzlich aufgefrischt hatte. Er zerzauste den Männern, Frauen und Kindern auf der Lichtung die Haare, griff nach den Feuern und ließ die Flammen heftig hin- und herlekken.
Der Steuermann der Dreimast-Karavelle „San Rafael“ konnte sich einen Ausdruck der Schadenfreude nicht verkneifen, als der Wind an Stärke gewann und von frisch bis handig auf steif bis stürmisch aufbriste. Der Wind pfiff über die nördliche Einfahrt der Bengkalis-Bucht, in der sich der Dreierverband jetzt befand.
Der Kommandant Francisco Lozano stand zu diesem Zeitpunkt auf. dem Vordeck der Karavelle und konnte nicht sehen, wie sein Timonero heimlich und verschlagen grinste. Lozano hatte einen Decksmann auf die Galionsplattform hinabkommandiert. Der Mann lag bäuchlings schräg unter ihm und hielt Senkblei und Faden bereit, um die Wassertiefe auszuloten, falls der Kommandant es für notwendig erachtete.
Die Galeone „Santa Trinidad“ segelte im Kielwasser der dreimastigen Karavelle, und den Abschluß bildete die „Estremadura“. Hoch am Wind lagen die Schiffe. Aber während die wendigeren Karavellen mit ihren Lateinersegeln kaum Mühe hatten, den Kurs zu halten, mußte der Kapitän Rafael de Cubas an Bord der „Santa Trinidad“ sein ganzes seemännisches Können aufbieten, um mit dem schwerfälligeren Rahsegler den Kurs halten zu können.
Dem Rudergänger am Kolderstock der Galeone lief der Schweiß übers Gesicht — wegen der nervlichen Anspannung und des barschen Kommandierens des Kapitäns und der Offiziere, das pausenlos auf ihn einhagelte. Der Zuchtmeister brüllte die Decksleute an, die Schoten noch dichter zu holen, obwohl das nicht möglich war. Er drohte mit der neunschwänzigen Katze.
Die Stimmung an Bord war alles andere als rosig – und nun auch noch das!
Francisco Lozano konnte froh sein, keine Perücke zur Hebung seiner Amtswürde übergestülpt zu haben. Sie wäre ihm im jähen Aufbrisen des Windes zweifellos vom Haupt gerissen worden.
Seine wellige Frisur löste sich auf, seine Knebelbartenden zitterten im Wind. Sein wütendes Geschrei tönte über Oberdeck und war fast bis zur „Santa Trinidad“ zu hören.
Lozano brüllte, bis er rot anlief, als der Bootsmann auf der Back eintraf und auch noch verkündete: „Das Schiff läuft aus dem Ruder, wenn das so weitergeht! Wir werden auf Legerwall gedrückt und können den Kurs nicht halten, Senor Comandante!“
„Vayase al diablo!“ brüllte Lozano ihm ins Gesicht. „Zum Teufel, ich lasse euch alle kielholen und an der Rahnock aufbaumeln, wenn das passiert!“
„Si, Senor Comandante“, sagte der erbleichende Bootsmann. Er drehte sich um und stürzte an die Querbalustrade, die zur Kuhl wies. Sein Wortschwall ging auf den Stockmeister nieder, und dieser leitete die Anordnungen an den Steuermann weiter.
Der Timonero wußte ganz genau, daß Lozano imstande war, seine wüsten Drohungen in die Tat umzusetzen. Das Grinsen des Timoneros fror ein, er trat dem Rudergänger mit dem Stiefel ins Gesäß, scheuchte ihn weg und übernahm selbst den Kolderstock der „San Rafael“.
„Ich habe das Unheil kommen sehen“, stieß er zischend hervor. „Auf mich hat keiner hören wollen, und jetzt müssen wir die Köpfe dafür hinhalten, Hölle und Teufel.“
Der Wind heulte und pfiff in den Luvwanten und Pardunen der Schiffe und rüttelte an den Masten. Auf Steuerbordbug liegend liefen die drei Segler mit starker Krängung weiter auf Bengkalis zu, dessen Lichter wegen leichter Nebelbildung im Süden noch nicht zu erkennen waren.
Der Wind wurde stärker und ruppiger.
Der Timonero der „San Rafael“ wußte, daß das Schicksal unabwendbar war, und er bekreuzigte sich.
„Wir segeln in die Hölle“, sagte der entsetzte Bootsmann auf der Back, aber Francisco Lozano war an dem Bootsmann vorbei, hastete den Niedergang zur Kuhl hinunter, und beachtete die Worte des Mannes überhaupt nicht.
Lozano tobte, wurde handgreiflich und schlug auf einige Männer ein, aber dadurch änderte er auch nichts an den Gegebenheiten. Immer weiter wurden die Karavellen und die Galeone auf Legerwall zu geschoben. Wenig später war das Unheil perfekt.
Den manövrierfähigeren Karavellen gelang es, so weit nach Süden abzulaufen, daß die gefährlichen Korallenbänke Steuerbord achteraus zurückblieben. Doch die Galeone „Santa Trinidad“ war mittlerweile viel zu weit nach Westen versetzt worden.
Rafael de Cubas brüllte wie ein geistig umschatteter Mann, aber auch das nutzte nichts. Im Moment des Aufpralls aufs Riff wurden er und seine Männer aus dem Stand auf Deck gerissen und durcheinandergeschleudert. Sie überrollten und wälzten sich. Einige schlugen so hart gegen das Schanzkleid oder andere Widerstände, daß sie sich Verletzungen zuzogen. Ja, zwei Decksleute kippten sogar außenbords und verschwanden in der Nacht.
Es krachte und knirschte. Der Rumpf der 300-Tonnen-Galeone wurde von den harten, scharfen Formationen der dicht unter der Wasseroberfläche befindlichen Baum- und Rindenkorallen aufgeschlitzt. Gähnende Lecks klafften plötzlich in der hölzernen Schiffshaut, gurgelnd drangen die Fluten ein.
Der Schiffszimmermann und ein paar Helfer, die sofort in die unteren Räume eilten, wurden durch die rauschenden Wassermassen gestoppt. Obwohl der beherzte Zimmermann ein paar Tauchversuche unternahm, gelangte er an die Lecks nicht heran. Es war ausgeschlossen, die Galeone von innen her auch nur notdürftig abzudichten.
Die Männer kehrten auf Oberdeck zurück und erstatteten Meldung. Panik drohte um sich zu greifen.
Die Galeone krängte bedrohlich und schien jeden Moment querzuschlagen.
„Löscht die Ladung, verstaut sie in den Booten!“ schrie der Capitán de Cubas. „Wir müssen das Schiff aufgeben.“
„Senor Capitán!“ rief der Zimmermann zurück. „Wir müssen das Frachtgut im Stich lassen. Wir schaffen es nicht mehr …“
„Niemals! In die Frachträume!“ Rafael de Cubas’ Stimme steigerte sich zu einem Heulen. „Das ist ein Befehl, und ich werde jeden, der ihn nicht befolgt, wegen Meuterei und Feigheit zur Rechenschaft ziehen!“
Den Männern blieb nichts anderes übrig, sie mußten in die tosende, unheimliche Tiefe des Schiffsrumpfes zurückkehren. Unter Aufbietung all ihren Mutes bildeten sie eine Kette, dessen unterste Glieder in den Frachträumen immer wieder in die schwärzlichen, brodelnden Fluten tauchten und Kisten und Truhen, prall gefüllt mit Diamanten von Kra, heraufzerrten. Der Zimmermann befand sich unter diesen beherzten Männern.
Die Kisten wurden auf Oberdeck gemannt und in die bereits ausgebrachten Beiboote abgefiert, was nicht ohne Schwierigkeiten abging, weil die „Santa Trinidad“ immer weiter nach Steuerbord krängte.
So sehr de Cubas sich auch bis zuletzt dagegen sträubte – ihm blieb schließlich nichts anderes übrig, als sich in ein Boot zu begeben und das sinkende Schiff zu verlassen.
Nur einen Teil des Diamant-Schatzes hatte er bergen können, etwa ein Viertel. Während aber die Beiboote an Steuerbord der Galeone dümpelten, während sich Masten und Rigg bedrohlich den Männern auf den Duchten entgegenneigten, hörten die auf dem Dreimaster Zurückgebliebenen nicht auf, Kisten und Truhen aus dem Schiffsbauch zu mannen.
Die Wassermengen füllten die „Santa Trinidad“ und ließen sie noch mehr nach Steuerbord krängen. Der jaulende Wind tat ein weiteres – die Galeone schlug endgültig quer.
Ein einziger Schrei des Entsetzens ging durch die Reihen der Spanier. Mit wilder Kraft der Verzweiflung pullten sie unter dem niederächzenden Mastwerk, der Takelung und dem laufenden und stehenden Gut fort. Zwei Booten gelang es, sich zu lösen, ein drittes, kleineres, wurde untergegraben. Nur ein Teil seiner Besatzung vermochte sich durch Wegtauchen zu retten.
De Cubas war für Minuten seiner Stimme beraubt. Er ließ in die Bucht hinauspullen, hatte sich auf der Heckducht seines Bootes umgewandt und verfolgte fassungslos die letzte Phase des Unglückes.
Knarrend rutschte die „Santa Trinidad“ vom Riff. Unglaublich schnell vollzog sich das. Man war versucht an einen bösen Traum zu glauben. Die Schatz-Galeone nahm den Großteil der Diamantenausbeute aus den Minen von Kra mit in die Tiefe, außerdem ein paar Männer, die nicht mehr rechtzeitig den Weg aus den unteren Schiffsräumen zurück auf Oberdeck fanden. Unter ihnen war auch der Zimmermann.
Sie ertranken in Gesellschaft des phantastischen, unermeßlichen Juwelenreichtums.
Die Überlebenden pullten zu den wartenden Karavellen. Der Kapitän Rafael de Cubas wußte, daß sein Davonkommen vor dem so nahen Tod kein dauerhafter Trost für den Verlust des Schatzes war. Man würde ihn wie den Kommandanten Francisco Lozano und den Kapitän der „Estremadura“, Raoul Souto Alonso, für das Unglück zur Rechenschaft ziehen.
Ob man die Diamanten vom Grund der Bengkalis-Bucht bergen konnte, hing in erster Linie davon ab, wie tief die „Santa Trinidad“ sank.