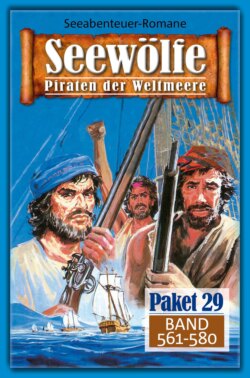Читать книгу Seewölfe Paket 29 - Roy Palmer, Burt Frederick - Страница 41
8.
ОглавлениеPhilip Hasard Killigrew und seine Männer verharrten in dem Olivenhain oberhalb des verwinkelten Gemäuers. Rechtzeitig hatten sie die Laterne gelöscht und waren im Dunkeln weiter vorgedrungen.
Zwischen den Olivenbäumen war es stockfinster, aber das Gebäude, in dem sich die Werkstatt des Höllenfürsten befand, war recht gut zu erkennen. Nach wie vor war der Himmel sternenklar.
Nirgendwo brannte Licht. Und kein Laut war zu hören.
Hasard gewann den Eindruck, daß es sich nicht um ein gegenseitiges Belauern handelte. Dank Öbüls Geständnis ließen sich zwei und zwei leicht zusammenzählen. Der Höllenfürst mußte bereits unterwegs sein, um sein sogenanntes Meisterstück zu vollbringen.
Hasard, Ben Brighton, Dan O’Flynn und Don Juan de Alcazar drangen als erste zum Gebäude vor.
Abermals blieben sie bewegungslos stehen, als sie die Außenwand eines der verwinkelten Trakte erreichten.
Kein Laut war aus dem Haus zu hören.
Der Seewolf stieß einen leisen Pfiff aus – das Zeichen für die anderen. Sie rückten nach und kreisten das Gebäude innerhalb von Sekunden ein.
Mit ihren Entersäbeln hebelten Hasard und Ben Brighton einen Fensterladen auf. Der Seewolf zertrümmerte die Fensterscheibe, öffnete das Fenster und schwang sich hinein. Es war ein Wohnraum, in dem er sich befand. Den Säbel in der Rechten, orientierte er sich rasch und fand den Vordereingang.
Kurz darauf waren alle Fenster und Türen geöffnet. Die Männer entfachten vorhandene Öllampen und verschafften sich einen Überblick.
Hasard zog die Kommode beiseite, die der Beschreibung nach jenes Möbelstück sein mußte, das den Zugang zum Schatz Ayaslis verdeckte.
Der Teil der Fußbodendielen, der eine Luke bildete, war nicht zu übersehen.
Im Halbdunkel erblickten die Männer die gestapelten Beutel aus Leinen und Leder. Batuti hatte eine Schubkarre in einem Lagerraum entdeckt. Sie holten die Beutel mit Gold und Silber aus dem Hohlraum und verluden den Reichtum auf die Karre. Dann sahen sie sich weiter um.
Al Conroy hatte sich in der Werkstatt bereits bestens orientiert.
„Ein teuflisches Genie“, sagte der schwarzhaarige Stückmeister und zeigte dem Seewolf eine Tabelle, die er gefunden hatte. „Luntensorten, Brennzeiten und so weiter. Alles exakt bis ins kleinste Detail festgehalten. Die interessantesten Sachen haben wir aber wohl hier.“ Er wies auf die Versuchsanordnungen, mit denen Ayasli und sein Gehilfe geprüft hatten, in welchen Arten von Hohlräumen und mit wieviel Luftzufuhr Lunten am besten brannten.
Das Pulverlager befand sich in einem Raum neben der Werkstatt, wohlweislich durch eine Doppeltür gesichert.
Ein besonderes Stück fanden die Arwenacks auf einer Werkbank am anderen Ende der Werkstatt.
Eine kleine Truhe, wie man sie für wichtige Dokumente und sonstige persönliche Habseligkeiten verwendete.
Al Conroy überprüfte das Schloß mit dem verbundenen Steinschloßmechanismus und führte die Funktion vor.
Betroffenes Schweigen kehrte ein.
„Zum Kotzen!“ knurrte Carberry in die Stille. „Einfach widerlich, solche Sachen. Was für verdammte, lausige Schurken müssen das sein, die mit so was ihre Gegner aus dem Weg räumen!“
Die Arwenacks nickten beipflichtend.
Ihnen drehte sich fast der Magen um, wenn sie sich vorstellten, wie wehrlose und vor allem völlig ahnungslose Menschen mit solchen Höllenmaschinen ins Jenseits befördert wurden. Die gemeinste und widerwärtigste Art der Auseinandersetzung überhaupt.
Der Seewolf sah sich noch einmal um. „Wenn wir die Bude vernichten, tun wir ein gutes Werk. Oder ist jemand anderer Meinung?“
„Keiner!“ rief Ferris Tucker überzeugt. „Besser würde uns wahrscheinlich gefallen, wenn wir den Höllenfürsten mit in die Luft jagen könnten!“
Beifallsgemurmel wurde laut.
Hasard sorgte mit einer Handbewegung für Ruhe. „Ich will nicht sagen, daß wir uns einfach so zurückziehen. Aber ich schlage vor, daß wir Al freie Hand lassen, damit er sein Meisterwerk vollbringen kann.“
Die Arwenacks stimmten begeistert zu.
Der schwarzhaarige Stückmeister lächelte gerührt. Hasard legte ihm die Hand auf die Schulter. „Einverstanden, Al?“
„Keine Frage.“
„Kriegst du es so hin, daß von dem gesamten Gemäuer nichts mehr übrigbleibt?“
Al grinste und deutete auf die Tür zum Pulverlager. „Mit dem Vorrat da drinnen, könnte ich halb Istanbul in die Luft jagen.“
Seine Gefährten glaubten es ihm unbesehen. Hasard mahnte zum Aufbruch. Sie vereinbarten, sich in fünfhundert Yards Entfernung an einer Gassenkreuzung zu treffen, die sie noch gut in Erinnerung hatten. Batuti übernahm die Schubkarre, und Stenmark ging mit der Laterne voraus.
Der Stückmeister blieb zurück – in seinem Element.
Al öffnete das Pulverlager und begann, Fässer mit Schwarzpulver in die einzelnen Räume des Gemäuers zu tragen. Er verteilte das Pulver so, daß auf jeden Raum etwa gleich große Ladungen entfielen.
In der Werkstatt suchte er Luntenrollen zusammen. In einem Korridor, so ermittelte er, befand sich ungefähr der zentrale Punkt, den alle Lunten von den einzelnen Räumen aus erreichen mußten.
Er wählte die Lunten für die jeweiligen Ladungen sehr sorgfältig aus. Wo die Entfernung bis zum zentralen Punkt etwas größer war, verkürzte er die Brenndauer, indem er eine dünnere Luntenart verwendete.
Schließlich verband er alle Lunten miteinander und verflocht sie mit einem einzelnen Strang, den er so durch die vordere Haustür führte, daß er keine der sternförmig auseinanderlaufenden anderen Lunten berührte.
Er unternahm einen letzten Kontrollgang durch das Gemäuer und überzeugte sich, daß alle Luntenverbindungen in Ordnung waren.
Die nächsten Nachbarn wohnten weit genug entfernt. Sie würden unsanft aus dem Schlaf geweckt und vielleicht ein leichtes Beben ihrer Häuser verspüren. Dafür aber wurden sie von der Hexenküche eines unheimlichen Zeitgenossen befreit.
Vor dem Haus entfachte Al Conroy das Luntenende, indem er zwei Flints aneinanderschlug. Er richtete sich erst auf, als er sicher war, daß die leise zischende Glut in dem Gewebestrang nicht mehr verlöschen würde.
Über den Daumen gepeilt, mußte es eine halbe Stunde dauern, bis die gesamte Bude in die Luft flog.
In leichtem Trab lief Al Conroy hinter seinen Gefährten her.
Nach etwa zehn Minuten traf er sie an der vereinbarten Stelle.
„Wir können weitermarschieren“, beantwortete der Stückmeister die fragenden Blicke der anderen. „Bevor wir den Hafen erreichen, wird es ein paar Leuten in Istanbul die Nachtruhe rauben.“
Sie setzten ihren Weg fort.
Für geraume Zeit waren der Nachhall der eigenen Schritte und das Rollen der Schubkarre die einzigen Geräusche, die sie vernahmen.
Jäh zuckte ein Blitz über das nächtliche Istanbul.
Die Arwenacks verharrten und wandten sich rasch um.
Mit grellem Rot, das sich fast zum Weiß hin färbte, stieg der Blitz am entfernten Stadtrand zum Nachthimmel auf.
Erst im nächsten Sekundenbruchteil folgte das urgewaltige Brüllen der Explosion. Es war, als hätte sich ein Gewitter zu einem einzigen geballten Donner vereinigt, der imstande war, jegliches Leben auszulöschen.
Doch dieser Eindruck trog.
Der Schaden, den die Detonation anrichtete, beschränkte sich auf das Gemäuer des Höllenfürsten.
Deutlich sahen die Arwenacks, wie Trümmerteile in der rot-weißlichen Lohe emporgewirbelt wurden. Nur langsam, unendlich langsam sank der Explosionsblitz in sich zusammen.
Der Seewolf und seine Männer marschierten weiter.
Sie hatten dem Höllenfürsten die Grundlage für sein teuflisches Handwerk entzogen. Das bedeutete aber noch lange nicht, daß er schon völlig am Ende war. Ein Mann von seiner Besessenheit würde immer wieder zu einem neuen Anfang finden.
Und ebenso würden immer wieder Auftraggeber zur Stelle sein, die begierig darauf waren, seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Raffgier und Mißgunst mochten es in erster Linie sein, die in einer Stadt wie Istanbul dazu führten, daß sich Menschen gegenseitig nach dem Leben trachteten.
Deshalb durfte es einen Verbrecher wie den Höllenfürsten, der ihnen seine teuflischen Dienste anbot, nicht geben. Die möglichen Auftraggeber durften gar nicht erst in Versuchung geführt werden.
Süleyman Ayasli war eine Gefahr für das Gemeinwohl in dieser Stadt.
Und wenn man ihm nicht endgültig Einhalt gebot, konnte er mit seinem Fanatismus zu einer Gefahr für alle Bürger werden.
Er fror.
Die Nacht wurde merklich kühl, und etwas ging in seinem Inneren vor, das spürte er. Eine unerklärliche Art plötzlichen Ungehagens war es. Der Gedanke, in das kalte Wasser steigen und schwimmen zu müssen, war alles andere als erbaulich. Aber daran allein konnte es nicht liegen.
Süleyman Ayasli spürte mit allen Fasern seiner Sinne, daß sich etwas zusammenbraute, das gegen ihn gerichtet war.
Ein feindliches Bestreben, das sich gegen seine Macht wendete. Dabei hatte er sein Ziel nahezu erreicht – Herrscher über Leben und Tod zu sein. In Istanbul. Und bald auch darüber hinaus.
Seine Feinde wollten ihm diese Macht nehmen – diese verfluchten Christenhunde, die so unerwartet aufgetaucht waren und sich in alles einmischten. Was ging sie diese Stadt an? Welche Ansprüche leiteten sie aus der Tatsache ab, daß sie mit ihrem Schiff im Hafen vertäut hatten? Sie mußten größenwahnsinnig sein, daß sie sich solche Überheblichkeit anmaßten.
Aber er dachte nicht im entferntesten daran, etwa schon aufzugeben. Ihn, Süleyman Ayasli, beeindruckte man nicht durch Erfolge, die nur äußerlicher Art waren. Am Ende hatte er immer den längeren und vor allem stärkeren Arm gehabt. Nein, es gab niemanden, der ihm überlegen war.
Mit dieser neugewonnenen Zuversicht begann er, das Floß mit der Unterwasserbombe noch einmal genau zu überprüfen. Längst hatten sich seine Augen an das Mondlicht gewöhnt, so daß er die Einzelheiten fast wie bei Tage erkennen konnte.
Die Pulverladungen waren sicher befestigt, und alle Stellen, an denen möglicherweise Wasser hätte eindringen können, waren sorgsam abgedichtet. Die kleinen Eisendorne, die er an der Oberseite der Pulverkisten befestigt hatte, dienten dem Zweck, die Bombe unter dem Schiffsrumpf zu fixieren.
Mitsamt dem Floß würde er die Pulverladung unter Wasser drücken, am Schiffsrumpf entlang. Mittels der Dorne und der Auftriebskraft des Floßes würde die Bombe dann sicher an der Außenbeplankung des Zweimasters „kleben“. Und das Rohr, das über die Wasseroberfläche hinausragte, sorgte dann für eine ausreichende Luftzufuhr, wie sie für die glimmende Lunte erforderlich war.
Blitz und Donner ließen ihn zusammenzucken, als wäre er von einem furchtbaren Hieb getroffen worden.
Mit flackernden Augen starrte er zwischen den Schiffsmasten hindurch zum fernen Stadtrand, wo das Explosionsfeuer mit wirbelnden Trümmern zum Himmel emporstieß.
Also hatten sie es geschafft, diese Bastarde.
Diese verfluchten Christenhunde hatten ihr Ziel erreicht und ihm alles genommen.
Alles?
Nein. Er zwang sich, klar und nüchtern zu denken. Das Wertvollste hatte er noch immer. Die Kraft und Unüberwindbarkeit seiner Gedanken. Er war ihnen überlegen. Sie würden es schon noch spüren. Jetzt erst recht.
Er öffnete den Deckel des Luntengehäuses und wandte sich so mit dem Rücken zum Hafenbecken, daß die Zündfunken seiner Feuersteine nicht zu sehen waren. Innerhalb von Sekunden brachte er die Lunte zum Glimmen. Vorsichtig versenkte er das Ende in den Behälter, so daß die übrigen Windungen nicht berührt wurden.
Dann schloß er den Deckel und strich die Ränder mit Fett zu, das er in einer kleinen Dose bei sich hatte. Anschließend umhüllte er den Deckel mit zusätzlichem Ölpapier, das er festschnürte. Bei jeder Handbewegung achtete er darauf, das aus dem Luntenbehälter ragende Rohr nicht zu beschädigen.
Es war geschafft.
Langsam und vorsichtig zog er das Floß zum Ufer, direkt neben der trichterförmigen Einmündung zum Dock. Der Wellengang war mäßig, es wehte nur eine schwache Brise. Gefahr, daß die Pulverladung durch Spritzwasser vorzeitig unbrauchbar wurde, bestand also ebenfalls nicht.
Das Floß schwamm einwandfrei.
Ayasli ließ sich ins Wasser gleiten und zwang sich, die Kälte, die seinen Körper umhüllte, zu ignorieren. Er hatte Mühe, die Zähne so fest zusammenzupressen, daß sie nicht klapperten.
Dann schob er das Floß vor sich her und begann, mit kraftvollen Schwimmzügen in das Hafenbecken hinauszugleiten. Auf den Schiffen herrschte Nachtruhe. Die Wachen, die auf den Donner der Explosion aufmerksam geworden waren, starrten sich die Augen aus dem Kopf.
Ihre ganze Aufmerksamkeit galt jenem weit entfernten Punkt, wo der Flammenschein immer mehr in sich zusammensank. Niemand achtete auf die düstere Wasserfläche des Hafenbeckens, wo sich der Tod in seiner teuflischsten Form auf den Zweimaster der Engländer zubewegte.
„Das Fanal der Hölle!“ rief Old Donegal Daniel O’Flynn triumphierend. „Jetzt haben sie ihn beim Wickel, den Lumpenhund!“
„Sei still, Grandpa!“ rief Philip junior vorwurfsvoll. „Plymmie kann sich sonst nicht konzentrieren!“
Smoky und Matt Davies, die eben ihren Rundgang auf der Kuhl unterbrochen hatten, wechselten einen Blick und grinsten.
Old Donegal und der Kutscher hatten sich auf der Back postiert, während die Zwillinge mit der Wolfshündin auf dem Achterdeck Stellung bezogen hatten.
„Hast du so was schon gehört!“ Der alte O’Flynn kicherte. „Seit wann muß ein Hundevieh nachdenken! Ist doch ein Schnüffeltier, oder was sonst, he?“
„Plymmies Gehör spielt eine genauso große Rolle!“ rief Hasard junior empört. „Außerdem ist sie fast so intelligent wie ein Mensch. Der einzige kleine Unterschied ist bloß, daß sie nicht sprechen kann.“
„Hast du Töne!“ schnaufte Old Donegal. „Schnappt nur nicht über mit eurem vierbeinigen Liebling! Entweder er paßt auf, oder er paßt nicht auf. Da können doch ernsthafte Gespräche von Menschen nicht zurückstehen.“
„Das Fanal der Hölle!“ konterte Philip junior unerschrocken. „Was soll denn daran wohl ernsthaft sein?“
„He, he, he!“ schrie der Alte erbost. „Sieht so aus, als ob ich mein Holzbein abschnallen muß! Das möchte ich dir nicht wünschen, Bürschchen!“
Smoky und Matt Davies mußten sich zusammenreißen, um nicht in Gelächter auszubrechen. Auf dem Achterdeck kicherten die Zwillinge leise hinter der hohlen Hand.
„Nun laß es gut sein, Mister O’Flynn“, sagte der Kutscher versöhnlich. „Wie in den meisten Fällen, haben beide Seiten recht. Ich kann den Jungen ohne weiteres bescheinigen, daß ihre Plymmie ein außergewöhnlich intelligentes Wesen ist.“
Old Donegal schnappte nach Luft.
„Und sie muß sich in der Tat konzentrieren“, fuhr der Kutscher fort. „Sicher hat sie einen schärferen Geruchssinn als wir Menschen. Aber wenn sie zu sehr abgelenkt wird …“
Die Erläuterungen des Kutschers wurden zu einem längeren Vortrag über das mögliche und wahrscheinliche Seelenleben von Hunden, die dem Menschen treu ergeben waren. In seiner etwas geschraubt klingenden Art belehrte der Kombüsenmann den Alten darüber, wie man auf Hunde, von denen man außergewöhnliche Dienste erwartete, einzugehen hätte.
Während dieser Rede des Kutschers, der Old Donegal mit offenem Mund zuhörte, spürten die Zwillinge plötzlich, wie sich Plymmies Haltung versteifte.
Die Wolfshündin, die zwischen ihnen stand, spannte die Muskeln. Ein kaum hörbares Grollen drang aus der Tiefe ihrer Kehle, und ihre Nackenhaare sträubten sich unverkennbar. Ihr geduckter Kopf war dem Hafenbecken zugewandt.
Hasard und Philip bemerkten es sofort und wechselten einen Blick.
„Ganz still bleiben, Plymmie“, flüsterte Philip. „Ganz still!“
Sie brauchten keine Worte zu wechseln, um zu wissen, daß sie auf ihrem Platz ausharren mußten.
„Mister Smoky!“ rief Hasard junior im Flüsterton, während der Kutscher redete und redete.
Der Decksälteste hörte es sofort, und er reagierte prächtig, indem er sich nicht umwandte.
„Was gibt’s?“ entgegnete er mit ebenfalls leiser Stimme.
„Plymmie wittert etwas. Wir sollten so tun, als ob wir nichts mitgekriegt haben.“
Smoky und Matt Davies waren mit dem Vorschlag des Seewolf-Sohnes sofort einverstanden. Old Donegal und der Kutscher waren ausreichend in ihr spezielles Thema vertieft, und im übrigen konnte man so tun, als widme man seine ganze Aufmerksamkeit dem Flammenschein über der Stadt. So, wie es auch die Deckswachen auf den übrigen Schiffen taten.