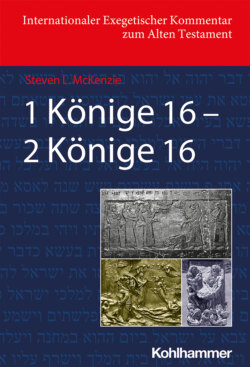Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Rekonstruktion des Textes
ОглавлениеDiese Hinweise auf eine Überarbeitung in der OG schmälern nicht unbedingt den Wert dieser Tradition für die Textkritik, sofern es sich um einzelne Lesarten handelt. Jeder Fall muss für sich betrachtet werden. Häufig führt dies zu Ermessensentscheidungen – vor allem an den Stellen, an denen MT problematisch erscheint. Ist es in diesem Fall die leichtere oder passendere Lesart, wenn OG den ursprünglichen Text bewahrt, der durch MT verändert wurde? Oder geht die Lesart der OG auf eine Glättung des problematischen MT durch eine zweite Hand zurück? Es gibt hier keine pauschalen Regeln. Allgemeine Prinzipien können nur ungefähre Leitlinien liefern, die nicht auf jeden Fall anwendbar sind. Die kürzere Lesart sollte bevorzugt werden, wenn keine andere Erklärung für die Varianten ersichtlich ist. Das Diktum lectio difficilior praeferenda est („die schwierigere Lesart ist vorzuziehen“) muss gegen den Textsinn abgewogen werden. In diesen Fragen ist auch zu überlegen, mit welcher Sicherheit sich der hebräische Text aus dem Griechischen rekonstruieren lässt. Meiner Einschätzung nach gibt es viele Fälle, in denen die griechische Lesart vorzuziehen ist, und zwar deshalb, weil meist (wenn auch nicht immer!) weniger auf dem Spiel steht als bei einer Frage wie der Chronologie, und man folglich weniger Gründe dafür anführen kann, warum hier detaillierte Veränderungen vorgenommen worden sein sollen.21
Der für jede in diesem Kommentar behandelte Perikope rekonstruierte Text ist ein Mischtext, der „älteste ableitbare Text“, dessen Grundlage meine Beurteilung des MT und der gerade skizzierten Zeugen für die OG ist. Diese Herangehensweise und ihre theoretische Fundierung hat Troxel für seine Arbeit an Jesaja 1–39 treffend beschrieben:
Ich kann nur versichern, dass zu dem von mir vorgeschlagenen Mischtext von Jes 1–39 Lesarten mit dem größten Anspruch auf Ursprünglichkeit gehören, und zwar auf der Grundlage meiner Beurteilung der Indizien aus den Textzeugen und dem literarischen Kontext, in dem sie stehen. Der Subjektivität dieser Beurteilung kann man nicht entgehen, weil es keinen archimedischen Punkt gibt, von dem aus man sie unternehmen könnte. Dabei zwingen die offensichtlichen entwicklungsgeschichtlichen Beziehungen zwischen vielen Varianten zu einer solchen Einschätzung.22
Auch wenn es innerhalb bestimmter Diskussionsgänge nicht immer ersichtlich sein mag, sind alle textkritischen Entscheidungen in diesem Kommentar in Demut und nicht ohne Bangen getroffen worden. Viele von ihnen wurden mehr als einmal verändert. Sehr beruhigend ist es, wenn sich textkritische Entscheidungen bei Trebolle oder einer der großen Exegeten der Vergangenheit wie Burney, Klostermann oder Stade finden, denen ich zustimmen oder auf die ich mich berufen kann. Natürlich ist es auch möglich, zu einer anderen Entscheidung zu kommen. Vor allem hoffe ich, dass der textkritische Fokus dieses Kommentars zukünftige Kommentatoren dazu anregt, textkritische Überlegungen stärker in die Auslegung einzubeziehen.
Weil dies aber ein Kommentar ist und keine kritische Textausgabe, ist es nur begrenzt möglich, sich textkritischen Fragen zu widmen.23 Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Textunterschieden, die für den Inhalt oder den Sinn von Bedeutung sind, was allerdings schon bei kleinen Unterschieden der Fall sein kann.Ausgelassene Varianten Unberücksichtigt bleiben in den Anmerkungen zu Text und Übersetzung generell die folgenden Varianten, falls nicht weitere Gründe für eine Diskussion vorliegen: stilistische Unterschiede wie etwa die Nennung von Eigennamen durch G zur Verdeutlichung, wo MT Pronomina verwendet; die Nennung oder Auslassung von Konjunktionen, wenn dadurch der Sinn nicht verändert wird; geringfügigere Erweiterungen wie etwa Titel (z. B. „König von Israel“, die Wiederholung des Patronyms, die Nennung oder Auslassung des bestimmten Objekts sowie die Wörter „alle“ bzw. „alles“); die Auslassung bzw. Nennung des indirekten Objekts („ihm“, „ihr“, „ihnen“ usw.) nach Verben wie „sagen“, „sprechen“ usw.; eine veränderte Wortstellung, insofern diese nicht von Bedeutung zu sein scheint; unterschiedliche Präpositionen, bei denen es kaum Bedeutungsunterschiede gibt (z. B. εν/επι vs. על/ב). MT als LeithandschriftDie Leithandschrift, die bei gleichwertigen Varianten im MT und der OG den Ausschlag gibt und an der ich mich in den meisten Fällen bei der Schreibweise und anderen „Akzidenzien“ orientiere, ist der MT in Gestalt des Codex Leningradensis.24