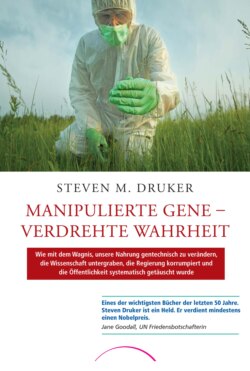Читать книгу Manipulierte Gene – Verdrehte Wahrheit - Steven M. Druker - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Entstehung der „Molekularpolitik“ – und die Kraft von Phantombeweisen
ОглавлениеDie entscheidende Nachricht von neuen Beweisen war auf drei Tagungen zurückzuführen, auf denen die Sicherheit gentechnisch veränderter Organismen bewertet werden sollte. Die erste fand 1976 in Bethesda, Maryland, statt, die zweite im Jahr darauf in Falmouth, Massachusetts, und die dritte 1978 im englischen Ascot. Zusammengefasst vermittelten sie den Eindruck, es seien genügend Beweise zusammengetragen, um zu zeigen, dass gentechnisch veränderte Organismen sicher seien – und dass die Fachleute keine Bedenken mehr hegten. Doch dieser Eindruck war irreführend.
Zum einen erweckten die Tagungen zwar einen wissenschaftlichen Anschein, doch sie unterschieden sich signifikant von normalen wissenschaftlichen Veranstaltungen. Im Gegensatz zum üblichen Vorgehen kontrollierten die Organisatoren sorgfältig, wer daran teilnahm, wie die Themen diskutiert und welche Informationen verbreitet wurden. Die Konferenzen wurden nicht nach der normalen Vorgehensweise angekündigt, die Teilnahme erfolgte nur über eine Einladung, und die Eingeladenen favorisierten mehrheitlich minimale Kontrollen in der rDNA-Forschung. (43) Jonathan King vom MIT, einer von nur zwei Wissenschaftlern auf der Konferenz von Falmouth, die für größere Vorsicht plädierten, merkte an, dass viele gleichgesinnte Fachleute, die üblicherweise teilgenommen hätten, „recht wütend waren, … als sie herausfanden, dass eine Konferenz zur Risikobewertung stattfand, und sie erst hernach davon erfuhren.“ (44) Bei der Tagung von Bethesda war die Geheimhaltung sogar noch etwas weiter gegangen als in Falmouth, und zwar so weit, dass selbst zehn Jahre danach noch nicht einmal öffentlich bekannt gegeben worden war, wer (außer den beiden Vorsitzenden) daran teilgenommen hatte. Und die Organisatoren der Konferenz von Ascot luden überhaupt keine Mitglieder der British Genetic Manipulation Advisory Group (GMAG) (dt. etwa Britische Beratergruppe zur Genmanipulation) ein, eine höchst unkorrekt anmutende Unterlassung, die ein Mitglied dieser Gruppe zu der Aussage veranlasste: „Es könnte als Unhöflichkeit betrachtet werden, eine internationale Konferenz zu einer wichtigen politischen Frage abzuhalten, ohne die entsprechende Organisation des Gastgeberlandes einzubinden …“ Er mutmaßte, die GMAG wurde brüskiert, weil sie sich durch eine „starke Repräsentation … des öffentlichen Interesses“ auszeichnete und „eine kritische Präsenz dargestellt hätte“. (45)
Als Susan Wright die Protokolle und ihre Interviews mit den Teilnehmern gründlich durchsah, fiel ihr auf, dass es bei den Tagungen nicht nur um die technische Risikobewertung ging, sondern ebenso sehr darum, wie man mit der öffentlichen Risikowahrnehmung umgehen könnte. (46) Dieses Anliegen trat besonders bei der Tagung in Bethesda hervor. Wie Wright bemerkt, war „ein wichtiges informelles Thema“ der Konferenz „eine gemeinsam empfundene dringende Notwendigkeit, nicht nur mögliche Risiken der Arbeit mit rekombinanter DNA einzugrenzen, sondern darüber hinaus auch die Ausbreitung der Kontroverse.“ (47) Sie berichtet, die Diskussionen ließen „eine Art Belagerungsgefühl … eine gemeinsam empfundene Bedrohung, eine Polarisierung, ein Wissenschaftler-gegen-Gesellschaft“ erkennen. Auch stellt sie eine Tendenz fest, „die Gruppen zu polarisieren“ und Wissenschaftler „Der-Himmel-stürzt-ein-Leuten“ und „Untergangspropheten“ gegenüberzustellen. (48)
Diese polarisierte Stimmung sowie die wissenschaftlichen und politischen Ziele der Konferenz waren bereits in der Eröffnungsrede des Vorsitzenden erkennbar: „In unserer heutigen Tagesordnung geht es unter anderem darum, Sie einzubinden und dafür zu sorgen, dass Ihre Stimmen gehört werden … Wenn ich den Untergangspropheten sagen könnte: ‚Schauen Sie, diese Leute haben sich aus der Deckung gewagt und gesagt, hier gibt es nichts, weswegen man sich sorgen müsste, machen wir also mit der ernsthaften Arbeit weiter.‘ Dass wir das schaffen, ist meine Hoffnung.“ (49)
Dieses Streben nach Einigkeit zeigte sich im Umgang mit Fragen. Obwohl die Teilnehmer erkannten, dass die rDNA-Technologie mehrere Risiken bergen könnte, wurde der Fokus systematisch auf die Erforschung einer bestimmten Bakterienart eingeengt, nämlich E. coli K-12, weil sie dem Anschein nach praktisch keine Bedrohung darstellte.
Wie bereits erwähnt, ist E. coli eine Bakterienart, die im Darm von Menschen und mehreren anderen Tieren vorkommt. E. coli K-12 ist ein bestimmter Stamm, der in Laboratorien für Forschungszwecke kultiviert wurde. Weil K-12 schon so viele Jahre in Labors verwendet wird, ist er mittlerweile recht schwach im Vergleich zu anderen Bakterien (einschließlich anderer E.-coli-Stämme) und könnte außerhalb der geschützten Laborumgebung nur schwer überleben. Ein Mikrobiologe formuliert es so: „K-12 … hätte in dem höchst konkurrenzgeprägten Umfeld Ihres Darmes keine Chance, in dem sich die Bakterien unaufhörlich entwickeln, um weiter ‚auf dem neuesten Stand‘ zu bleiben und nicht von anderen Mikroben verdrängt zu werden. K-12 dazu zu bringen, sich im Darm anzusiedeln, wäre so, als wollten Sie sich mit einem Auto aus dem Jahr 1922 für die Formel 1 qualifizieren (damals wurde K-12 aus dem Darm eines Menschen entnommen)! Damals war K-12 wettbewerbsfähig, doch jetzt ist er weit abgeschlagen.“ (50)
Infolgedessen konnten die Experten zuversichtlich sein: Ganz unabhängig davon, welche fremden Gene E. coli K-12 eingesetzt würden, war die Wahrscheinlichkeit äußerst gering, dass derart schwache Bakterien eine Epidemie auslösen könnten, falls sie aus dem Labor entwichen (deshalb wurden sie häufig in der rDNA-Forschung verwendet). Doch viele Konferenzteilnehmer hatten andere Bedenken. Zum einen untersagten die NIH-Richtlinien nicht die Forschung mit Mikroorganismen, die außerhalb des Labors überlebensfähiger waren als K-12. (51) Selbst wenn die Forschung weiterhin auf K-12 beschränkt bliebe, könnten außerdem, wie man erkannte, problematische Gene von ihm auf andere Organismen übertragen werden, die dann neuartige Krankheiten auslösen könnten. Ein Teilnehmer gab einige mögliche Szenarien zu bedenken und meinte: „Mir machen die Angst.“ (52)
Doch wie Wright feststellt, wurden diese und andere ungeklärte Sicherheitsfragen „gern aus der Betrachtung ausgeklammert statt angegangen.“ (53) Stattdessen „rückte das Gefühl … stärker in den Mittelpunkt, dass die biomedizinische Forschung bedroht war“, und ging mit Warnungen einher, die Wissenschaft werde „massiv angegriffen“. (54) Die Mitschrift lasse eine Veranstaltung erkennen, die „dominiert“ wurde von „Visionen, in denen sich Labors nur mit der Bürokratie herumschlugen“. In diesem Zusammenhang wurde das Argument, K-12 könne kein Epidemien auslösendes Pathogen werden, als die beste Maßnahme angesehen, die Kontroverse „zu entschärfen“. (55)
Wright zufolge scheinen die meisten Teilnehmer diese „politische Strategie“ akzeptiert zu haben. (56) Wie ein Biologe konstatierte: „… in Sachen PR muss man Epidemien ansprechen, denn davor haben die Leute Angst; und wenn wir ein schlagendes Argument zu Epidemien vorbringen und dafür sorgen, dass das im Gedächtnis bleibt, dann verschwindet viel von dieser ganzen öffentlichen Geschichte ohnehin.“ (57) Sie merkt an, dass am Ende der Vormittagssitzung ein Teilnehmer „das Gefühl der Gruppe zusammenfasste“ mit der Aussage, die Hauptaufgabe bestehe darin, die Öffentlichkeit zu überzeugen. Dann erklärte er: „Das geht ganz leicht. Es ist Molekularpolitik, nicht Molekularbiologie …“ (58)
Als der Vorsitzende die Ergebnisse der Bethesda-Konferenz dem RAC mitteilte, behauptete er, es herrsche Einigkeit darüber, dass die Möglichkeit einer Epidemie „extrem fern“ liege – und man sei gemeinsam der Ansicht, dass dieses Konzept „in einem öffentlichen Forum diskutiert werden soll“. (59) Daher wurde ein Organisationsausschuss gebildet, und im Juni 1977 fand die Falmouth-Konferenz statt. Doch wie die Fakten belegen, war der Ruf nach einem öffentlichen Forum nur PR – und das Einzige, was die Organisatoren bekannt machen wollten, war ein günstiges Ergebnis, nicht der Prozess seines Zustandekommens. Sonst hätten sie die Konferenz nicht als private Veranstaltung abgehalten, zu der die Medien nicht eingeladen wurden (und von der diese gar nichts wussten) – wie es auch schon in Bethesda der Fall war und auch in Ascot der Fall sein würde. (60)
Die Veranstaltungsleiter verfolgten die gleiche Strategie wie in Bethesda und konzentrierten sich wieder auf E. coli K-12. Dennoch brachten Teilnehmer strittige Themen zur Sprache; und sie diskutierten darüber, ob fremde Gene, die in K-12 eingesetzt würden, dann auf widerstandsfähige Organismen übergehen könnten – oder stattdessen, während sie in K-12 blieben, gefährliche Toxine oder Hormone in die Umgebung verbreiten könnten.
Susan Wright zufolge ergibt sich aus den veröffentlichten Protokollen, dass diese „lästigen Fragen“ nicht gelöst wurden. (61) Die Ergebnislosigkeit der Diskussionen ist aus einer Liste von Vorschlägen für die weitere Forschung zu erkennen, die mit folgender Aussage eingeleitet wird: „… aus dem Hexenkessel der lebhaften wissenschaftlichen Diskussion werden sich schließlich die maßgeblichen Experimente ergeben, um die möglichen Risiken in der rekombinanten DNA-Technologie zu bewerten.“ (62)
Damit wurden potenzielle Risiken sogar auf einer Veranstaltung eingeräumt, die sich fast nur auf Wissenschaftler beschränkte, die minimale Einschränkungen in der rDNA-Forschung wollten und deren Struktur so eng kontrolliert war, dass ein Teilnehmer sie als „choreografiert“ bezeichnete und ein anderer als „ein richtig abgekartetes Spiel“ (63) – neben der Tatsache, dass „maßgebliche“ Experimente zur genauen Risikobewertung noch durchgeführt werden müssten. Doch wurde weder der Öffentlichkeit noch dem größeren Kreis von Wissenschaftlern der Eindruck vermittelt, dass die Teilnehmer die Notwendigkeit schlagender wissenschaftlicher Beweise und einer „lebhaften wissenschaftlichen Diskussion“ erkannten, um ihre Entwicklung anzuregen. Denn da die Presse ausgeschlossen war und der offizielle Tagungsbericht erst elf Monate später veröffentlicht wurde, gab es Spielraum für selektive Kommunikation.
Die wichtigste zeitnah herausgegebene Information war ein Brief, den der Vorsitzende des Organisationsausschusses, Sherwood Gorbach von der Tufts University, unmittelbar nach der Konferenz an den Direktor der NIH schickte. Dieser Brief, der im Sommer 1977 weite Verbreitung fand, prägte in besonderem Maße die Wahrnehmung der Ergebnisse in der Öffentlichkeit. Nach Susan Wrights Worten behandelte er hauptsächlich die Frage des epidemischen Pathogens „unter der praktischen Ausklammerung anderer Themen“ und bot „eine im Wesentlichen beruhigende Aussicht …, in der Unsicherheiten und ungelöste Fragen verschleiert wurden, indem betont wurde, wie fern mögliche Risiken lägen“. (64)
Einige Teilnehmer versuchten jedoch den ihres Erachtens irreführenden Bericht des Konferenzverlaufs auszugleichen; unter ihnen war Richard Goldstein, einer der Organisatoren der Konferenz. In seinem Brief an den Direktor der NIH wies er darauf hin, „es herrschte zwar allgemeine Übereinstimmung darüber, dass eine Konversion von E. coli K-12 in einen epidemischen Stamm unwahrscheinlich ist (wenn auch nicht unmöglich), … es herrschte allerdings keine Übereinstimmung darüber, dass der Transfer auf Wildstämme unwahrscheinlich ist“. Dann stellte er fest: „Im Gegenteil, die vorgelegten Nachweise deuteten darauf hin, dass das eine ernste Befürchtung ist.“ (65) Etliche andere Konferenzteilnehmer schrieben Briefe, in denen sie ihm beipflichteten. (66)
Doch wie ein Forscher an der Stanford School of Medicine bemerkte, war es Gorbachs Zusammenfassung, die „die Aufmerksamkeit im Kapitol und in den Medien auf sich zog“. (67) Und die Medien, die sie für korrekt hielten, verbreiteten diese Botschaft vorbehaltlos. Die Washington Post meldete, die Wissenschaftler seien „einstimmig zu dem Schluss gekommen, die Gefahr einer unkontrollierten Epidemie [bestehe] praktisch nicht“. Die New York Times titelte: „Doch kein Sci-Fi-Albtraum“. (68) Wie Susan Wright anmerkt, wurde diese Version der Ergebnisse nicht nur von der Presse und der Öffentlichkeit akzeptiert, sondern „erlangte rasch wissenschaftliche Seriosität“ und wurde von angesehenen Biologen vorgebracht. (69) Überdies gingen deren Aussagen (darunter auch ein Editorial in Science) oftmals über die Behauptung hinaus, E. coli K-12 könne nicht pathogen werden, und versicherten, es bestehe Konsens, dass alle Forschung, die damit arbeite, sicher sei. (70) Die National Academy of Sciences (die NAS) führte die Verzerrung sogar noch weiter mit der Feststellung, es habe sich gezeigt, dass die Risiken der Gentechnologie allgemein unbedeutend seien. (71)
Für die Biotech-Befürworter am wichtigsten und mit den Konferenzzielen übereinstimmend war, dass der Gorbach-Bericht ein machtvolles politisches Werkzeug wurde. Mit seinen vermeintlich evidenzbasierten Zusicherungen gerüstet, initiierten Vertreter des Establishments der Molekularbiologie aus Industrie und Wissenschaft eine gigantische Lobbykampagne, die Susan Wright als „eine der größten“ beschrieb, die es je im in Bezug auf eine technische Frage gegeben habe. (72) Die Teilnehmer nahmen führende Forscher der American Society for Microbiology und ebenso die NAS mit hinzu; Universitäten schalteten sich mit ein in Form einer Lobbyistengruppe, die sich „Freunde der DNA“ nannte und zu deren Mitgliedern Präsidenten der „angesehensten akademischen Institutionen Amerikas“ gehörten. (73) Harvard stellte sogar zwei professionelle Lobbyisten an, die aushelfen sollten. (74) Die Kampagne war so außergewöhnlich im Hinblick auf Mitgliedschaft und Anzahl, dass mehrere Kongressangestellte sagten, so etwas hätten sie noch nie erlebt. (75)
Das Ziel dieser Wissenschaftler/Lobbyisten war, eine Regulierung zu verhindern, und ein zentraler Angriffspunkt dabei war der Gesetzentwurf, für den sich Senator Kennedy starkmachte; das war auch der Gesetzentwurf, der die größte Eigendynamik entwickelt hatte. Susan Wright berichtet, er sei in den maßgeblichen Senatsausschüssen „durchgewinkt“ worden und habe zu der Zeit, als die Biotech-Befürworter ihre Kampagne starteten, als „zustimmungssicher“ gegolten.(76)
Darum machten sie sich rasch daran, diesen Entwurf scheitern zu lassen. Weniger als eine Woche nach der Falmouth-Konferenz traf sich eine Gruppe herausragender Biologen mit Kennedy und argumentierte, sein Gesetzentwurf sei in Anbetracht der „neuen Informationen“ unnötig und sollte fallen gelassen werden. (77) Doch Kennedy blieb bei seinem Standpunkt und bekräftigte die Notwendigkeit einer Regulierungskommission.
Viele Kongressmitglieder waren jedoch leichter zu gewinnen, und in nicht einmal drei Monaten, nachdem Kennedy den Befürwortern einer uneingeschränkten rDNA-Forschung eine Abfuhr erteilt hatte, hatte ihre hartnäckige Kampagne die Stimmung in der Legislative entscheidend verändert. Senator Adlai Stevenson III. brachte diese neue Haltung in einer Rede vor seinen Kollegen am 22. September zum Ausdruck, als er versicherte, „neue Hinweise“ auf die geringeren Risiken einer solchen Forschung forderten sie auf, noch einmal „sorgfältig“ abzuwägen, ob die Vorteile einer Regulierung ihre negativen Auswirkungen auf die wissenschaftliche Forschung überwiegen würden. (78)
Da sich nun so viele Kongressmitglieder gegen eine Regulierung zusammentaten, musste Kennedy schließlich kapitulieren. Am 27. September gab er in einer Rede vor der Association of Medical Writers (dt. etwa Vereinigung medizinischer Autoren) bekannt, er werde seinen eigenen Gesetzentwurf nicht mehr unterstützen, denn „die Informationen, die uns heute vorliegen, unterscheiden sich signifikant von denen, die zur Verfügung standen, als unser Ausschuss … den Gesetzentwurf empfahl“. (79)
Susan Wright zufolge war dieses Umschwenken ein wichtiges Ereignis in der Geschichte der Gentechnologie, „weil es die Macht der biomedizinischen Forschungsgemeinschaft demonstriert, die Kontrolle über die Regulierung des Fachgebiets zu behalten und die Bedingungen des Fachdiskurses zu den Gefährdungen zu diktieren“. (80) Es zeigte auch, dass diese Macht durch unbegründete und äußerst zweifelhafte Werbeaussagen erlangt und erhalten werden konnte, solange diese für wissenschaftlich untermauert erklärt wurden.
Zudem waren die Lügengeschichten von Falmouth nicht nur irreführende Informationen, mit denen Kennedys Gesetzentwurf abgeschmettert werden sollte. Eine zentrale Rolle spielte auch ein Bericht über eine Forschungsarbeit, die Stanley N. Cohen von der Stanford University durchgeführt hatte. Cohen, ein Miterfinder der rekombinanten DNA-Technologie, gehörte zu den Wissenschaftlern, die sich nicht damit begnügten, für die Forschungssicherheit mit E. coli K-12 einzutreten. Stattdessen behauptete er, die Technologie, bei deren Entwicklung er half, sei allgemein sicher – und er betonte nachdrücklich, sie könne keine besonderen Risiken mit sich bringen. (81) 1977 führte er eine Studie durch, um seinen Standpunkt zu stützen. Er wollte nachweisen, dass die im Reagenzglas erzielten genetischen Rekombinationen auch natürlich in lebenden Organismen auftreten – und dass somit das Spleißen von Genen zwischen nicht verwandten Spezies keine radikal neue und künstliche Entwicklung ist, sondern etwas, was in der Natur schon seit Äonen ganz unschädlich stattfindet. Als die Ergebnisse vorlagen, meldete er einen Erfolg, weil es ihm (und seinem Kollegen Shing Chang) gelungen war, eine Situation zu erzeugen, in der Fragmente von Mäuse-DNA von E. coli K-12 aufgenommen und dann in ihre DNA integriert wurden. (82)
Cohen nahm für seine Forschungsarbeit weitreichende Konsequenzen in Anspruch mit dem Argument, sie zeige, dass „Wissenschaftler nur duplizieren können, was die Natur bereits kann“. (83) Noch kühner anklingen ließ er dieses Thema in einem Brief an den Direktor der NIH vom 6. September 1977; darin behauptete er, das Ergebnis sei ein „zwingender Beweis“, dass die im Labor hergestellten rekombinanten DNA-Moleküle „einfach ausgewählte Zeitpunkte eines Prozesses darstellen, der auf natürlichem Weg stattfindet“. (84)
Außerdem erscheint es, als habe Cohen die Bekanntgabe seiner Nachricht zeitlich so abgestimmt, dass sie die Lobbykampagne unterstützte. Damit unternahm er den, wie er zugab, „ungewöhnlichen Schritt“, seine Untersuchungsergebnisse lange vor ihrer Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift bekannt zu machen, doch das tat er, wie er sagte, wegen ihrer „Bedeutung für die Regulierung der rekombinanten DNA“. (85)
Die Lobbyisten griffen seine voreilige Verlautbarung auf, und weil darin die Biotechnologie als Ganzes als grundsätzlich natürlich (und damit sicher) hingestellt wird, verlieh sie den Erklärungen der Falmouth-Konferenz enorme Substanz. Deshalb trug sie dazu bei, die Kongressmitglieder zu überzeugen, dass ihre früheren Bedenken unbegründet waren; und aufgrund ihres Umfangs und ihrer scheinbaren wissenschaftlichen Grundlage rechtfertigte Senator Kennedy hauptsächlich damit seine folgenschwere Kehrtwende. (86)
Doch wie bei den Behauptungen von Falmouth war der Eindruck, Cohens Äußerungen seien von stichhaltigen Beweisen hergeleitet, eine Illusion. Er stand zwar dafür ein, dass das Experiment unter natürlichen Bedingungen durchgeführt worden war, doch die Wirklichkeit war eine andere. Denn um die Bakterien dazu zu bringen, die fremde DNA aufzunehmen, behandelten er und Chang diese nicht nur mit einem Kalziumsalz, sie mussten sie auch einem massiven Hitzeschock aussetzen (indem sie die Temperatur rasch um 42 Grad Celsius erhöhten).
Diese Bedingungen waren von natürlichen weit entfernt – und die meisten Wissenschaftler wussten das. Außerdem hatten die NIH einen besonderen Grund, darum zu wissen. Nur sechs Monate bevor Cohens Brief, in dem er die Natürlichkeit der Bedingungen behauptete, unter denen er den artübergreifenden Austausch herbeigeführt hatte, auf dem Schreibtisch des Direktors gelangte, hatte der herausragende Mikrobiologe Roy Curtiss einen Brief mit einer gegensätzlichen Sichtweise geschickt. Selbst wenn Curtiss‘ Brief auch zur Kampagne gegen die Regulierung beitrug (es war ein offener Brief, der weite Verbreitung fand), unterhöhlte er ironischerweise doch die Behauptung, die Cohen später aufstellen sollte. Denn Curtiss‘ Argument für die Sicherheit der rDNA-Forschung basierte teilweise auf der Tatsache, dass die von Cohen erzwungenen Bedingungen höchst unnatürlich waren. Mit der Behauptung, dass das Einsetzen einer fremden DNA in E. coli K-12 „keinerlei Gefahr darstellt“, erklärte Curtiss, selbst wenn so eine DNA später freigesetzt würde, bestehe eine geringe Möglichkeit, dass andere Bakterien sie aufnehmen würden, falls sie nicht mit einem Salz behandelt und einer raschen Temperaturerhöhung um 42 Grad unterzogen würden – Bedingungen, so betonte er, „denen man in der Natur nur mit geringer Wahrscheinlichkeit begegnete“. (87)
Obwohl die Briefe einander widersprachen, benutzten die NIH beide als stützende Beweise für ihre Biotechnologie-freundlichen Grundsatzerklärungen, die eklatante Diskrepanz zwischen beiden erwähnten sie hingegen nie. (88) Später wurde die Behörde gezwungen, sich mit der Unrechtmäßigkeit von Cohens Behauptung auseinanderzusetzen. Das war bei einer Besprechung, die der Direktor im Dezember 1977 mit seinem Beratergremium abhielt, als der angesehene Biologe Robert Sinsheimer die Künstlichkeit des Versuchsaufbaus nachdrücklich klarmachte. (89) Diese überzeugende Abqualifizierung hielt die NIH zwar davon ab, die Untersuchung in späteren Veröffentlichungen zu zitieren, doch sie reagierten praktisch nicht und unternahmen augenscheinlich nichts, um die falsche Auffassung zu korrigieren, die den Kongressmitgliedern und der Öffentlichkeit eingeimpft worden war. Die Vertreter der Legislative waren also niemals richtig darüber informiert, dass die vermeintlich durch Beweise gesicherte öffentliche Erklärung, auf die sie sich so stark stützten, fingiert war. Ebenso wenig wurde Senator Kennedy darauf hingewiesen, dass die NIH bereits ein halbes Jahr vor seiner Kapitulation aufgrund dieser Verlautbarung über Informationen verfügte, die diese im Voraus entwertete – und dass die NIH nicht einmal drei Monate nach seiner Kehrtwende wieder auf ihre Schwäche hingewiesen wurde, diesmal so direkt und vor so vielen Fachleuten, dass die Behörde sie nicht mehr zu erwähnen wagte. (90)