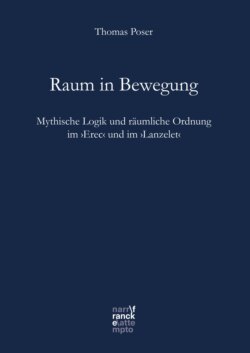Читать книгу Raum in Bewegung - Thomas Poser - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.3 Formale Aspekte des Mythischen
ОглавлениеMythos und Literatur hinsichtlich ihrer jeweiligen Funktion zu differenzieren, scheint zu einer Minimalbestimmung des Mythos zwar zwingend erforderlich, aber keineswegs hinreichend. Denn vom Mythos ebenfalls zu unterscheiden sind andere kulturelle Praktiken und Redeordnungen, die sich – allen voran Religion und Wissenschaft – gleichfalls nicht als fiktional verstehen und in ihrer weltmodellierenden Funktion dem Mythos insofern äquivalent sind. Wenn man Mythos mit Christoph JAMME als eine »bestimmte[ ] Perzeptionsweise von Wirklichkeit, die zugleich Ausdrucksweise ist«1, begreift, dann liegt das entscheidende Moment darin, wie der Mythos die einzelnen Elemente seiner Modellierung von Wirklichkeit zueinander in Beziehung setzt.2 Hier ist an die vor allem durch den FRIEDRICH/QUAST-Band erneut angeregten Überlegungen zu formalen Aspekten des Mythischen anzuschließen.
Forschungsgeschichtlich gleichermaßen einflussreich wie umstritten war das Bestreben des Ethnologen und Philosophen Lucien LÉVY-BRUHL, sich von der Einstellung der frühen Ethnologie (vor allem vertreten durch Edward TYLOR und James FRAZER) zu lösen, die »Geistestätigkeit« autochthoner Völker »auf eine niedrigere Stufe der unseren zurückführen zu wollen«3. Als Gegenvorschlag zu diesem Entwicklungsmodell unterbreitete LÉVY-BRUHL das Konzept des ›prälogischen‹ Denkens, das die Denktraditionen schriftloser Kulturen nicht mehr allein in Bezug zu ›moderner‹ Rationalität als deren implizite Ziel- und Vollendungsform, sondern gerade in ihrer Fremdartigkeit und Eigengesetzlichkeit zu beschreiben versuchte. Zentral für diese Denktraditionen sei das von LEVY-BRUHL so bezeichnete »›Gesetz der Partizipation«. Die Besonderheit dieser Vorstellung einer universellen ›Anteilnahme‹ der Entitäten, »die in einer Kollektivvorstellung verknüpft sind«, liegt darin, dass in ihr »die Gegenstände, Wesen, Erscheinungen auf eine uns unverständliche Weise sie selbst und zugleich etwas anderes als sie selbst sein können«4. Mithin habe, so LÉVY-BRUHL, der für das europäische Denken so zentrale Satz vom Widerspruch in dieser Mentalität keine oder doch nur eine nachrangige Bedeutung:
»Für diese geistige Beschaffenheit führt der Gegensatz zwischen dem einen und dem vielen, demselben und dem anderen nicht notwendig dazu, eine dieser Bestimmungen zu verneinen, wenn man die andere bejaht, und umgekehrt. Der Gegensatz hat nur ein sekundäres Interesse. Manchmal wird er bemerkt, manchmal auch nicht.«
LÉVY-BRUHL betont, dass sich diese ›geistige Beschaffenheit‹ »nicht in willkürlichen Widersprüchen [gefalle] – dadurch würde sie für uns einfach absurd werden –, aber sie denkt auch nicht daran, sie zu vermeiden. Sie ist in diesem Punkte meistens indifferent«5. Logisches und ›Prälogisches‹ schließen sich dabei nicht aus, sondern
»durchdringen einander gegenseitig, und das Ergebnis ist ein Gemisch, dessen Elemente wir mit großem Unbehagen ununterschieden lassen müssen. Da in unserem Denken das logische Bedürfnis alles, was ihm offenbar entgegengesetzt ist, ausschließt, ohne sich auf einen Kompromiß zu verstehen, können wir uns nicht in eine Denkweise hineinfinden, in der das Logische und Prälogische zusammen bestehen und sich gleichzeitig in den geistigen Operationen fühlbar machen.«6
Insofern das partizipatives Denken im Sinne LÉVY-BRUHLs auch gegenläufige Tendenzen zulässt,7 die in wissenschaftlich-rationaler Sicht einander zu widersprechen scheinen, kann eine selbstreflexive Tendenz dieser Mentalitätsstruktur festgestellt werden, die ihre charakteristische Widerspruchstoleranz auf die eigenen logischen Verknüpfungsregeln ausweitet: Nicht nur die Entitäten, auf die es sich bezieht, auch das logische System partizipativen Denkens selbst ist in diesem Sinne in nicht-identitätlogischer Weise es selbst und doch etwas anderes, nämlich – um den Sprachgebrauch LÉVY-BRUHLs vorerst beizubehalten –, ›logisch‹ und ›prälogisch‹ zugleich.
An LÉVY-BRUHL anschließend,8 doch stärker als dieser »die Errungenschaften des mythischen Denkens« hervorhebend, »das nicht logische Erklärungssätze, sondern symbolischen Sinn«9 konstruiere, hat Ernst CASSIRER dazu angesetzt, den Mythos als ›Denkform‹ zu beschreiben. Charakteristisch hierfür sei, so CASSIRER, das »Gesetz der Konkreszenz oder Koinzidenz der Relationsglieder im mythischen Denken«, das sich »durch alle seine Kategorien hindurch verfolgen«10 lasse:
»Wenn die wissenschaftliche Erkenntnis die Elemente dadurch zu verknüpfen vermag, daß sie sie, in ein und demselben kritischen Grundakt, gegeneinander sondert, so ballt der Mythos, was immer er berührt, gleichsam in eine unterschiedslose Einheit zusammen. Die Beziehungen, die er setzt, sind so geartet, daß durch sie die Glieder, die in sie eingehen, nicht nur ein wechselseitiges ideelles Verhältnis eingehen, sondern daß sie geradezu miteinander identisch, daß sie ein und dasselbe Ding werden. Was sich nur immer im mythischen Sinne miteinander ›berührt‹ – mag diese Berührung als räumliches oder zeitliches Beieinander als als irgendeine noch so/entfernte Ähnlichkeit oder als Zugehörigkeit zu derselben ›Klasse‹ oder ›Gattung verstanden werden – das hat im Grunde aufgehört, ein Vielartiges oder Vielfältiges zu sein: es hat eine substantielle Einheit des Wesens gewonnen.«11
Was immer der Mythos beobachtet – sei es Raum und Zeit, Ursache und Wirkung, Zeichen und Bedeutung usw. –, er beobachtet es mithin gerade nicht als etwas von etwas anderem Unterschiedenes. In diesem Sinne operiert der Mythos nicht identitätslogisch, sondern ist durch Strukturen der Entdifferenzierung des an sich Geschiedenen gekennzeichnet.
Die konzeptionelle Nähe zu LÉVY-BRUHL ist unverkennbar.12 Gleichwohl war es die Begrifflichkeit Ernst CASSIRER, die sich auf lange Sicht forschungsgeschichtlich durchsetzen hat können. Denn obwohl LÉVY-BRUHL von vorne herein klarzustellen bemüht war, dass die Bezeichnung ›prälogisch‹ nur »in Ermangelung eines besseren Namens« gewählt sei, dass die damit beschriebene »geistige Beschaffenheit« weder »antilogisch« noch als »alogisch« zu nennen und dass damit auch kein kulturhistorisches oder gar biologisches Stadium der Menschheitsgeschichte gemeint sei, »welches der Erscheinung des Denkens in der Zeit«13 vorausgehe, reproduziert seine Terminologie eben doch jene Vorstellung einer Verlaufsgeschichte kognitiver Dispositionen – Peter FUSS spricht von der »phylogentische[n] Marginalisierung«14 des mythischen Denkens –, von der sich LÉVY-BRUHL gerade abzugrenzen versuchte. Aus diesem Grund soll im Folgenden auf den Begriff verzichtet werden, zumal LÉVY-BRUHL seinerseits als Reaktion auf die vorgebrachte Kritik »das inkriminierte Wort nach 1918«15 nicht mehr verwendet hat. Stattdessen werde ich von ›Partizipation‹ sprechen, wo der Aspekt der Kontiguität in der mythischen Logik im Vordergrund steht – die von LÉVY-BRUHL beschriebenen partizipativen Phänomene manifestieren sich vor allem als Teil-Ganzes-Relationen oder auch als tatsächliche räumliche Nähe –, bzw. von mythischer ›Konkreszenz‹, wo es – damit verbunden – um das paradoxale In-eins-Setzen von zugleich Geschiedenem gehen soll. Entscheidend ist, dass es sich beim mythischen Denken – wie Jan und Aleida ASSMANN festhalten (und damit den Beobachtungen LÉVY-BRUHLs zu neuem Recht verhelfen) – um ein »Denken« handelt, »das den Satz vom Widerspruch nicht kennt« und das die Welt deshalb »nicht als eine Konstellation fixierter Werte« auffasst, »sondern als ein beständiges Oszillieren zwischen gegensätzlichen Polen«16.
Damit sind die Elemente zu einer heuristischen Minimalbestimmung des Mythos benannt: Der Mythos ist eine der mündlichen Tradition17 seiner Trägerschaft entstammende ›Erzählung‹ – so bekanntermaßen schon die Grundbedeutung des Begriffes18 – mit ursprünglich weltmodellierender und orientierungsstiftender Funktion; sein Geltungsanspruch unterscheidet ihn von poetischen Erzählweisen, seine spezifischen Strukturmerkmale von anderen, in ihrer Verbindlichkeit dem Mythos aber vergleichbare Formen des Weltzugangs wie Wissenschaft oder Religion.19 Eine solche Minimaldefinition20 mag reduktionistisch erscheinen, doch lassen sich daraus m.E. eine ganze Reihe der von ASSMANN/ASSMANN aufgefächerten Dimensionen des Mythos ableiten: so etwa aus der Verwurzelung in der mündlichen Tradition der Aspekt der ›Landläufigkeit‹, der für den ›Alltags-Mythos‹ – im Sinne von »mentalitätsspezifische[n] Leitbilder[n], die kollektives Handeln und Erleben prägen«21 (= M 4 in der Systematik von ASSMANN/ASSMANN)22 – ebenso bedeutsam ist wie der Geltungsanspruch des Mythos, oder aus dessen formalen Distanz zu wissenschaftlicher Rationalität der seit der griechischen Archaik geläufige polemische Mythos-Begriff (= M 1). Wenn auch der wissenschaftliche Diskurs seinen Aussagen andere logische Verknüpfungsregeln zugrundelegt als der Mythos, so können dessen spezifische Strukturmerkmale gleichwohl an anderem Ort – in der Dichtung nämlich, die sich ihrerseits durch ihren fiktionalen Charakter von wissenschaftlichen Äußerungsformen unterscheiden lässt – davon völlig unberührt persistieren.
Das gilt nicht nur für literarische Narrative, welche auf den Stoffen und Motiven ursprünglich oraler mythischer Traditionen beruhen (= M 6), sondern auch für sprachliche Phänomene, deren faktische Distanz zu den Gesetzmäßigkeiten ›rationaler‹ Logik oft gar nicht bewusst reflektiert werden. So hat Susanne KÖBELE etwa Metaphern, die gemeinhin als plane Ersetzungstropen im Sinne der aristotelischen Rhetorik verstanden werden, im Spannungsfeld von »analogisierender und identifizierender Rede« zu beschreiben versucht; demnach trete »[m]it einem Schlag […] das eine oder andere in den Blick, wird die Differenz – die ›kategoriale Distanz – zugleich aufrechterhalten und überspielt«23. Dieses Oszillieren zwischen ›Unterscheiden‹ und ›In-Eins-Setzen‹ rückt die Logik metaphorischen Sprechens in die Nähe des Mythos, wie auch Peter FUSS bemerkt:
»Metaphern […] gehorchen der Logik des Sowohl-Als auch, wenn sie ein Signifikat durch den Signifikanten eines anderen Signifikats (mit-)bezeichnen. Dies ist ein Indiz für die genealogische Relation zwischen Mythos und Literatur. Literatur ist eine postarchaische Manifestation mythischen Denkens.«24
Wenn aber der (›eigentlich‹ uneigentliche) sprachliche Ausdruck und seine ›eigentliche‹ Bedeutung in diesem Sinne jederzeit ineinander umschlagen können, dann bedeutet das auch, dass zwischen Ausdruck und Inhalt nicht mehr eindeutig unterschieden werden kann, oder anders gesagt, »dass Form- und Inhaltsseite […] einerseits analytisch getrennt werden müssen, andererseits nicht unabhängig voneinander besprochen werden können. Was ein Text sagt, ist immer, wie er es sagt.«25 Die nahe Verwandtschaft von Mythos und Metapher lässt vermuten, dass mythosartige Strukturphänomene nicht ausschließlich auf solche Bereiche beschränkt sind, in denen dem Erzählen tatsächlich auch eine entsprechende mythische Stoffgrundlage unterlegt ist. Gleichwohl scheint es mit einer gewissen Inzidenz überall dort, wo mythische Strukturphänomene zu beobachten sind, auch eine entsprechende ›inhaltliche‹ Rückbindung an mythische Erzähltraditionen zu geben, etwa in Form bestimmter Figuren oder Motivkomplexe, die ihren Ursprung in den ›Mythologien‹26 unterschiedlichster Kulturkreise haben können. Dabei gilt freilich, dass diese Traditionen ihrerseits nur aufgrund bestimmter formaler oder struktureller Aspekte überhaupt als ›mythische‹ erkenn- und beschreibbar sind27: Form und Inhalt sind strukturell aneinander gekoppelt und bedingen sich gegenseitig. Da insofern das Mythische nichts ist, »was gefunden werden könnte, nichts Substantielles, auf Stoffgeschichtliches beschränktes«, sondern vielmehr eine »poetologische und inhaltliche Fragen aufeinanderbeziehende Kategorie«28, sollte – um den Begriff nicht zu sehr auszudehnen und damit sein analytisches Potential preiszugeben – von mythischem Erzählen nur dann die Rede sein, wenn beides gegeben ist: eine auf der Ebene der Erzählstrukturen zu beobachtende Nähe zum mythischen Denken einerseits wie eine Anbindung an mythische Stofftraditionen andererseits.29 In diesem Sinne kann auch von ›mythischem Erzählen‹ in der mittelalterlichen Epik gesprochen werden, ohne dass es sich dabei auch um Mythen gemäß der oben vorgeschlagenen Definition handeln müsste.