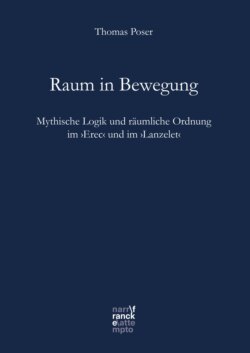Читать книгу Raum in Bewegung - Thomas Poser - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.2 Aspekte der Semantik von mhd. vreude
ОглавлениеVreude ist das »Kernstück höfischer Lebenslehre«1. Der Begriff geht auf eine im 8. Jahrhundert zuerst im süddeutschen Sprachraum auftretende Neubildung zur Adjektivform frao (Stamm: fraw-) zurück (ahd. frawida, frewida), die die bis zu diesem Zeitpunkt gängigen synonymen Begriffe (ahd. blidida, gaman, mendi u.a.) allmählich verdrängte. Der Begriff steht in einer Reihe weiterer neugebildeter Abstrakta des »Gefühls- und Geistesleben[s]«, die von der christlichen Mission eingesetzt wurden, »um spezifisch christliches Gedankengut auszudrücken«, wobei die bedeutungsäquivalenten Begriffe, die die althochdeutsche Sprache bereits zur Verfügung stellte, sich zu diesem Zweck vermutlich als »zu sehr mit heidnischem Klang beladen«2 erwiesen haben. Eine umfangreiche Untersuchung zum vreude-Begriff in der mhd. Literatur hat unter problemgeschichtlicher Perspektive Karl KORN vorgelegt. Grundsätzlich lässt sich KORN zufolge eine semantische Verschiebung von einem jenseitsorientierten vreude-Begriff hin zu vreude als einem weltlichen Wertbegriff konstatieren. Der ursprüngliche vreude-Begriff der geistlichen Dichtung meint ›Freude in Gott‹. Diese Auffassung von vreude geht einher mit einer dezidierten Abwertung der irdischen Freude: »Im diesseitigen Leben gibt es nichts Freudiges […] außer der Hoffnung auf die dereinstige Auferstehung […] und auf die ewige Glückseligkeit«3. Konsequenterweise privilegiert es die geistliche Dichtung, »an die Stelle wirklichen Freudefühlens die Erwartung auf einen zukünftigen Dauerzustand der Freude zu setzen, der hinsichtlich seiner Erlebnisqualität unbekannt ist und nur negativ bestimmbar bleibt«4: durch gotes minne / [verkiesen] wertliche wunne (JG 193f.), lauten die entsprechenden Stichworte etwa in Frau Avas ›Jüngstem Gericht‹.5
Der Gegenbegriff zu vreude ist trûren. Wie die vreude, so ist auch das trûren zunächst in erster Linie religiös motiviert: trûren ist angemessen nur als emotionale Reaktion auf die erbsündige Verfasstheit des Menschen. Alles trûren aus weltlichen Beweggründen ist demnach selbst sündhaft. Das wird bereits in der frühmhd. ›Kaiserchronik‹ deutlich:
Allez wainen ist verboten
von dem almehtigen gote,
wan die sunde aine:
die zeher die sint raine (Kch 2689–2692)
Ähnlich argumentiert gut ein Jahrhundert später der Erzähler in Ulrichs von Liechtenstein ›Frauendienst‹: Truren daz ist niemen guot / wan dem, der ez umb sünde tuot (UvLFr 1690,1f.). Doch trûren wird nicht allein in geistlicher, sondern auch in weltlicher Hinsicht negativ sanktioniert: Es ist »von gesellschaftlich anerkannten Umgangsformen (êren) ausgeschlossen«6: swer anders truret, daz ist enwiht, / truren daz birt eren niht (UvLFr 1690,3f.). Neben der Form der »gemäßigten geistlichen Traurigkeit«7 erscheint trûren aber auch als »Ausdruck gottferner Verzweiflung an der Möglichkeit von Erlösung«8. In diesem Sinne bedeutet trûren: »im Zustand der Gottverlassenheit und des Gnadenmangels leben«9. Diese Haltung kennzeichnet auch bei Ulrich noch »durchaus traditionskonform den Todsünder«10.
Im geistlichen Diskurs, beispielsweise im Kontext legendarischen Erzählens, verweisen Formeln wie trûren stœren o.ä. noch im 13. Jahrhundert dementsprechend auf »Heilsaffirmation« qua Abweisung des »Negativzustand[s] drohenden Heilsverlusts«11:
mit sîner miete lône
brâht er si von latîne
ze tiuscher worte schîne
dar umbe daz diu liute
vernæmen dran ze diute
daz er kann trûren stören (Pan 2144–2149),
wie etwa Konrad von Würzburg sich im ›Pantaleon‹ über seinen Gönner, Johannes von Arguel, äußert. In der Minnesangtradition dagegen will auf wieder »eigene Weise […] der glücklose Sänger im […] Modus des trûren stœren je neu vreude mêren«: trûren stœren / kumt uns lobebæren (Neid SL 29, III,3f.). Bei Walther von der Vogelweide ist es die umworbene Dame selbst, die mit ihrer Gunsterweisung das trûren des Sängers zu wenden vermag: Diu mîn iemer hâ gewalt, / diu mac mir wol trûren wenden / unde senden fröide manicvalt (L 109,5–7). Die Semantik von trûren ist hier also wesentlich abhängig von den unterschiedlichen Gegenbegriffen, die in der Negation immer auch – sei es implizit, sei es explizit – mitaufgerufen sind.
Ausschlaggebend für die Semantik von trûren bleibt mithin das jeweils zugrundeliegende Verständnis von vreude als dessen konzeptionellem Gegenpol. Begriffsgeschichtlich einschneidend ist die »Ablösung der religiös bestimmten Literatur der frühmittelhochdeutschen Periode, deren vreude-Begriff erst für das Jenseits volle Erfüllung verhieß«12. Mit ihr »ändert sich die Auffassung von vreude grundlegend. Sie wird Ideal des Diesseits.« Zunächst markiert vreude allerdings vorrangig das individuelle Empfinden: Sie ist »das Bewußtwerden der neugewonnenen seelischen Differenzierungen und Reizempfindlichkeit«13, dass sich mit dem Aufkommen der frühhöfischen Laienkultur einstellt. Zu diesem Zeitpunkt ist vreude noch nicht »zum gesellschaftlichen Imperativ«14 erhoben, sondern meint »mehr gelebt[e] als prinzipiell zur Daseinsform erhoben[e] Gesamtstimmung«15. Entsprechend begegnen mhd. vrô und dessen Derivate vor allem im Zusammenhang mit spontanen Gefühlsäußerungen, etwa wenn König Philipp, der Vater Alexander des Großen, von der Zähmung des unbändigen Rosses Bucival erfährt: Der künec der spranc ûf sân, / und zehenzich sînes gesindes / er frowete sich sînis kindes (StrAl 382–384), oder wenn die entmutigten Soldaten in Alexanders Heer durch dessen Worte zu neuer Gefolgschaft bewogen werden: zehant si ûf sprungen,/ frôlîchen si sungen (StrAl 4180f.). »Freude bedeutet [hier] eine welt- und schicksalbejahende kraftbewußte Gefühlshaltung, die das charakteristische Merkmal des ritterlichen Menschen ist.«16
Mit der Herausbildung einer genuin adligen Laienkultur beginnt auch der vreude-Begriff sich auszudifferenzieren. In der Minnelyrik steht vreude meist im Zusammenhang mit einer (etwa im Hohen Sang) erhofften17 oder (etwa im Tagelied) tatsächlich realisierten Liebesbegegnung. Insofern vreude hier vor allem mit erotischem Glück gleichgesetzt wird, steht sie in Spannung zur höfischen Öffentlichkeit und vollzieht sich in der Regel unterhalb deren Wahrnehmungsschwelle, als heimliche oder tougen minne (MF 3,12).18 Im scharfen Gegensatz dazu ist der vreude-Begriff der zeitgleich entstehenden höfischen Romane fast notwendig an höfische Öffentlichkeit gebunden, begegnet vreude hier doch vornehmlich im Kontext höfischer Geselligkeitspraktiken. Paradgimatisch hierfür kann der ›Eneasroman‹ Heinrichs von Veldeke stehen, der – so KORN – wie kein Text vor ihm »eine klare Trennungslinie zwischen dem individuellen Gefühlsleben des Einzelnen und dem standesgebundenen Kollektivfühlen der ritterlichen Gesellschaft insgesamt«19 ziehe. Höfische vreude als Festfreude meint nun nicht mehr die emotionale Befindlichkeit des Einzelnen, »ist überhaupt nicht eine Summe, sondern ist die Freude einer Gruppenperson, ist die Freude Aller als einer Einheit.« Der Kollektivkörper ›Hof‹ definiert sich über die spezifisch höfische ›Haltung‹ der vreude. Die gesellschaftliche Forderung nach kollektiver vreude reiche nun so weit, »daß die Persönlichkeit als Einzelwesen mit ihrem privaten Leid im Banne der allgemeinen Festhochstimmung einfach ausgelöscht wird, daß es da nur noch Standesgemeinschaft gibt. […] [N]ichts darf den Märchenzauber der festlichen Wonne im geringsten stören.«20
Ähnlich beschreibt Jan-Dirk MÜLLER, mit Bezug auf den ›Frauendienst‹ Ulrichs von Liechtenstein, vreude als »Ausdruck adeligen Selbstwertgefühls«21. Dieses Selbstwertgefühl sei, so MÜLLER,
»weniger an vorgegebene oder zugeschriebene Qualitäten (Geburt, Besitz, Macht) gebunden als von bestimmten Interaktionsformen abhängig, zu denen der edel jung verpflichtet ist. […] Freude ist zugleich Bedingung und Ergebnis sozialer Anerkennung, setzt insofern Gelingen höfischer Gemeinschaft voraus. Dies meint eine Form des Umgangs miteinander, […] die subjektive Stimmungen zurückstellt, sich an den Erwartungen des anderen orientiert (Reflexivität), in Gruß und Gespräch dem anderen sein Selbstgefühl bestätigt und es ihm durch die höfische Selbstdarstellung der eigenen Person – in kostbaren Kleidern, edlen Gebärden, Schmuck – zurückspiegelt.«
Entscheidend ist, dass vreude ständisch exklusiv codiert ist. In dieser Hinsicht erscheint vreude weniger als emotionale Disposition denn als »Verhaltensnorm«22, die den Umgang der in den Inklusionsbereich der höfischen Gesellschaft einbezogenen Individuen untereinander regelt: sit vro, minnet ho: / so mügt ir lop gewinnen (UvLFr 38 II, 4f.). Das setzt Distanz »zu momentanen Affekten, Interessen, Machtpositionen« voraus und sichert, indem »im Inneren ernsthafte Auseinandersetzungen« ausgeschlossen werden, »die Solidarität des Standes (u.a. auch seine Abgrenzung nach ›unten‹) auch angesichts fortbestehender Machtkonkurrenzen«23. Vreude hat, wer zum Hof gehört, wie umgekehrt zum Hof nur gehören kann, wer vrô ist. Die Diskrepanz zwischen ›Freude‹ als kontingentem, individualpsychologischem Affekt und vreude als Ausdruck gelungener höfischer Vergesellschaftung tritt besonders deutlich in Heinrichs von Neustadt ›Apollonius von Tyrland‹ hervor, wenn der Erzähler über einen ritterlichen Turnierteilnehmer bemerkt: Der werde und der mere / Was ain wittewere. / Im stunt sein müt in freuden ho (ApT 17640–17643). Eine »gewisse, allerdings unfreiwillige Komik«24 mag der Stelle innewohnen, dies aber nur für den modernen Leser, der die hier beschriebenen begriffsgeschichtlichen Unterscheidungen gerade nicht berücksichtigt.
Einem solchermaßen gewendeten Begriff von vreude eignet eine inhärente Zeitlichkeit insofern, als er an das höfische Fest als temporale Einheit gebunden ist. Dem Krönungsfest von Dodone in Ulrichs von Zatzikhoven ›Lanzelet‹ wird die exzeptionell lange Dauer25 von über drei Monaten zugesprochen (vgl. La 9252). Das Ende der Feierlichkeiten kommt abrupt: Ein Bote erscheint und teilt König Artus mit, dass er zu Hause nicht mehr abkömmlich sei: er en moht niht langer bîten, / wan im von heim ein bote kam, / der im seit, des ich niht vernam (La 9274–9276). Der Inhalt der Botennachricht wird nicht genannt, und zwar explizit nicht (des ich niht vernam): Offenbar kommt es nicht darauf an, warum Artus gehen muss, worin also der konkrete Anlass seiner Abreise liegt, sondern allein darauf, dass das Fest zwangsläufig ein Ende findet. Dementsprechend müssen auch die Damen auf Dodone einsehen (oder vielmehr: sich damit abfinden – wenen, La 9277), dass nach der Zeit freudiger Hochstimmung in Anwesenheit des Artusgefolges nun notwendig wieder Trauer und Wehmut (als Abwesenheit von vreude) in ihre Herzen einziehen: Dô begunden sich di vrouwen wenen, / daz trûren und muotsenen /an daz herze muose gân (L 9277–9279).26 Höfische Festfreude hat ihre eigene Zeit, zum Guten wie zum Schlechten.27
Vreude in diesem Sinne meint also keinen überzeitlichen, geschweige universalanthropologischen Sachverhalt, sondern vielmehr ein spezifisches historisches Konzept, dass ohne den Hintergrund der feudalen Adelskultur des ausgehenden 12. Jahrhunderts kaum zu begreifen wäre. Als solches setzt vreude Unterscheidbarkeit notwendig voraus, und zwar sowohl soziale (höfisch-adelig vs. unhöfisch, ›bäuerisch‹), räumliche (der Hof als Ort der vreude vs. die unzivilisierte, hofferne Wildnis) und zeitliche Unterscheidbarkeit (das höfische Fest als Zeit der vreude vs. die Zeit des trûrens). Sind diese Bedingungen nicht mehr gegeben, verliert auch vreude ihre Differenzqualität, ja, hört überhaupt auf, vreude zu sein. Es liegt nahe, hier einen Zusammenhang zu den bereits angedeuteten mythomorphen Entdifferenzierungsphänomenen zu sehen, die für die Joie-de-la-curt-Episode doch so prägend sind. Um diesen Zusammenhang zu erhellen, wird die Analyse bei der räumlichen Organisation des Textes ansetzen, aber immer wieder auch die dem Raum »verschwisterten Elemente[ ]« der Erzählung »wie Zeit, Erzählerperspektive, Figur und Handlungsfolge«28 in den Blick nehmen. Nach diesem ersten Durchgang, der ein besonderes Augenmerk auf die mythosanalogen und nicht-differentiellen Strukturmerkmale des Textes legen wird, ist sodann das Deutungsangebot in Betracht zu ziehen, welches Hartmann selbst in Form des metadiegetischen Berichtes Mabonagrins seinen Rezipienten unterbreitet. Auf diese Weise soll gezeigt werden, wie der Text dergestalt am zeitgenössischen Minnediskurs mitarbeitet, dass er unter Verwendung mythischer Motive und Strukturlogiken (›Arbeit mit dem Mythos‹) einen Fall konstruiert, bei dem die Minne die binäre Unterscheidung von ›Höfischem‹ und ›Unhöfischem‹ zuletzt kollabieren lässt. Während bisherige ›Erec‹-Interpretationen die Biographie Mabonagrins zumeist in ihrem Bezug zu Erecs eigenem Lebensweg – insbesondere zu dessen Krise auf Karnant – gesehen haben, geht es mir vor allem darum, die Joie de la curt als höfisch-kollektive ›Identitätskrise‹ zu beschreiben, als Krise, die sich nicht zuletzt in der Desintegration der räumlichen und sozialen Strukturen der erzählten Welt niederschlägt. Das Ende der vreude auf Brandigan wäre dann als Ausdruck eben dieser krisenhaften Erfahrung zu verstehen.