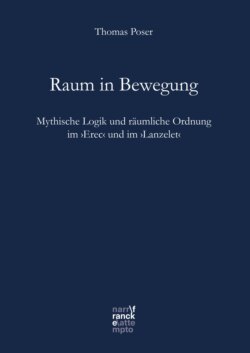Читать книгу Raum in Bewegung - Thomas Poser - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Präsenz des Mythos? Zum Stand der aktuellen mediävistischen Mythosforschung
ОглавлениеDas von Gerhard PLUMPE bereits Mitte der 1970er Jahren konstatierte »Interesse am Mythos«1 in den Geisteswisenschaften ist ungebrochen, ja, es scheint, vom Standpunkt der gegenwärtigen Diskussion aus besehen, zum Beginn des 21. Jahrhunderts hin gerade erst seine eigentliche Blüte zu erleben.2 Für die germanistische Mediävistik war es vor allem der von Udo FRIEDRICH und Bruno QUAST herausgegebene Band ›Präsenz des Mythos. Konfigurationen einer Denkform in Mittelalter und Früher Neuzeit‹3, der die Debatte 2004 erneut und umso nachhaltiger entfachte. Das erklärte Ziel des Bandes war es, den »Blick auf das Mittelalter als eine monolithisch christliche und damit antimythische Kultur«, wie er sich im mediävistischen Diskurs bis dato verfestigt hatte, dahingehend zurechtzurücken, dass man »die Geschichte der mittelalterlichen Literatur stärker als bisher nicht zuletzt als eine Geschichte der Arbeit am Mythischen«4 zu beschreiben versuchte. Damit einher ging eine grundlegende und in der Folge äußerst produktive Umakzentuierung des Mythos-Begriffes: Während insbesondere die ältere Forschung, sofern sie interessiert war an ›mythischen‹ Spuren in den Literaturen des Mittelalters, damit in erster Linie auf bestimmte Motivtraditionen im Sinne der sog. ›niederen Mythologie‹5 abhob – gekennzeichnet etwa durch ein spezifisches Figureninventar mit Zwergen, Riesen, Feen, (Halb-)Göttern und anderen (Misch-)Wesen6 –, so richtete sich der Fokus nun auf die großen philosophischen und anthropologischen Theorieentwürfe des 20. Jahrhunderts: Ausgehend von den Arbeiten etwa Ernst CASSIRERs7, Claude LÉVI-STRAUSS’8, Hans BLUMENBERGs9 oder auch Jan ASSMANNs10 versuchte man nun, Mythisches nicht mehr – oder nicht mehr nur – anhand inhaltlicher Kriterien zu bestimmen, sondern auch und vor allem über strukturelle und funktionale Merkmale greifbar zu machen. Mythos als Struktur oder, wie schon im Titel des Bandes programmatisch vorgegeben war, Mythos als ›Denkform‹ hießen mithin die neuen Leitbegriffe, »Raum und Zeit, Identität und Kausalität, Lebenswelt und Kosmos«11 nur die wichtigsten ihrer epistemologischen Kategorien.
Die Stoßrichtung des Bandes hat in der Folge eine ganze Reihe von Detailuntersuchungen, Sammelbänden und umfassenderen Monographien angeregt, die mit diesem auf die formale Seite der sprachlichen Äußerung zielenden Verständnis von ›Mythos‹ ein Instrumentarium erkannte, um sich der spezifischen Verfasstheit vormodernen Erzählens, seiner historischen ›Alterität‹12, aber auch den dahinter vermuteten mentalitätsgeschichtlichen Dispositionen anzunähern. Wenn es zutrifft, dass der Mythos-Begriff gerade aus seiner definitorischen Unschärfe heraus das ihm eigene Faszinationspotential gewinnt,13 dann verwundert es aber kaum, dass insbesondere die recht spezifische Begriffsverwendung, auf die die Beiträger sich zu verständigen suchten, bisweilen auch auf Zurückhaltung, wenn nicht Ablehnung gestoßen ist.14 Das Wirkpotential des Bandes hat diese Kritik, die ihm ein grundlegend anderes Mythos-Verständnis entgegensetzte, freilich weniger berührt als solche Ansätze, die die durch ihn angestoßene Diskussion gleichsam von innen heraus, durch die Aufdeckung ihrer unreflektierten epistemischen und diskursgeschichtlichen Prämissen nämlich, hinterfragten.15
So nimmt etwa Florian KRAGL explizit Bezug auf den Mythosbegriff des FRIEDRICH/QUAST-Bandes und stellt dabei vor allem – und nicht unbegründet – den vorschnellen Kurzschluss von Denk- und Erzählformen in Frage, den er in der gegenwärtigen Debatte beobachtet:
»Würde […] in der Tat – wie es die kulturwissenschaftliche Forschung will – im mittelalterlichen Erzählen eine kognitive Struktur sichtbar, die wir Heutigen als akausal wahrnehmen, die aber vor vielleicht 800 Jahren gewissermaßen das argumentative comme il faut war? In einer Sozietät, die sich – schnell hingesagt – noch schwer tat mit komplexen logischen Denkfolgen? Weil das mythische Denken eben nicht nur das mittelalterliche Erzählen, sondern auch die Kognition der mittelalterlichen Menschen betrifft?«16
In einem doppelten Durchgang durch den ›Lanzelet‹ Ulrichs von Zatzikhoven versucht KRAGL sodann zu zeigen, dass »Mythisches und Logisches« als dichotomes Begriffspaar weder diachron verschiedene ›Denkformen‹, noch »Qualitäten von Narrativen« oder gar »Essenzen einer Erzählung« bezeichnen, sondern vielmehr »Wahrnehmungsstrategien, mit denen ein und derselbe Text gelesen werden« (S. 31) könne (und zwar prinzipiell jeder moderne wie mittelalterliche Text gleichermaßen, ungeachtet aller Historisierungsversuche – KRAGL spricht deshalb auch von einer »Simultaneität von Mythos und Logos«[S. 30]). »Mythos – das wäre« demnach
»ein Erzählblick, der radikal auf das Handlungsgerüst fokussiert, ohne auf dessen motivationale Verknüpfung im Sinne rational-kausallogischer Operationen Acht zu haben. In dem Moment, wo alle feingliedrigen Motivationsgelenke einer Handlung ausgeblendet sind, muss das rohe Handlungsgerüst sich selbst tragen. Gerade dieses ›So-ist-es‹, das Aktion neben Aktion stellt, sie hintereinander reiht, macht den mythischen Lektüretypus aus. […] Logos hingegen, das wäre ein rationaler Lektüretypus, wie er […] vor allem in Erzählerreflexionen und Figurenreden manifest ist. Hier ist der Blick nicht auf das Grobkörnige des Handlungsgerüsts, sondern auf die Details der motivationalen Struktur eingeschärft: auf die Verknüpfungen feiner Handlungsfäden« (S. 29).
Die Grenzen dieser radikalen Umdeutung von ›Mythizität‹ von einer Beschreibungskategorie für Textmerkmale hin zu einer Beschreibungskategorie für Rezeptionsweisen werden freilich schnell deutlich, wenn man die Metapher konsequent zu Ende denkt, die KRAGL selbst heranzieht, um seine Sichtweise zu veranschaulichen. Er vergleicht den Text nämlich mit einem digitalen Bild, das sich »aus einer bestimmten Anzahl von Bildpunkten, Pixeln« (S. 35) zusammensetzt und bei dem es vom jeweiligen Betrachter, bzw. der jeweiligen Betrachtungsweise, abhänge, ob es nun schärfer oder grobkörniger erscheine. Dass sich jedes hochauflösende Bild mit nur wenigen Beobachtungseinstellungen, etwa durch das Herabsetzen der Bildschirmauflösung am Endgerät, in ein unschärferes Bild überführen lässt (ähnlich, wie auch jede kausallogisch schlüssig motivierte Erzählung ›mythisch‹ gelesen werden kann, wenn man eben nur auf »das rohe Handlungsgerüst« fokussiert), ist dabei ebenso einsichtig wie der Umstand, dass dies in umgekehrter Richtung gerade nicht möglich ist: Wenn die Bilddatei von vorneherein eine zu geringe Datenmenge aufweist, ist es ungleich schwieriger, sie auf dem Bildschirm scharf erscheinen zu lassen, dann jedenfalls, wenn das fehlende Datenmaterial nicht – im Sinne digitaler Bildrekonstruktion – erst nachträglich ergänzt werden soll.
Zurückübertragen auf den Bereich historischer Erzählformen ist es aber doch gerade dieser letzte Fall, bei dem die Mythostheorie im Ausgang von Ernst CASSIRER als narratologische Heuristik ihren eigentlichen Mehrwert gewinnt. Gerade wenn die Motivationsstruktur eines Textes zu wenig Daten für eine kausallogisch stringente Lesart bietet, erlaubt es eine mythostheoretisch gewendete Lektüre eben doch, ein konsistentes Textmodell zu entwickeln, ohne sich einerseits also vorgreiflich auf abqualifizierende Werturteile einlassen oder andererseits etwas in den Text ›hineinlesen‹ zu müssen, was dort nicht steht.17 Dabei ist KRAGL zweifellos zuzustimmen, dass die Frage nach der ›Mythizität‹ eines Textes nicht zuletzt auch eine Frage nach dessen Pragmatik ist, danach also, ob er als ›mythisch‹ gelesen wird/wurde (bzw. werden kann) oder eben nicht.18 Doch was Andreas KABLITZ über Fiktionalität (gleichermaßen eine textpragmatische Kategorie!) bemerkt, dass nämlich das, was eigentlich Rezipientendisposition ist, sich zu einer Text-›Eigenschaft‹ verdichten kann, wenn es zutrifft, »dass [ein Text] keine andere Form der Rezeption zulässt als eben diejenige eines fiktionalen Textes«19, gilt in ähnlicher Weise auch für das Problem der Mythizität. Auch KRAGL gesteht immerhin ein, dass es »Texte geben [dürfte], die das eine oder das andere« – mythische Wirkung oder logisches Verstehen – »erleichtern«20, und allein in diesem Sinne, als Stimulus einer bestimmten – kulturell und historisch bedingten – Rezeptionshaltung (und nicht etwa ›essenzialistisch‹), ist es zu verstehen, wenn im Folgenden von ›mythischem Erzählen‹ die Rede ist: Mythizität als Texteigenschaft, »die zunächst in nichts anderem besteht als im [ich möchte ergänzen: weitgehenden] Ausschluss anderweitiger Möglichkeiten der Rezeption«21. Man wird KRAGL beipflichten wollen, dass Texte niemandem verbieten können, »grob zu lesen/hören oder genau nachzudenken«22. Doch rechtfertigt dies keineswegs, kausallogische Motivationstrukturen dort hineinzuprojizieren, wo diese offenkundig – wie so oft in älteren Erzähltexten – fehlen. Dem deutenden Zugriff des Interpreten sind eben doch, sofern sein Vorgehen als methodisch kontrolliert gelten soll, durch die ›lineare Manifestation des Textes‹ Grenzen gesetzt (um eine begriffliche Anleihe bei der Rezeptionssemiotik Umberto ECOs zu nehmen).23 Hier hat sich aber gezeigt, dass eine historische Narratologie, die sich an den Beschreibungskategorien der Mythosforschung orientiert, durchaus neue gangbare Wege eröffnen kann.
Kritischer noch als KRAGL hat sich zuletzt Bent GEBERT positioniert.24 Da er sich besonders einlässlich mit dem gegenwärtigen Stand der Debatte auseinandersetzt, verdienen auch seine Überlegungen im Folgenden eine ausführlichere Würdigung. Anhand dreier Fallbeispiele versucht GEBERT aufzuzeigen, wie in der aktuellen Diskussion einerseits eine »Pluralisierung von Begriffsverwendungen« (S. 57) zu beobachten sei, die den Mythosbegriff zu einem fast ubiquitären Schlagwort gerinnen lasse, andererseits sich aber »einige seiner Verwendungsweisen normativ verfestigen« (S. 21), ohne dass dabei deren methodische und terminologische Voraussetzungen – ihr diskursgeschichtlicher ›Ballast‹, wenn man so möchte – hinreichend reflektiert würden. Dadurch komme es, so GEBERT, zu »Kontrollprobleme[n]« (S. 57), die ihrerseits »Verzerrungen von Objekten und Beobachtungssituationen« mit sich führten. In dem Bemühen, diese »unkontrollierten Paradoxien« der gegenwärtigen Mythosforschung offenzulegen, liegt die erklärte Absicht seiner Analyse (S. 24). Die Untersuchungen, auf die er sich bezieht (von denen zwei bezeichnenderweise von Beiträgern des FRIEDRICH/QUAST-Bandes stammen)25, werden dazu ›gegen den Strich‹ gelesen, um so verborgene Schichten aufzudecken, die der Intention ihres jeweiligen Autors zuwiderlaufen und so die Konsistenz der Argumentation womöglich grundsätzlich in Frage stellen.
Nun hat die konstruktivistische Wissenschaftstheorie gezeigt, dass jede Theoriebildung – wie überhaupt jeder Erkenntnisgewinn – eine vorgängige Konstruktionsleistung bedingt.26 Es scheint generell nicht allzu schwierig, dasjenige, was zunächst ›konstruiert‹ wurde, in einem zweiten Schritt auch wieder zu ›dekonstruieren‹: Selbst das augenscheinlich stabilste Theoriegebäude lässt sich mit nur wenigen Handgriffen demontieren. GEBERTs Argumentation erzielt aber dadurch ein ausgesprochen hohes Reflexionsniveau, dass er im Zuge seiner ›Dekonstruktionsarbeit‹ das notwendige konstruktivistische Moment einer jeden Theoriebildung nicht etwa ausblendet, sondern in sein Kalkül miteinbezieht. So ist er sich durchaus bewusst, dass Beobachtung ohne ›blinde Flecken‹, ohne Paradoxien überhaupt nicht möglich ist, ja, dass diese vielmehr sogar »zu den Normalbedingungen für jedes Beobachten« (S. 32) gehören. Indem er bei seinem dekonstruktivistischen Vorgehen den konstruktivistischen Aspekt einer jeden theoriebasierten Forschung mitreflektiert, gewinnen seine Ausführungen eine argumentative Kraft, die sie selbst bis zu einem gewissen Grad gegenüber kritischen Einwänden immunisiert.
Selbstverständlich verlangt auch eine solchermaßen konstruktivistisch gewendete Methodologie, die den emphatischen Wahrheitsbegriff zugunsten des Konzepts der ›Viabilität‹ verabschiedet hat,27 zumindest ein konsistentes und in sich widerspruchsfreies Theoriegebäude, auch und gerade wenn sie die Möglichkeit eines unmittelbaren objektiven Zugriffs auf Wirklichkeit in Frage stellt. Vor diesem Hintergrund erscheint GEBERTs Vorwurf der ›Unschärfe‹ durchaus als gewichtig – wenn er denn tatsächlich zutrifft. Seine Ausführungen scheinen mir in dieser Hinsicht zumindest teilweise korrekturbedürftig.
Das betrifft zum einen den Vorwurf, dass die mediävistische Mythosforschung die Kategorien ›Raum‹ und ›Zeit‹ als »essentiell für ›mythisches‹ Denken« (S. 34) ansehen würde, wo CASSIRER ihnen doch alleine deshalb so großen Gewicht beimesse, weil sie schon in Immanuel KANTs Transzendetalphilosophie (auf die sich CASSIRER als Neukantianter wesentlich bezieht) als »Grundbegriffe der Erkenntnis«28 vorgegeben seien. Indem die Literurwissenschaft, die nun ihrerseits CASSIRER rezipiert, dessen Schwerpunktsetzungen übernehme, ohne deren »philosophiegeschichtlichen Voraussetzungen‹ offenzulegen, würde sie diese »als kontingente Theorieoptionen« (S. 33) festschreiben, andere Optionen dagegen vorschnell ausschließen. Hier verkehrt GEBERT aber die Perspektive: Die gegenwärtige mediävistische Mythosforschung hat die Kategorien Raum und Zeit nicht unreflektiert von CASSIRER übernommen, sie gehören vielmehr schon längstens zum grundlegenden Handwerkszeug der Erzähltextforschung (die knappe Skizze der LOTMANschen Erzähltheorie zu Beginn meiner Ausführungen dürfte das bereits in aller Kürze verdeutlicht haben) – länger jedenfalls, als dass man CASSIRER für sich entdeckt hat. Umgekehrt ist es gerade der Umstand, dass CASSIRER ihnen so viel Raum gibt – aus welchen Gründen auch immer –, der seine Überlegungen überhaupt erst für die Narratologie interessant und anschlussfähig macht. Dass es daneben gewiss noch andere Theorieoptionen gibt – und wer würde das bestreiten –, mindert ihren heuristischen Wert in diesem Zusammenhang nicht im Geringsten.
Die zweite kritische Nachfrage betrifft GEBERTs Versuch, unterschiedliche Formen der mythostheoretischen Modellbildung herauszupräparieren und gegeneinander auszuspielen, die ihm zufolge das gegenwärtige Feld der Forschung bestimmen. So unterscheidet er »formorientierte[ ] Analysekonzept[e]« (S. 26–36, hier S. 26) von sog. ›Rationalitätsmodellen‹ (S. 36–47) einerseits, die »Mythos im Begriffsrahmen von polaren Ordnungskategorien (S. 38) nach dem Schema ›Mythos‹/›Logos‹ verorten, und sog. ›Varianzmodellen‹ im Anschluss an Hans BLUMENBERG andererseits (S. 48–56). Wenn er aber zu dem Schluss kommt, dass diese Modelle »ihrem Theoriebau nach inkompatibel [seien,] zumindest aber andere Stoßrichtungen verfolgen« (S. 35), dann beansprucht er die Systematik doch sehr. So wirft er etwa Jan-Dirk MÜLLER Kontrollprobleme vor, wenn er das formale Mythosmodell mit »Konzepten des irrationalen Mythos, von denen sich CASSIRERs Bemühen um Mythos als Denkform gerade programmatisch absetzte« (S. 36), in Verbindung bringt.29 Dabei blendet GEBERT allerdings aus, dass auch CASSIRER seine Begriffe fast durchweg an ›polaren Ordnungskategorien‹ festmacht, indem er z.B. »die Zeitbetrachtung des Mythos« von einem »geschichtliche[n] Zeitbewußtsein«30 unterscheidet oder das Prinzip der Konkreszenz31 in Abgrenzung zum »wissenschaftlichen Denken« bzw. zur »wissenschaftlichen Erkenntnis«32 zu profilieren sucht. Dies wird allein schon in CASSIRERs Vorliebe für syntaktische Konstruktionen mit adversativer Subjunktion sichtbar, mittels derer er die unterschiedlichen Formen des Weltzugangs kontrastiv gegenüberstellt:
»Während das begriffliche Kausalurteil das Geschehen in konstante Elemente zerlegt […], genügt dem mythischen Vorstellen […] das Bild des einfachen Ablaufs des Geschehens selbst«33; »Während die begrifflich-kausale Auffassung in ihrer Darstellung der Lebensvorgänge das Gesamtgeschehen im Organismus in einzeln charakteristische Tätigkeiten und Leistungen auseinanderlegt, gelangt die mythische Ansicht zu keiner derartigen Sonderung in Elementarprozesse«34 usw.
Damit erscheint auch bei CASSIRER der Mythos nicht »als ausdrücklich ›unvernünftiger‹, irrationaler Diskurstyp, wohl aber im Kontrast zur Ordnung eines beobachteten Diskurses« (S. 39), wie dies für die Rationalitätsmodelle des Mythos charakteristisch sei. Bezeichnenderweise kommt auch GEBERT nicht umhin, explizit auf »Cassirers Differenz von ›mythischem‹ und ›rationalem‹ Denken« (S. 32) hinzuweisen und damit eine Nähe von Rationalitäts- und formalen Modellen zu suggerieren, die ihm doch nur wenig später als inkompatibel gelten. Möglicherweise ist es GEBERTs eigener Differenzierungs- und Systematisierungswille, der ihm hier nun seinerseits Kontrollprobleme bereitet. Jedenfalls scheint mir der Vorwurf des methodischen Eklektizismus, den er mehrfach an die von ihm besprochenen Untersuchungen heranträgt (vgl. etwa S. 35f., 46, 51f.), vor diesem Hintergrund nicht gerechtfertigt.
Der dritte Kritikpunkt betrifft gleichfalls GEBERTs Skepsis gegenüber der operativen Verfahrensweise der Rationalitätsmodelle und ist in seiner Art vermutlich der grundsätzlichste. Wenn GEBERT moniert, dass durch die Unterscheidung »von irrationalem Mythos und rationaler Vernunft« der einen Seite dieser Unterscheidung, derjenigen der Rationalität nämlich, »normative[r] Status« (S. 24) zugeschrieben würde, dann stellt er sich damit in die lange und ehrbare Tradition der Teleologiekritik, die sich insbesondere gegen Verlaufsmodelle des Musters ›Vom Mythos zum Logos‹ richtet, wie sie in der Philosophiegeschichte des 19. Jahrhunderts entwickelt und populär gemacht wurden.35 Dabei verdeckt aber eine allzu vorsichtige Haltung gegenüber solchen Verlaufsmodellen nicht nur leicht, dass nicht jede Entwicklung auch notwendig eine teleologische ist;36 es entsteht zudem bisweilen der Eindruck, dass die offen zur Schau gestellte Alarmbereitschaft37 nicht zuletzt über latente Teleologien innerhalb des eigenen Standpunktes hinwegtäuschen soll. Denn selbstverständlich rangiert auch ein – durch und durch ›rationaler‹ – Vorstoß wie derjenige GEBERTs – auch und gerade in dem Bemühen zu differenzieren, zu systematisieren, verborgene Widersprüche, Paradoxien, ›Kontrollprobleme‹ offenzulegen und überhaupt ›Ordnung‹ zu schaffen – auf einer und eben nur einer Seite der Unterscheidung Mythos/Logos bzw. Mythos/ratio (wenn man diese Unterscheidung einmal probehalber für ›gesetzt‹ ansehen möchte). Mit einem solchen Vorgehen aber begibt man sich auf ein schwieriges Feld: Entweder läuft man Gefahr, sofern man Ernst macht mit dem Anspruch, jede normative Zuschreibung zu vermeiden, damit auch die eigene Position dem Vorwurf epistemologischer Beliebigkeit preiszugeben, oder aber man setzt sich selbst dem Teleologieverdacht aus.
Der bewährte Ausweg in solchen Fällen scheint darin zu liegen, dass man die Unterscheidung von ›Mythos‹ und ›Logos‹ generell in Frage stellt oder den Mythos selbst kurzerhand, wie einst Hans BLUMENBERG, zu einem »Stück hochkarätiger Arbeit des Logos«38 erklärt. Ob man dem folgen möchte, hängt nicht allein vom je eigenen Mythosverständnis ab, sondern zunächst auch und vor allem davon, was mit ›Logos‹ gemeint sein soll. Wenn der Begriff im allgemeinsten Sinne auf das grundlegende geistige Vermögen des Menschen, seine kognitive Grundausstattung, wenn man so möchte, abzielt, dann sind ›Mythos‹ und ›Logos‹ mit Sicherheit keine Gegenbegriffe (und nicht einmal die radikalsten Vertreter des ›Verlaufsmodells‹ würden das wohl in dieser Form behaupten wollen). Die kognitive Disposition in archaischen, vorliterarischen Kulturen, die man in aller Regel als Träger des Mythos identifiziert, unterscheidet sich nicht grundlegend von derjenigen in moderneren, schrift- und technologiegestützen Kulturformationen.39 Wenn dennoch zwischen diesen und jenen Unterschiede in den jeweiligen Denkstrukturen zu beobachten sind, dann dürfte das weniger mit veränderten Verstandesvermögen zu tun haben als mit veränderten Umweltbedingungen, auf die die kognitiven Prozesse jeweils entsprechend reagieren (wobei mit ›Umwelt‹ hier auch die selbstgestaltete Nahumwelt des Menschen, seine Kultur also, mitgemeint ist).40 Sofern man logos bzw. ratio allerdings nicht in diesem Sinne versteht, als allgemeine kognitive Disposition des Menschen, sondern vielmehr als eine historisch-spezifische Disziplinierung derselben, die vor allem mit der Ideengeschichte des abendländischen Kulturraums in Verbindung zu bringen wäre, dann gibt es m.E. auch keinen Anlass, die Unterscheidung von ›Mythos‹ und ›Logos‹ fallenzulassen, ja, dann spricht auch nichts dagegen, mit Udo FRIEDRICH und Bruno QUAST ›Mythos‹ als »das Andere der Vernunft«41 zu konzeptualisieren, von dem man sich in der europäischen Geistesgeschichte immer wieder auch programmatisch abzugrenzen versuchte.
Statt also den Zugang der ›Rationalitätsmodelle‹ generell zu verabschieden, scheint es mir zielführender, im Anschluss an die Beiträge des FRIEDRICH/QUAST-Bandes von einem Modell auszugehen, das 1.) nicht bestrebt ist, »den notwendig fremdartigen Charakter des Mythos zum Verschwinden«42 zu bringen, sondern den Unterschied von ›Mythos‹ und ›Logos‹ als solchen anerkennt; das 2.) diese Dichotomie freilich nicht als kontradiktorischen, sondern als graduellen Gegensatz begreift, in dem Sinne, dass immer auch Mythisches im Logischen und Logisches im Mythischen präsent sein kann;43 und das 3.) den Umstand, dass man in der heutigen abendländischen Gesellschaft kaum öffentlich einen Analogiezauber praktizieren kann, ohne mindestens die irritierten Blicke der Passanten zu provozieren, als Ergebnis eines historischen Prozesses und nicht etwa als entelechische Notwendigkeit auffasst (›Mythos‹ als Vorstufe, ›Logos‹ als deren Telos).
Damit ließe sich mindestens ein Teil der von GEBERT angesprochenen Unschärfen wenn nicht beseitigen, so doch zumindest methodisch in den Griff bekommen. Denn tatsächlich sind diese Unschärfen weniger konzeptionellen Schwächen im Theoriedesign geschuldet, als dass sie ihren Ursprung auf der Objektebene selbst haben, auf der Objektebene freilich – und wie könnte es anders sein –, wie sie qua Theoriedesign als solche allererst (mit-)konstituiert wird. Denn wenn die Unterscheidung ›Mythos‹/›Logos‹ einmal eingeführt ist, gilt es stets, die eine Seite der Unterscheidung von der anderen aus zu beobachten, oder anders gesagt: wissenschaftlich-rational zu erfassen, was qua Definition selbst gerade nicht wissenschaftlich-rational funktioniert. Das muss notwendig Paradoxien und Unschärfen produzieren, doch sind diese dann gewissermaßen von der theoretischen Konzeption her vorgesehen. Das Problem ist dann aber kein konzeptionelles, sondern ein rein forschungspragmatisches, und als solchem sollte man ihm auch begegnen: indem man sich beispielsweise nur auf bestimmte Teilaspekte des komplexen Sachverhaltes ›Mythos‹ bezieht, ohne damit ausschließen zu wollen, dass daneben noch eine Vielzahl anderer, teils auch gegenläufiger Zugänge denkbar sind, die aber den Erkenntniswert der eigenen Perspektive nicht im Geringsten schmälern.44
Unter diesen Vorzeichen halte ich es durchaus für gerechtfertigt, an dem einmal eingeschlagenen Weg grundsätzlich festzuhalten.45 Das schließt freilich Kurskorrekturen und Akzentverschiebungen dort, wo sie mir angebracht scheinen, nicht aus. Vor allem betrifft dies die starke Orientierung des gegenwärtigen Diskurses an der Varianz- oder Rezeptionstheorie des Mythos, wie sie von Hans BLUMENBERG entwickelt wurde. Ulrich HOFFMANN weist zu Recht darauf hin, dass es vor allem »die pragmatische Dimension des Mythos [sei], die notwendig für seine Bestimmung [sei] und ihm erst seinen ›Sitz im Leben‹«46 zuweise. Doch gerade in diesem Belang, der Frage nach der Einbettung in je spezifische Kommunikations- und Funktionszusammenhänge, birgt BLUMENBERGs Ansatz – auf den auch HOFFMANN sich in weiten Teilen beruft – die Gefahr, wichtige Differenzierungen zu überdecken, wenn der Mythos als »immer schon in Rezeption übergegangen«47 begriffen wird. Hier lohnt es sich, noch einmal mit einigen grundlegenderen Überlegungen zum Verhältnis von mythischem und literarischem Erzählen anzusetzen.