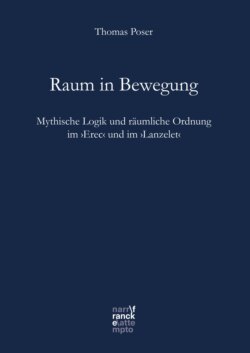Читать книгу Raum in Bewegung - Thomas Poser - Страница 13
1.4.2 Zur Textauswahl
ОглавлениеIm Zentrum stehen zwei höfische Erzähltexte, genauer: zwei Artusromane, von denen einer mindestens, der ›Erec‹ Hartmanns zu Aue (vgl. Kapitel 2), ohne Zweifel zu den meistbeachteten Texten des deutschsprachigen Mittelalterts überhaupt gehört. Für das hier skizzierte Vorhaben bietet er sich – trotz aller bisherigen Verdienste, die die Forschung um den Text schon erbracht hat – vor allem deshalb an, weil er zugleich den Beginn der deutschen Artustradition markiert. »Literarische Texte stehen« immer, wie Jan-Dirk MÜLLER bemerkt, »in einem doppelten Bezug, einmal auf die literarische Gattung, der sie angehören, zum anderen auf die Alltagswelt, in der sie wirken sollen«1. Für die hier avisierte Frage nach historischen Text-Kontext-Beziehungen ist es daher naheliegend, tendenziell ›frühe‹ Texte zu behandeln, denn umso weiter sich die »literarische Reihe in […] Distanz zu den zeitgenössischen kulturellen Vorgaben« begibt, umso mehr tritt der Kontextbezug gegenüber dem Gattungsbezug, das Durchspielen von »in einer historischen Kultur gegebenen Problemvorgaben«2 gegenüber der Variation von Gattungsmustern in den Hintergrund. Darüber hinaus stellt das Modell auch Antworten zu noch weitgehend ungelösten Problemen der ›Erec‹-Forschung in Aussicht, wie etwa die in der Forschung eher stiefmütterlich behandelte Frage nach den Gründen der Freudlosigkeit am Hofe Königs Ivreins (vgl. hierzu Kapitel 2.1).
Der zweite Text hat erst in den letzten Jahren zunehmend Beachtung gefunden, seit er durch Florian KRAGLs Edition (La, La1) auch für ein breiteres Publikum erschlossen worden ist: Gemeint ist Ulrichs von Zatzikhoven ›Lanzelet‹ (vgl. Kapitel 3). Gattungsgeschichtlich befindet sich der Text »in einem merkwürdigen Zustand des ›Dazwischen‹«3– als »›verfrühte[r]‹ Spätling«4 hat man ihn bezeichnet. Auffällig ist vor allem die motivische Nähe zum Artusroman Chrétien-Hartmannscher Prägung – auch und gerade, was den Bestand an Motiven mythischer Provenienz betrifft – bei gleichzeitig unverkennbarer konzeptioneller Distanz (beides scheint mir eher für eine Frühdatierung zu sprechen). Wenn man die beiden Texte aufeinander bezogen hat, dann vor allem unter dem Aspekt textgenetischer Abhängigkeitsverhältnisse.5 Dagegen fehlen solche Untersuchungen weitgehend, die versuchen, die – zweifellos vorhandenen – intertextuellen Verweisstrukturen für die Textinterpretation fruchtbar zu machen. Hier lohnt es sich anzusetzen und das Augenmerk vor allem darauf zu richten, wie die Texte jeweils ›mit dem Mythos‹ arbeiten, um dasselbe historische Bezugsproblem – die Vereinbarkeit von Minne und höfischer Ordnung – doch jeweils unterschiedlich zu narrativieren.
Angestrebt sind keine neuen Gesamtinterpretationen der beiden Texte. Vielmehr soll der Fokus auf zwei einzelnen Episoden liegen, bei denen nicht nur die angesprochenen intertextuellen Relationen besonders deutlich herovortreten, sondern die auch jeweils auf ihre Weise zentral sind für die Handlungs- und Sinnkonstitution ihres Textes: die Joie-de-la-curt-Episode des ›Erec‹ einerseits, die ›Dodone‹-Episode des ›Lanzelet‹ andererseits. Die Entscheidung, sich solchermaßen zu beschränken, ermöglicht, den Ansatz bis auf die Ebene des Wortlauts und bis in einzelne Formulierungen hinein zu verfolgen, statt mit bloßen Handlungsabstraktionen zu operieren. Damit soll eine Gegenposition eingenommen werden insbesondere zur älteren Artusforschung, die im Anschluss an Hugo KUHNs wegweisendem ›Erec‹-Aufsatz6 eben vor allem an den großen, handlungsübergreifenden Sinnzusammenhängen der Texte interessiert war. Gleichwohl werde auch ich versuchen, die Detailbeobachtungen im Anschluss an die jeweiligen Analysen zu kontextualisieren, um so einen Ausblick zu geben, wie eine Gesamtdeutung von dieser Warte aus zumindest aussehen könnte (vgl. Kapitel 2.2.7 resp. 3.2.8). Der enge Vergleich von ›Erec‹ und ›Lanzelet‹ verspricht dabei, »die Besonderheit des einzelnen Werkes« ebenso hervortreten zu lassen wie dessen »kollektive[ ], nicht-individuellen Anteile«7, um so eine größere Einsicht sowohl in die Faktur der einzelnen Texte, aber auch in die Funktionsweise der Gattung ›Artusroman‹ als solche zu gewinnen.
Der letzte Abschnitt des Buches wird die Ergebnisse bündeln (vgl. Kapitel 4.1), um den Blick dann mit dem ›Prosalancelot‹ zuletzt doch auch auf die spätere Artustradition zu richten und so die Fragestellung in die diachrone Perspektive zu öffnen (vgl. Kapitel 4.2). Der Text steht dabei in zweifacher Relation zu den beiden vorherigen Beispielen: Einerseits beruht er auf demselben Stoff wie Ulrichs ›Lanzelet‹, wenn auch in völlig eigenständiger Bearbeitung (eine textgenetische Verbindung zu Ulrichs Text bzw. zu dessen – verlorener – Vorlage ist nicht auszumachen; beide Texte repräsentieren unabhängige Traditionen der Lancelot-Sage); andererseits kann, wo Hartmanns ›Erec‹ den Anfang der deutschen Artusliteratur vertritt, der ›Prosalancelot‹ – genauer: dessen letzter Teil, ›Der Tod des Königs Artus‹ – symbolisch für deren Ende stehen, wird doch von nicht weniger als dem Untergang der gesamten arthurischen Welt berichtet. Freilich kann eine solche nur ausblickshafte Darstellung der Komplexität des Werkes nicht gerecht werden – hier heißt es, pragmatisch zu verfahren: Ich werde mich alleine auf den Schluss des Textes, den titelgebenden Tod König Artus’ und den anschließenden moniage der überlebenden Artusritter konzentrieren und versuchen, die Textbeobachtungen konsequent auf die Ergebnisse der vorangegangenen Studien zu beziehen. Die Frage lautet dann, wie der Text, der sich als »Endzeit-Summe arthurischen Erzählens«8 versteht, dieses Ende gerade in Hinblick auf den skizzierten Zusammenhang von mythischer Strukturlogik, räumlicher Ordnung und höfischer Identität inszeniert.
Zunächst folgen aber noch zwei weitere kurze Textanalysen, die zusammen mit den Überlegungen zum ›Prosalancelot‹ eine Art Rahmen um die beiden Großkapitel zu ›Erec‹ und ›Lanzelet‹ bilden. Sie dienen vor allem der methodischen Kontrolle und beziehen sich jeweils auf Texte, die nicht in das engere Umfeld der Artusdichtung gehören. Das erste Beispiel, das ›Nibelungenlied‹, soll den Ansatz für die Heldenepik erproben und veranschaulichen, dass der postulierte Zusammenhang von mythosanalogen Erzählweisen und kultureller Selbstreflexion nicht allein Sache der Artusdichtung ist (vgl. Kapitel 1.5). Die Beobachtungen werden auf die zahlreichen schon erbrachten Erkenntnisse der Forschung zurückgreifen können und versuchen, diese auf die skizzierte Fragestellung hin zu perspektivieren. Wenn sie dabei auch einen eigenen Beitrag zum Verständnis des Epos leisten, dann insofern sie einen Punkt aufzeigen, an dem vielleicht neue Überlegungen zum Verhältnis von Helden- und Artusepik ansetzen könnten.9 Denn es scheint mir nach wie vor weitgehend ungeklärt, wie ein und dasselbe Publikum so gegensätzliche Texte wie den ›Erec‹ und das ‹Nibelungenlied‹ gleichermaßen goutieren konnte10 – allenfalls als »Kontrastmodell«11 hat man diesen auf jenen zu beziehen vermocht. Hier eröffnet der vorliegende Ansatz eine neue Perspektive, stellt er doch immerhin so etwas wie den ›kleinsten gemeinsamen Nenner‹ beider Texte in Aussicht.
Wo das Beispiel des ›Nibelungenliedes‹ dazu dienen soll, den Blick zu weiten, wähle ich den ›Herzog Ernst B‹, um gewissermaßen gegenzusteuern und zu zeigen, dass nicht alle Formen narrativer Ambivalenz auch als ›mythisch‹ zu bezeichnen sind (vgl. Kapitel 1.6). Wenn auch die Welt des ›Herzog Ernst B‹, mit ihren Erdrandvölkern und Mischwesen, für den modernen Leser nicht weniger phantastisch anmutet als die Welt des Artusromans, so kann doch plausibel gemacht werden, dass die narrative Sinnkonstitution hier genuin anderen Regeln folgt: ›Ambivalenz‹ entsteht hier nicht so sehr durch mythische Entdifferenzierung als vielmehr durch axiologische Pluralisierung. Die Kontrastfolie des ›Herzog Ernst B‹ verspricht, dem Konzept des ›mythischen‹ Erzählens mehr Prägnanz zu verleihen und so zu verhindern, dass der Begriff beliebig wird.
Zwei auf den ersten Blick naheliegende Textbeispiele werde ich zwar immer wieder vergleichend heranziehen, ihnen aber bewusst keine eigenen Kapitel widmen: Hartmanns ›Iwein‹ und Wolframs von Eschenbach ›Parzival‹. Denn anders als bei den ausgewählten Beispielen, steht in beiden Texten nicht so sehr das Verhältnis von höfischer Sphäre und außerhöfischer Aventiurewelt als deren strukturellem Gegenteil im Vordergrund denn vielmehr die Verdoppelung des jeweiligen handlongslogischen und/oder ideellen Zentrums der erzählten Welt: Artushof und Laudinereich im ›Iwein‹, Artushof und Gralsbereich im ›Parzival‹.12 Zwar können die einzelnen Raumsegmente auch hier deutlich mythisches Gepräge tragen, doch Entdifferenzierungseffekte, die die Makrostruktur der erzählten Welt als Ganzes beträfen, bleiben aus.13 Entsprechend weniger wird hier die basale Leitunterscheidung ›höfisch‹/›unhöfisch‹ verhandelt, als dass sich das Geschehen aus den aporetischen Ansprüchen entwickelt, mit denen die divergierenden Machtzentren jeweils dem Helden begegnen.14 In dieser Hinsicht bearbeiten ›Parzival‹ und ›Iwein‹ die um 1200 so virulente Frage nach höfischer Identität – bzw. nach der Identität des Höfischen – in je noch einmal anderer Weise.15