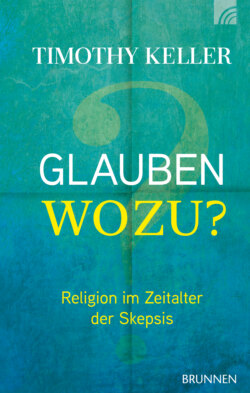Читать книгу Glauben wozu? - Timothy Keller - Страница 24
Das christliche Vermächtnis
ОглавлениеLuc Ferry zeichnet in seinem Buch A Brief History of Thought („eine kurze Geistesgeschichte“) nach, wie der christliche Glaube wuchs und die klassische griechisch-römische Kultur und das heidnische Denken im Westen verdrängte.37 Ein Grund dafür war, dass „das Christentum der Welt die Ideen gab, die … viele moderne ethische Systeme für ihre eigenen Zwecke übernahmen“38. Eine davon war die Gleichwertigkeit (equality) aller Menschen. Griechisches Denken beruhte „gänzlich auf der Überzeugung von einer natürlichen Hierarchie … Manche Menschen waren geboren, um zu herrschen, andere um zu gehorchen“, aber „das Christentum sollte im direkten Gegensatz den Gedanken einführen, dass die Menschen grundlegend gleich an Würde waren – ein bis dahin völlig unbekannter Gedanke, dem unsere Welt ihr ganzes demokratisches Erbe verdankt.“39 Max Horkheimer schreibt, dass das griechische Denken nur eine begrenzte Demokratie kannte, die nur für die Hochgeborenen und Gebildeten galt, während der biblische Gedanke der Ebenbildlichkeit und der Sühne für alle Menschen der westlichen Idee des Wertes des Individuums unermesslichen Auftrieb gab.40
Der christliche Glaube lieferte nicht nur einen allgemeinen Gleichheitsgedanken, sondern auch die Mittel für ein Verständnis „natürlicher“ Menschenrechte. Von wem kommt denn die Idee, dass ein Mensch „Rechte“ habe, die nicht vom Staat gewährt würden, sondern sogar ihm gegenüber eingefordert werden könnten? Woher kam der Gedanke, dass es Dinge gibt, die jedem Menschen zustehen, egal welcher Ausbildung, Fähigkeiten oder sozialen Schicht, einfach nur, weil er Mensch ist? Gemeinhin werden die Menschenrechte als Produkt des modernen Säkularismus gegen religiöse Unterdrückung angesehen. Doch in Wahrheit entstand dieses Konzept im Westen, nicht im Osten, und nicht erst im Zuge der Aufklärung, sondern im christlichen Mittelalter. Wie Horkheimer in den 1940er-Jahren und Martin Luther King in den 1960ern aufzeigten, baute die Idee der Menschenrechte auf dem biblischen Gedanken auf, dass alle Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind.41
Außerdem brachte das Christentum im Gegensatz zum antiken Denken eine positive Sicht des Leibes und der Gefühle. Peter Brown erklärt uns in seinem bahnbrechenden Werk The Body and Society, dass sich die herrschenden Klassen in der griechisch-römischen Welt „die Seele als Herrscher über den Leib vorstellten … mit der gleichen Autorität wie der wohlgeborene Mann über die Niedrigergestellten und ihm Fremden“42. Antike Heiden glaubten, dass Geist und Verstand (die in der Seele wohnten) den „fremden“ Leib mit seinen Gefühlen beherrschen sollten. Die Bibel ist anders: Sie sieht Leib und Seele gleichermaßen als gut (geschaffen), aber von Sünde beeinträchtigt an.43 Der große menschliche Kampf findet nicht zwischen Geist und Leib statt, sondern in unseren Herzen, „dem verborgenen Kern des Ich, das den Willen und die väterliche Liebe Gottes annehmen oder ablehnen kann“44.
Das Christentum sah das Ringen um menschliche Tugend also nicht mehr als einen Kampf zwischen Kopf und Herz (mit dem Ziel, rationaler zu werden) oder Geist und Materie (mit dem Ziel, die Welt technisch besser zu beherrschen). Das Ringen ging nun darum, worauf man sein Herz richtet – auf Gott und seinen Nächsten, egal wer er ist? Oder auf Macht und Wohlstand für sich und seine Sippe?45 Augustinus war der Erste, der dies so formulierte. Nach Henry Chadwick, Historiker in Cambridge, prägte Augustinus damit „eine Epoche in der Geschichte menschlichen moralischen Bewusstseins“.46 Zum ersten Mal war das oberste Lebensziel nicht Selbstbeherrschung und Rationalität, sondern Liebe. Liebe war nötig, um eine Person von Selbstbezogenheit zu befreien und auf den Dienst an Gott und anderen Menschen auszurichten. Augustinus’ Bekenntnisse schufen die Grundlage für das, was wir Psychologie nennen würden – in einer Weise, wie es nichtchristliches Denken nicht vermocht hätte.47 Das vorige Denken, dass der Leib schlecht und die Seele gut ist – also die Gefühle, die im Körper wohnen, schlecht und der Verstand gut – veränderte sich mit dem Christentum.
Diese neue Sichtweise von der Bedeutung des Leibes und der materiellen Welt legte den Grundstein für das Aufkommen moderner Wissenschaft. Die materielle Welt wurde nicht länger als Illusion gesehen (oder etwas, das sich einfach nicht spirituell transzendieren ließ). Sie war auch nicht einfach ein unverständliches Geheimnis, sondern nach der Bibel die Schöpfung eines persönlichen, rationalen Wesens. Deshalb konnten andere persönliche, rationale Wesen sie erforschen und verstehen.48
Das Christentum brachte eine allgemeine Vorstellung von der Bedeutung des Einzelnen mit sich, die es vorher nicht gegeben hatte. Luc Ferry schreibt: „Für den Buddhisten ist das Individuum nur eine Illusion, die der Auflösung anheimfallen wird; für den [griechischen] Stoiker wird das individuelle Ich in der Totalität des Kosmos aufgehen. Christlicher Glaube verheißt dagegen die Unsterblichkeit der einzelnen Person; seine Seele, sein Leib, sein Gesicht, seine geliebte Stimme – wenn er durch Gottes Gnade gerettet ist.“49 Das Christentum untergrub auch das Elitedenken der Antike: „Erlösung“ hatte für Griechen mit philosophischer Besinnung zu tun, was nur Menschen mit Bildung und freier Zeit möglich war. Doch für Christen kam das Heil durch den vertrauenden Glauben, dass Jesus für sie das getan hatte, was sie nicht tun konnten. Das war für jeden möglich. Insofern war der christliche Glaube sehr viel egalitärer (Gleichheit betonend) als andere Denkrichtungen in der Antike.