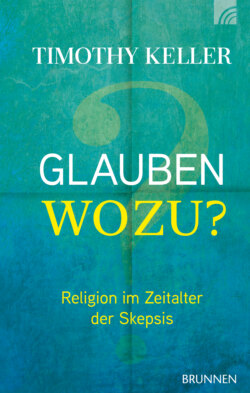Читать книгу Glauben wozu? - Timothy Keller - Страница 25
Nietzsche und der Atheismus
ОглавлениеDie moralischen Werte der westlich-liberalen, säkularen Kultur (z. B. die Bedeutung des Individuums, Gleichheit, Menschenrechte, Liebe, Kampf gegen Armut und das Ziel, die materiellen Bedingungen für jedermann zu verbessern) kamen also aus dem jüdisch-christlichen Denken, wie viele Forscher historisch gut belegt haben. Nun könnte man sagen: Na und? Wir können doch die moralischen Werte behalten, auch wenn wir nicht mehr an Gott oder die Bibel glauben. Wo ist das Problem?
Es gibt eine ganze Reihe von Problemen. Dieses „Paket“ von christlichen Moralvorstellungen ergibt Sinn in einem in hohem Maße persönlich gedachten Universum. Das Johannesevangelium war revolutionär, indem es Jesus Christus den logos nannte – worunter die griechischen Philosophen die übernatürliche Ordnung hinter dem Kosmos verstanden. Für die Griechen war es „irrsinnig“, die „universelle kosmische Ordnung“ mit einem einzelnen Menschen gleichzusetzen.50 Doch für Christen wurde die Welt damit radikal „personalisiert“. Nun verstand man die Macht, die hinter der Welt stand, zum ersten Mal als Liebe, als einen persönlichen Gott.51 Die Lehre von der Inkarnation (dass Gott Mensch wurde) hatte „einen unkalkulierbaren Effekt auf die Geistesgeschichte“, indem sie den Menschen auf die höchstmögliche Ebene erhob. Ohne sie hätte „die Philosophie der Menschenrechte, der wir uns heute verschreiben, niemals … entstehen können“.52
Im antiken Denken war die höchste Macht entweder Platons unpersönliche „Idee von Gott“ oder ein göttliches Wesen, dessen „bestimmendes Merkmal die apatheia war“ („Apathie“, ohne Leidenschaften). In solch einer Welt war eine Gesellschaft sinnvoll, die auf Kriegsethik, Stoizismus und Respekt vor Stärke, Hierarchie und Macht aufgebaut war.53 Überzeugungen von menschlichem Wert, Gleichheit und Liebe für Schwächere konnten nur in einer Gesellschaft entstehen, die an ein Universum mit einem persönlichen Gott glaubte, der alle geschaffen hatte, um mit ihm in liebevoller Gemeinschaft zu leben. Der moderne Säkularismus hat diese moralischen Ideale weitgehend übernommen, ohne die Sicht eines personalen Universums beizubehalten, die solche Ideale ganz natürlich hervorbrachte und verständlich machte.54
Niemand hat dies klarer gesehen als Nietzsche. Seine große Erkenntnis war einfach: Wenn es keinen Gott und keinen übernatürlichen Bereich gibt und diese Welt alles ist, dann gibt es keine Perspektive, die höher ist als das Leben selbst. Es gibt keine transzendente Wirklichkeit jenseits dieses Lebens, die als Maßstab dafür dienen kann, was an der Welt richtig und was falsch ist. Kein Standpunkt der Welt ist so bevorzugt, dass er nicht Teil des Machtgeflechts wäre, das allem zugrunde liegt. Unsere moralischen Bewertungen entspringen beispielsweise einem menschlichen Gehirn, das in einer bestimmten Kultur arbeitet und zwangsläufig nur auf begrenzte menschliche Erfahrungen zurückgreift. Warum sollte unser Hirn über andere Gehirne, Kulturen und Erfahrungen richten? Einfach einen Teil der Wirklichkeit herauszugreifen und als „gut“ zu erheben über anderes, was wir „schlecht“ nennen, ist ein willkürlicher Akt.55 So schreibt Nietzsche: „Urtheile, Werturtheile über das Leben, für oder wider, können zuletzt [letztlich] niemals wahr sein.“56
Der Literaturkritiker Terry Eagleton schreibt:
Nietzsche sieht, dass die [westliche] Zivilisation dabei ist, das Göttliche abzustoßen, während sie weiter an religiösen Werten festhält. Diesen ungeheuerlichen Akt schlechten Glaubens will er nicht kritiklos durchgehen lassen … Unsere Vorstellungen von Wahrheit, Tugend, Identität, Autonomie und kohärenter Geschichte haben alle tiefsitzende theologische Wurzeln.“57
Nach Nietzsche hält man an christlichen Vorstellungen fest, wenn man an allgemeine Menschenrechte und den Einsatz für alle Schwachen und Armen glaubt, auch wenn man es nicht zugeben will und nicht mehr an Gott glaubt.58 Warum sollte man etwa Liebe und Aggression – beides Teil des Lebens, in unserer menschlichen Natur verwurzelt – unterschiedlich ansehen und eins als gut und das andere als schlecht bewerten? Wenn es keinen Gott oder übernatürlichen Bereich gibt, dann gibt es auch keinen solchen Wertemaßstab.
Nietzsches Kritik am säkularen Humanismus hat nie eine echte Antwort erhalten. In einer Bemerkung zu den Werken von George Eliot sieht er voraus, dass die englischsprachige Welt den Glauben an Gott aufzugeben versuchen wird, doch die Werte von Mitgefühl, weltweiter Wohltätigkeit und Gewissensfreiheit beibehalten wird. Doch er sagt voraus, dass in Gesellschaften, die Gott zurückweisen, die Moral selbst zum „Problem“ werden wird.59 Es wird immer schwerer werden, Moral zu begründen; Menschen werden selbstbezogener werden und nur noch durch Zwang gesteuert werden können. In Jenseits von Gut und Böse macht er sich über die Philosophie der Utilitaristen lustig, die Menschenrechte und Barmherzigkeit schlicht als praktische Weisheit ansehen – den besten Weg, um „das größte Wohl für die größte Anzahl“ zu fördern –, und fragt, wie man selbstloses Verhalten mit egoistischer Motivation erzeugen will.60 Es wird nicht funktionieren; das Reden von Rechten wird einfach der Weg der Mächtigen sein, an der Macht zu bleiben.
Nicht dass es keine Antworten auf Nietzsches Kritik gegeben hätte. Der Juraprofessor Ronald Dworkin besteht vielleicht am nachdrücklichsten darauf, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, trotzdem an „die unabhängige Realität von … Sinn und Werten“ glauben können.61 Doch Dworkin vergrämte viele mit seiner These, dass der Glaube an humanistische Werte ein religiöser Akt sei. Tatsächlich bekannte er einen Glauben an „etwas über die Natur hinaus“, das die Quelle von Schönheit und Moral ist und „nicht durch physikalische Gesetze erfasst werden kann, selbst wenn man schließlich die letzten Grundlagen erforschen würde“.62 Damit widerlegt er also nicht wirklich die Herausforderung Nietzsches, sondern bestätigt den deutschen Philosophen eher: Wenn säkulare Denker menschliche Würde, Rechte und Verantwortung bekräftigen, um menschliches Leid zu mindern, dann glauben sie tatsächlich an eine Art übernatürliche, transzendente Wirklichkeit.
Humanistische Überzeugungen, die von den meisten säkularen Menschen geteilt werden, sollten also als das angesehen werden, was sie sind: Glaubenssätze. Sie lassen sich nicht logisch oder empirisch allein aus der natürlichen, materialistischen Welt ableiten. Wenn es keine transzendente Realität über dieses Leben hinaus gibt, dann hat nichts einen Wert oder eine Bedeutung.63 Daran festzuhalten, dass Menschen reines Produkt evolutionärer Prozesse sind, in denen der Starke den Schwachen frisst, und dann darauf zu bestehen, dass trotzdem jeder Mensch eine Würde hat, die in Ehren gehalten werden soll, ist ein enormer Glaubenssprung gegen allen Anschein des Gegenteils.
Doch selbst Nietzsche kann seinem eigenen Skalpell nicht entfliehen. Er unterzog säkulare Liberale der vernichtenden Kritik, weil sie inkonsequent und feige seien. Er hielt den Aufruf zu sozialer Bindung und Wohltätigkeit für Arme und Schwache für „herdengleiche Uniformität, den Ruin des edlen Geistes und den Aufstieg der Massen“.64 Er wollte von dem „banalen Credo“ des modernen Liberalismus zurückgehen zur tragischen Kriegskultur der Antike und glaubte, dass der „Mann der Zukunft“ den Mut haben würde, in die Kälte eines Universums ohne Gott zu blicken und ohne religiösen Trost auszukommen. Der „Übermensch“ würde den „edlen Geist“ zur „herrlichen Selbstinszenierung“ haben, ohne von moralischen Maßstäben zurückgehalten zu werden, die irgendjemand anders ihm auferlegt.65
Diese Erklärungen Nietzsches stellen natürlich ein zutiefst moralisches Narrativ zusammen. Warum ist der „edle Geist“ edel? Warum ist es gut, mutig zu sein, und wer sagt das? Warum ist es schlecht, inkonsequent zu sein? Woher kommen solche moralischen Werte und mit welchem Recht belegt Nietzsche in seiner eigenen Philosophie die eine Lebensweise mit „edel“ oder „gut“ und andere als „schlecht“?66 Er tut also selbst, was er allen anderen verbietet.
So hat Nietzsches zukünftiger Übermensch Gott also keinesfalls abgeschafft, wie Eagleton bemerkt: „Wie der Allmächtige beruht er auf nichts als sich selbst.“ Wir sehen, dass es keinen wirklich unreligiösen Menschen gibt. Nietzsche fordert die Menschen dazu auf, sich selbst anzubeten und sich selbst den Glauben und die Autorität zuzusprechen, die früher Gott galt. Selbst Nietzsche glaubt: „Der autonome, selbstbestimmte Übermensch ist doch nur ein weiteres Stück nachgeäffter Theologie.“67
Wir haben gesehen, dass der säkulare Humanismus, den Nietzsche so verachtet, keine Grundlage für seine moralischen Werte hat (vgl. Kapitel 9 und 10). Doch die noch größeren Gefahren von Nietzsches Antihumanismus sind historisch belegt. Peter Watson beschreibt, wie sehr Nietzsches Ansichten die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts inspirierten, sowohl auf rechter Seite (Faschismus) wie auch auf linker Seite (Stalinismus).68