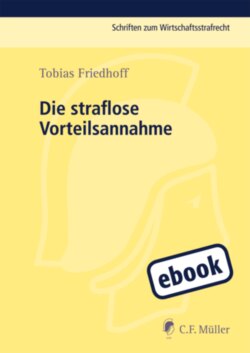Читать книгу Die straflose Vorteilsnahme - Tobias Friedhoff - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Die Systematik und Begründung des Gesetzesentwurfs
Оглавление21
Bereits am 25.5.1995, also mehr als zwei Jahre vor Verabschiedung des KorrBekG, wurde im Bundesrat durch das Land Berlin ein Gesetzesentwurf[35] für ein neues Korruptionsbekämpfungsgesetz eingebracht.[36] Durch den Gesetzesvorschlag sollte den Schwierigkeiten begegnet werden, „die sich daraus ergeben, daß im Bereich der Korruption verdeckt gehandelt wird und daß daher die Verfolgung und Überführung von Korruptionstätern besonders schwierig ist, weil die Strafverfolgung bislang den Nachweis sogenannter Unrechtsvereinbarungen erbringen muß“.[37] Bereits in der Zielsetzung des Gesetzes zeigte sich also, dass die Strafbarkeit des neuen § 331 StGB erheblich ausgeweitet werden sollte, wobei insbesondere das Merkmal der Unrechtsvereinbarung, also die Annahme eines Vorteils für eine zumindest bestimmbare Diensthandlung, als Ansatzpunkt für eine solche Ausweitung ausgemacht wurde, da dies bislang das Merkmal war, welches für die Strafverfolgungsbehörden besonders schwierig nachzuweisen war.
Der Tatbestand der Vorteilsannahme (und mit ihm auch der Tatbestand der Vorteilsgewährung) sollte grundlegend umgestaltet werden.
22
§ 331 StGB (BR-E) sollte nach dem Beschluss des Bundesrates[38] folgenden Wortlaut bekommen:[39]
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der im Zusammenhang mit seinem Amt für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ist der Vorteil eine Gegenleistung dafür, daß der Täter eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
(2) [40] […]
(3) Die Tat ist nicht nach Abs. 1 Satz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen läßt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.
23
§ 331 Abs. 1 StGB (BR-E) sollte folglich aus zwei Sätzen bestehen. Nach Abs. 1 S. 1 wäre der Täter bereits dann strafbar gewesen, wenn er „im Zusammenhang mit seinem Amt“ einen Vorteil angenommen hätte. Denn, so der Bundesrat, das Vertrauen der Bevölkerung in die Objektivität der Amtsführung und in die mangelnde Käuflichkeit von Amtsträgern werde bereits dann erschüttert, wenn bereits eine bloße Beziehung zwischen Vorteil und Diensthandlung bestehe und nicht erst dann, wenn die Diensthandlung eine Gegenleistung für den Vorteil darstelle.[41] Auch die Gewährung von Vorteilen, ohne dass bereits eine konkrete Diensthandlung ins Auge gefasst war, sollte hiervon erfasst werden.[42] Dass der Vorteil zumindest im Zusammenhang mit dem Amt angenommen werden musste, sollte verhindern, dass der Amtsträger strafrechtlich verfolgt wird, wenn er Zuwendungen annimmt, die er außerdienstlich erhält, z.B. private Zuwendungen.[43] Im Gegensatz zu § 331 Abs. 1 StGB (1974) war es also nicht mehr erforderlich, dass eine bereits zumindest in den Grundzügen erkennbare Diensthandlung vorlag, vielmehr wurde alles von § 331 Abs. 1 StGB (BR-E) erfasst, was nur irgendwie mit dem Amt oder der Amtsführung zusammenhing.[44]
Wurde ein Zusammenhang zwischen Vorteil und Diensthandlung dennoch nachgewiesen, so sah Abs. 1 S. 2 eine Strafschärfung vor.
In Abs. 3 sollte es zwar weiterhin die Möglichkeit einer strafbefreienden Genehmigung geben, diese sollte aber nur für die Fallgestaltung des Abs. 1 S. 1 gelten, wenn also noch kein konkreter Zusammenhang zwischen Vorteil und Diensthandlung zu erkennen war. Im Falle des Abs. 1 S. 2 sollte sie nicht möglich sein. Auch dies wäre eine deutliche Erweiterung der Strafbarkeit gegenüber § 331 Abs. 1, 3 StGB (1974) gewesen.