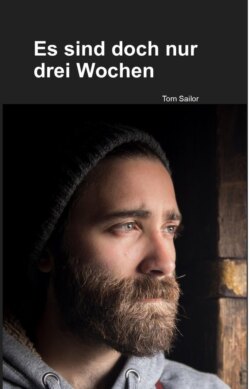Читать книгу Es sind doch nur drei Wochen - Tom Sailor - Страница 10
Eine Stadtrundfahrt
ОглавлениеDie tiefen Teppiche in den Fluren, abgestimmte Farben, blank poliertes Messing an den Fahrstuhltüren. Es erfordert viel Aufwand, um diesen Luxus ständig in Stand zu halten. Angesichts der großen Armut in diesem Lande beschleicht Erik ein leicht beschämtes Gefühl. »Auf der anderen Seite benötigt dieses Hotel sicher einige hundert Beschäftigte.«, beruhigt er seine Gedanken. »Durch das Geld, das ich hier ausgebe, finden Menschen Arbeit, die damit ihre Familien über Wasser halten können.« Erik besitzt die Einstellung, dass er grundsätzlich so leben möchte, dass er sich damit gut fühlt und sich keine Vorwürfe machen muss. Wenn er ungute Gefühle bei einer Sache hat, so lässt er es normalerweise bleiben. Dieser krasse Gegensatz zwischen Arm und Reich, zwischen luxuriösem Leben und dem Vegetieren auf der Straße empfindet Erik als unlösbaren Konflikt, der ihn moralisch belastet und ihn im Augenblick daran hindert, Indien positiv zu betrachten. Es liegt in der Natur des Menschen begründet, sich die Dinge so zurecht zu legen, dass man sich wieder als guter Mensch fühlen kann. Am bequemsten ist es doch, wenn man eine Argumentation gefunden hat, die es nicht erforderlich macht, etwas an dem eigenen Lebensstil ändern zu müssen. Eriks schlechtes Gewissen angesichts der extremen Gegensätze hat sich etwas beruhigt, als er das Argument gefunden hat, dass er nicht den Luxus genießt, sondern durch seine Anwesenheit dafür sorgt, dass das Überleben ganzer Familien gesichert wird.
Dazu gehört natürlich Trinkgeld. Erik tauscht daher für 50 Dollar ein Bündel indisches Geld bei dem Kassierer im Hotel. Er bekommt dafür einen riesigen Berg Papierscheine, aber keine Münzen. Die Menge ist so groß, dass er einen Teil davon auf das Zimmer zurückträgt. Dabei stellt er fest, dass auch das Geld unangenehm riecht. »Von wegen Geld stinkt nicht. Wer diesen Satz erfunden hat, war noch nie in Indien!«, murmelt Erik vor sich hin. Den Scheinen sieht man an, dass sie durch viele Hände gegangen sein müssen. Zum Teil sind sie gerissen und machen den Eindruck, als würden sie bald auseinanderfallen. Erik nimmt sich eine Handvoll Scheine und steckt sie sich in die Tasche seines Sakkos, bevor er das Zimmer wieder verlässt.
Um ein Taxi zu bekommen, läuft er zunächst vor die Tür und bittet den Portier, ihm ein Taxi zu bestellen. Der Hotelangestellte erklärt ihm allerdings, dass er dazu am Taxi-Desk ein Taxi bestellen muss. Erik ist etwas irritiert, da er in Sichtweite an der Einfahrt zum Hotel eine lange Schlange von Taxen sehen kann. Zurück in der Lobby geht Erik zum Taxi-Desk und trifft auf eine bildhübsche Inderin in ihrem Sari, die ihn erwartungsvoll anlächelt. Auf ihrem Namensschild kann er den Namen Aashiyana entziffern.
»Das klingt doch schon wie ein Versprechen aus 1000 und einer Nacht.«, denkt Erik.
»Hello, Sir, what can I do for you?”
Sie hat eine angenehme, weiche Stimme. Was auffällt ist, dass sie kaum den typischen indischen Akzent hat. Möglicherweise hat sie bereits im Ausland gearbeitet oder einfach ein exzellentes Sprachgefühl. Dazu einen schlanken, schönen Körper und sehr hübsche Gesichtszüge. Und dann diese Frage »What can I do for you?”. In Eriks Fantasie entwickeln sich Bilder, was sie so alles für ihn tun könnte. Irritiert stellt Erik dabei fest, dass er zwar noch nicht lange weg ist von Gaby, aber sich schon zum wiederholten Male überlegt, wie er Spaß mit anderen Frauen haben könnte. Man könnte meinen, »Hier sitzt die perfekte Frau, ohne eigene Bedürfnisse, deren höchstes Ziel darin besteht, alle Wünsche des Mannes zu erfüllen.«, überlegt Erik, wobei sich der nächste Gedanke gleich nachschiebt. Ihm wird darin klar, dass eine offene Unterhaltung zwischen gleichberechtigten Partnern wohl nicht zu erwarten ist. Erik befürchtet, dass die Frauen in diesem Land sicherlich in der klassisch unterwürfigen Frauenrolle erzogen werden. Dazu kommt noch die Sprachbarriere, die nur eine unvollkommene Kommunikation zulässt. Die kleinen Feinheiten, die den unterschwelligen Sinn vermitteln, lernt man erst nach einer langen Zeit. Im Ergebnis führt dies leicht zu vielen Missverständnissen und unnötigen Problemen.
»I like to book a taxi for a sightseeing tour”, erläutert Erik sein Anliegen.
»Okay, Sir, where do you want to go?”, fragt die hübsche, ständig lächelnde Inderin.
»Die Inder haben doch das Kamasutra erfunden.«, schießt es Erik durch den Kopf. »Ob das wohl allen Frauen hier beigebracht wird?« Sie sitzt immer noch freundlich lächelnd vor Erik und wartet auf eine Antwort.
»Do you have some maps or a tourist guide?”, fragt er nach.
»One minute, Sir”, antwortet sie, erhebt sich und geht einige Meter entfernt zu einer Auslage, aus der sie diverse Broschüren heraussucht. Sie kommt zurück, setzt sich wieder hinter ihren Tisch und breitet die Unterlagen vor Erik aus. Nach einem kurzen Blick in die Unterlagen hat Erik auf einige Sehenswürdigkeiten gezeigt und bittet die hübsche, junge Frau um ein Taxi.
»Why don’t you show me your city”, versucht er sie anzuflirten, wünscht sich aber sofort, dass er den Mund gehalten hätte.
»Diese blöde Anmache hört sie bestimmt hundertmal am Tag. Vielleicht ist es aber auch etwas, was ihr gefällt. Frauen beschweren sich schnell, wenn man sie anmacht, sind aber tot unglücklich, wenn es nicht passiert.«, philosophiert Erik vor sich hin. Irgendwie suchen Frauen immer nach dem Gegenteil von dem, was sie gerade bekommen. Wenn sie das bekommen, was sie bestellt haben, ohne dass der Andere erheblichen Aufwand damit hat, sind sie wohl deshalb unzufrieden, weil dieser geringe Aufwand einer Königin nicht gerecht wird. Nur wenn sie das Gefühl haben, dass der andere sich ein Bein ausreißt, bestätigt man damit seine Wertschätzung und Zuneigung. Frauen lieben es, hofiert zu werden und Macht über andere zu haben. Nur wer in der Lage ist, dieses Gefühl zu vermitteln, kann damit rechnen, dass die königliche Dame Gnade walten lässt und die Gabe annimmt. Für Erik erscheinen manche Frauen, als wären sie immer auf der Suche nach einer Parallelwelt, wenn sie ständig mit dem Unzufrieden sind, was sie haben. Seine philosophischen Gedanken werden von einem lächelnden Bellboy unterbrochen.
»Your Taxi, Sir«
Erik folgt ihm aus dem Hotel zu einem Taxi, das vor dem Haupteingang steht. Oh ja, natürlich, Trinkgeld. Der Bellboy hält seine Hand so geschickt, dass es wie eine Aufforderung einzusteigen aussieht, aber gleichzeitig die Handinnenseite zeigt, in die man etwas Geld legen kann.
Der Fahrer des Taxis trägt auch einen Turban auf dem Kopf. Erik hat gelesen, dass dies ein Markenzeichen der Sikhs ist. Die Sikhs treten zumeist mit einer höflichen Zurückhaltung auf, die man aber nicht als Unterwürfigkeit verstehen darf. Ihr Glaube entstand erst im 15. Jahrhundert und betont die Einheit der Schöpfung, die Abkehr von Aberglauben, religiösen Ritualen und sozialer Hierarchisierung entlang Religion, Herkunft und Geschlecht. Sie achten das Leben und meiden schädliche Lebensgewohnheiten wie Tabak, Alkohol und Drogen. Das ist sicher der Grund, warum sie bei Hofe vornehmlich als Leibgarde eingesetzt wurden. Auf jeden Fall hat diese Ehrhaltung bis heute überdauert. Wenn man einen Vertrag mit einem Sikh eingeht, wie es z. B. eine Fahrt im Taxi ist, dann wird ein Sikh mit seinem Leben dafür einstehen, dass man wohlbehalten am Ziel ankommt. Erik ist froh, dass er sich etwas Wissen angelesen hat, da mit einem Gefühl von Sicherheit ein solcher Ausflug doch gleich viel angenehmer wird.
»Where you go, Mr.?«, fragt der Fahrer.
»I like to make a sightseeing tour. Please show me some nice places in Delhi.«, erklärt Erik sein Anliegen.
»Yes, Sir, please, where you go?«, wiederholt der Fahrer höflich.
Erik stellt fest, dass die Diskussion mit Aashiyana bezüglich des Themas Sightseeing und der folgenden Kommunikationskette vollständig unter den Tisch gefallen ist. Es hat ihm also nur ein normales Taxi eingebracht. Jedes Zahnrädchen erfüllt nur seine klar definierte Aufgabe, scheint aber nicht das nächste Zahnrad anzutreiben. Jede Sonderlösung erfordert einen Manager, der sich darum kümmert. Eine Entscheidung für einen anderen zu treffen, bedeutet, dass man sich über ihn stellt. Ein Hotelangestellter würde sich nie anmaßen, für einen Gast eine Entscheidung zu treffen. Zum Glück hat Erik die Prospekte mitgenommen. Er zeigt auf ein imposantes Bauwerk und sein neuer Beschützer fährt los.
»Was für ein Luxus!«, denkt Erik, als er sich in dem klimatisierten Taxi nur zum Vergnügen durch die Stadt kutschieren lässt.
Erik lehnt sich entspannt auf die Rückbank, als das Taxi von der Lobby abfährt. In dem Moment, als es auf die Straße einbiegt, fährt Erik der Schreck in alle Glieder. Das Taxi beschleunigt, überquert die Fahrspur und ordnet sich auf der linken Straßenseite ein. Krampfhaft hält sich Erik in Erwartung des Aufpralls am Vordersitz fest. Aber nichts passiert. Die entgegenkommenden Autos fahren alle brav rechts an ihm vorbei. Mit der Müdigkeit und dem geringen Verkehrsaufkommen hatte er auf der Fahrt vom Flughafen nicht realisiert, dass in Indien natürlich Linksverkehr herrscht. Mit dem Adrenalin im Blut ist Erik jetzt allerdings hellwach.
Aus den Unterlagen lassen sich einige Details erfahren. »Neu Delhi« oder auch »New Delhi« ist die Hauptstadt Indiens, aber nur einen Teil der Megacity bezeichnet man als »Neu Delhi«. Dieser Teil bildet zusammen mit der Stadt Delhi eine urbane Einheit, meist werden beide Teile zusammen einfach nur Delhi genannt. Die erste Station ist das Regierungsviertel, das in der Nähe des Hotels liegt. Die Engländer bestimmten 1911, dass Indien eine neue Hauptstadt benötigt. Sie bauten zuerst ein weitläufiges Regierungsviertel auf dem flachen Land und die Stadt siedelte anschließend um dieses Viertel. Das Regierungsviertel hebt sich deutlich von der restlichen Stadt ab. Es gibt keine schmalen Gassen, keinen chaotischen Verkehr, keine schmutzigen Bettler am Straßenrand und keinen Müll. Es finden sich dagegen ausgedehnte, grüne Parks, breite Alleen und jede Menge Polizisten, die in regelmäßigen Abständen am Straßenrand stehen. Das ist eine Gegend, in der man vor der drückenden Enge tatsächlich etwas Luft holen kann. Kaum haben sie jedoch das Regierungsviertel durchquert, stecken sie wieder in einem stickigen, lärmenden Stau. Somit geht die Fahrt nur noch langsam und stockend weiter. Eine Zeitlang beobachtet Erik fasziniert das bunte, stickige, dreckige, laute Treiben rund um das Taxi, so dass ihn das langsame Vorankommen nicht besonders stört. Ein kochender Kessel, in den alles hineingeschüttet wurde, was die Welt zu bieten hat. Er hat selten so viele Gegensätze an einem Fleck gesehen. Eigentlich noch nie. Luxuswagen neben überladenen Fahrradrikschas, qualmende und laut hupende Lkws, die einen Menschen mit seiner Handkarre vor sich hertreiben, gut gekleidete Menschen, die in ihr Büro eilen neben zerlumpten Kindern, die jedem ihre mageren Hände entgegenstrecken, kleine Garküchen auf mobilen Karren neben einem Rinnstein, durch den eine schwarze, stinkende Brühe kriecht, farbenfrohe, flatternde Gewänder im indischen Stil neben westlich gekleideten Menschen mit Anzug und Krawatte, graue Bettler, die einfach nur am Boden liegen und die ausgemergelte Hand verzweifelt ausstrecken, vor einem hoch modernen Marmorpalast. Und über allem schwebt ständig dieser penetrante Gestank von verbranntem Müll und Fäulnis. Von Fahren kann nicht wirklich die Rede sein. Um das Taxi kämpfen sich hunderte mehr oder weniger verbeulte Wagen, hilflos überfüllte Busse, an denen Trauben von Menschen auch außerhalb der Türen hängen, knatternde Tuk-Tuks, und bedenklich überladene Lkws Meter für Meter vorwärts. Erik erkennt, dass das geplante Fahrtziel bei dem langsamen Vorwärtskommen wohl erst nach Stunden zu erreichen ist. Er versucht daher zunächst vom Fahrer zu erfahren, ob dieses Chaos so bleibt, oder ob es irgendwann zügiger gehen wird. Die Antworten waren allerdings so vielsagend, dass es ja, nein oder vielleicht bedeuten konnte. Nach einer weiteren halben Stunde, in der sie vielleicht gerade einmal drei Kilometer voran gekommen sind, beschließt Erik ein neues Fahrtziel. Aus den Prospekten erfährt Erik, dass der Connaught Place der zentralste Punkt und das Geschäftszentrum von Delhi ist. Hier schlägt das touristische Herz der Stadt, in dem auch westliche Waren angeboten werden.
»Please go to Connaught Place, Sir.«, dirigiert Erik seinen Fahrer in eine neue Richtung. Der Fahrer schaut Erik etwas irritiert an, erkennt aber, dass es wohl ernst gemeint ist. Er kann aber nicht viel ausrichten, da er bis zur nächsten Kreuzung dem Strom folgen muss. Alle Fahrzeuge ruckeln nur stückweise weiter. »Die Geschwindigkeit reicht nicht einmal für Schritttempo, wieso hängen dann so viele Menschen wie die Trauben an den Bussen?«, fragt sich Erik, als das Taxi sich gerade neben einem Bus befindet. Vielleicht ist es einfach eine Prestigefrage, dass man es sich leisten kann, mit dem Bus zu fahren. In einem unbedachten Moment kurbelt er kurz das Fenster auf, um es aber sofort wieder zu schließen. Die schwüle Luft ist von den Abgasen gesättigt und strebt sofort durch das offene Fenster, in dem Verlangen, möglichst jeden Raum mit vermeintlich halbwegs reiner Luft zu vernichten. Neben dem Gestank zehrt der andauernde Lärm an den Nerven. Indische Autofahrer hupen selbst im Dauerstau ständig. Die gern zitierte Gelassenheit des Inders kann Erik nur bei seinem Fahrer erkennen, wofür er sehr dankbar ist.
Erik hat den Eindruck, dass die Hupe von den Indern ausgiebig als Mittel zur Kommunikation eingesetzt wird. Vor jeder Aktion eines Autofahrers, sei es zum Bremsen, Anfahren oder Spurwechsel, wird als Warnung gehupt. Vermutlich begrenzt sich das Hupen aber nicht nur zur Warnung, sondern wird auch gerne und oft einfach nur so ausgeführt. Der Unterschied besteht in der Länge des Signals. Das »einfach-nur-so« Hupen ist nur kurz. Das Warnungshupen ist dagegen deutlich länger, meist über mehrere Sekunden. Auf der Rückseite eines Busses kann Erik in bunten Buchstaben »Horn please«, lesen. Auch auf LKWs und den kleinen Rikschas hat er diese Aufforderung gesehen. Erik wundert sich über diese Aufschrift, die fast zu jedem Fahrzeug gehört, wie der Außenspiegel. Erik beobachtet die äußerst rücksichtslose Fahrweise mancher Fahrer. Es wird zum Teil versucht, zwischen allen Fahrspuren zu wechseln, wobei nicht einmal die Gegenfahrbahn und die Wege für die Fußgänger ausgenommen werden. In den meisten Fällen ist dies aber nicht möglich, da entweder die Rinnsteine zu hoch sind oder auf den Gehwegen die kleinen Verkaufsstände stehen. Es kommt Erik wie ein Kampf um jeden Zentimeter vor.
Verwundert sieht Erik, wie zwar Fußgänger regelrecht gejagt werden, um eine Kuh, die auf der Straße liegt, jeder aber einen Bogen macht. Vermutlich gibt es kaum einen Anblick, der so typisch für Indien ist, wie das Bild streunender Kühe auf einer viel befahrenen Straße. Völlig unbeeindruckt von dem quirligen Verkehr stehen oder liegen sie mitten auf der Straße, so dass die Autos gezwungen sind, um sie herumzukurven. Zu Eriks Überraschung sieht er einen kleinen Trupp Inder, die gerade dabei sind, in einer Nebenstraße eine Kuh auf einen LKW zu zerren. Verwundert deutet Erik auf die Szene und fragt seinen Fahrer nach dem Grund. Seine Erklärung überrascht ihn.
Für die Hindus sind Kühe heilige Tiere. Es ist für einen gläubigen Hindu absolut verboten, diese Kühe zu schlachten. Das war Erik bekannt. Daher war er auch überrascht, dass hier eine Kuh gefangen wird. Der Fahrer erläutert Erik weiter, dass diese Kühe zwar heilig sind, aber nicht respektiert werden. Obwohl die Kühe überall herumlaufen dürfen, werden sie durch die Inder etwa so abschätzig betrachtet, wie wir Europäer auf die Tauben in unseren Städten reagieren. Mit der steten Entwicklung von Indien haben viele Einwohner die Geduld verloren. Die Tiere blockieren ständig die Straßen und sind der Grund für Staus und unzählige Unfälle. Dazu kommt, dass sie sich von dem Müll ernähren, indem sie die Behälter umtreten und den Inhalt auf den Straßen verteilen. Ihre Kuhfladen liegen zusätzlich überall herum und verschmutzen die Stadt. Ab und zu kommt es auch vor, dass ein Bulle seine Gelassenheit verliert, und randalierend durch die Straßen zieht. Dabei greift er Autos und Fußgänger an, wenn er sich von diesen gestört fühlt. Aus diesem Grund hat die Verwaltung in Delhi beschlossen, die Kühe einzufangen und aus der Stadt zu bringen. Dazu gibt es sogar ein höchstrichterliches Urteil, dass diese Kühe aus der Stadt zu entfernen sind. Bei dem Anblick der spitz auslaufenden Hörner erkennt Erik, dass diese Arbeit wohl nicht ganz ungefährlich ist. Der Fahrer erläutert weiter, dass nicht nur von den Tieren eine Gefahr ausgeht. Inder sind nicht so sanft, wie Europäer sich das vielleicht vorstellen. Es kommt häufig zu Schlägereien zwischen den Fängern und erbosten Autofahrern, weil aufgrund einer Fangmaßnahme eine Straße gesperrt wird, oder weil aufgebrachte, gläubige Hindus eingreifen, um die Kühe zu verteidigen und mit Stöcken und Steinen die Fänger angreifen.
Ein weiteres Problem stellen die illegalen Molkereien in der Stadt dar. Diese haben sich der herumstreunenden Kühe bemächtigt und verkaufen die Milch an die Bewohner der Armenviertel. Zu Beginn der Aktion hat die Stadt die gefangenen Kühe versteigert. Doch nachdem die Molkereien die Kühe ersteigerten und dann wieder laufen ließen, hat man sich entschlossen, diese in städtischen Ställen außerhalb von Delhi unterzubringen. Kurioserweise hat sich mittlerweile ein Wettkampf entwickelt, bei dem die illegalen Molkereien nun diese Tiere entführen und wieder in der Stadt frei lassen. Daher kommt es vor, dass die Fänger die gleichen Tiere mehrfach einfangen. Indien ist leider sehr korrupt, erläutert der Fahrer weiter. Die Besitzer der Molkereien bestechen irgendwelche Politiker, so dass ihnen die Kühe zum Teil zurückgegeben werden und es keine Anklagen gibt, wenn einer bei der Entführung erwischt wird. Nachdenklich lehnt sich Erik zurück und beobachtet das bunte Geschehen mit gemischten Gefühlen, das an seinem Fenster langsam vorbeizieht. Verwundert stellt er fest, wie sich das leicht romantische Bild, dass er noch vor einem Tag von der friedlichen Koexistenz zwischen Rind und Inder hatte, nun mit dieser Information verflüchtigt und von einem Bild der Korruption, Kampf und Gewinnsucht ersetzt wird.
Nach einer halben Stunde erläutert der Fahrer, dass sie am Ziel angekommen sind. Der Connaught Place ist zunächst nur als ein großer, überfüllter Kreisverkehr zu erkennen. Erik macht sich nun Sorgen, wie er von hier wieder zum Hotel kommen soll. Er muss es erreichen, dass das Taxi auf ihn wartet. Die Chance auf einen Parkplatz sieht aber äußerst schlecht aus. Der Verkehr quält sich mühselig vorwärts. Es ist kaum wahrscheinlich, dass genau vor ihnen ein Parkplatz frei wird. Für alle anderen Parklücken finden sich sofort Dutzende von Parkwilligen, so dass die Chance eines Lotteriegewinns wohl höher liegen dürfte.
»Can you park and wait?«, fragt er den Taxifahrer.
»No problem, Sir,« antwortet dieser.
»Von wegen no problem,« murmelt Erik leise zu sich selbst bei einem Blick auf die überfüllten Straßen. Den nun folgenden organisierten Ablauf der Parkplatzsuche, oder eher Zuteilung, verfolgt Erik dann jedoch hochgradig erstaunt. Der Taxifahrer kurbelt das Fenster herunter und spricht einen Inder am Straßenrand an. In den Augen von Erik war es irgendein Passant. Doch der Passant stößt daraufhin einen schrillen Pfiff aus und wendet sich wenige Sekunden später an den Taxifahrer, um ihm etwas zu erklären. Nachdem sie sich etwa 20 Meter in der Runde um den Platz weiter bewegt haben, sieht Erik, wie ein Fahrzeug genau vor ihnen aus einer Parklücke fährt. Sofort will sich ein anderes Fahrzeug dort hineinbegeben, doch augenblicklich springt diesem ein Inder in den Weg und fordert ihn wild gestikulierend auf, weiter zu fahren. Eriks Taxi wird anschließend freundlich in die Parklücke gewunken. Auch hier gilt wieder das Prinzip: Wer Geld hat, hat auch einen Parkplatz.
Obwohl der Taxifahrer verspricht, auf Eriks Rückkehr zu warten, hat Erik ein etwas mulmiges Gefühl, als er aus dem Taxi steigt.
»Mr., one Rupee, please! Please Mr., only one Rupee!« Kaum dass Erik das Taxi verlassen hat, stehen vier kleine, verdreckte Kinder vor ihm und strecken ihm ihre Händen entgegen. Instinktiv steckt er seine Hände in die Hosentaschen, um seine Wertsachen und sein Geld zu sichern. Erik hatte kurz zuvor gelesen, dass erfolgreiche Bettelkinder mehr Geld nach Hause bringen, als der Vater mit ehrlicher Arbeit verdienen kann. Ausländer haben kein Verhältnis zur Kaufkraft des Geldes und verteilen daher viel zu hohe Beträge. Die Empfehlung lautet daher, Kindern auf keinen Fall etwas zu geben. Diese sollen lieber in die Schule gehen.
Erik fällt ein kleiner Junge von vielleicht zehn Jahren auf, der sich auf eine Krücke stützt. An seinem rechten Bein fehlt der Fuß. Der Stumpf sieht frisch verbunden aus. Ihm kommen Geschichten in den Sinn, nach denen Kinder der Bettelkaste mutwillig verstümmelt werden, um durch den höheren Mitleidsfaktor bessere Ergebnisse beim Betteln zu erzielen. Für einen Außenstehenden ist es nicht nachvollziehbar, ob ein Unfall oder eine mutwillige Verstümmlung zu dem Gebrechen geführt hat? Erik befindet sich in einem argen Gewissenskonflikt. Selbst für den Fall, dass es mutwillig war, wäre es moralisch gerechtfertigt, diesem armen Kind etwas zu geben, da diese Verstümmlung mit Sicherheit nicht seine Idee war. Auf der anderen Seite würde man damit aber dieses widerliche System unterstützen, da es ja die gewünschte Wirkung in Form einer Spende erzielt. Das Ergebnis sind weitere verstümmelte Kinder. So schwer es Erik auch fällt, wendet er sich ab und entscheidet sich dafür, nichts zu geben.
In den Prospekten hat er etwas von der »Connaught Place Mall« gelesen, in der es alles zu kaufen geben soll. Er blickt sich um, um den Weg zu finden und wandert dann auf ein vielversprechendes Gebäude zu. Dabei fällt ihm ein kleines Mädchen auf, dass ihm beharrlich die ganze Zeit folgt und ihn immer wieder mit demselben Satz anspricht: »Why don’t you help me?« Sie blickt ihn mit großen dunklen Kinderaugen an, wobei die Haare verfilzt, dreckig und ungeordnet in alle Richtungen zielen. Indien ist einfach brutal. Sobald man einen Fuß vor die Tür setzt, wird man unweigerlich mit dem Elend dieser Welt konfrontiert. Nicht allmählich, sondern so, als ob man von der Reling eines Schiffes in den kalten Ozean gestoßen wird. Wo man gerade noch warm und trocken das Leben genießen konnte, watet man im nächsten Augenblick durch Menschen, die um ihr Leben kämpfen. Welche Chancen hat dieses kleine Kind? Die Perspektive, jemals dem Elend zu entrinnen, ist praktisch nicht gegeben. Als Erik dann auch noch in die hilflosen Kinderaugen schaut, ist sein Wille gebrochen. Obwohl er hundertprozentig davon überzeugt ist, dass sie einem professionellen Bettlerclan angehört, bei der selbst die indische Regierung um Zurückhaltung bittet, gibt er ihr einen Rupee. »Gebe ich nichts, fühle ich mich schlecht, gebe ich etwas, fühle ich mich auch nicht besser, aber auch nicht schlechter. Dieses Land kann einen moralisch zu Grunde richten.«, stellt Erik für sich fest.
So richtig genießen kann Erik den Ausflug nicht. Es sind so viele Menschen auf den Wegen unterwegs, dass man fast ständig gegen einen anderen stößt. Man bewegt sich mit der Masse langsam vorwärts, wobei es Erik schwer fällt, stehen zu bleiben, um die Auslagen in den Schaufenstern zu betrachten. Auch vor dem Eingang zu der Mall befindet sich eine große Menschentraube, die sich langsam in das Gebäude bewegt. Angesichts der Massen beschließt Erik, nicht in das Gebäude zu gehen. Immerhin weiß er jetzt, wo Mac Donalds und die Büros der Fluggesellschaften zu finden sind. Sein Magen knurrt langsam und irgendwie zehrt die Stadt an seinen Nerven. Er findet es interessant, aber leben möchte Erik hier nicht. Also beschließt er, dass etwas Abstand und Erholung in dem Paralleluniversum des Hotels deutlich angenehmer sind. Er ist vielleicht 15 Minuten mit den Massen gewandert, so dass er nun stehen bleibt, um den Ort zu suchen, an dem das Taxi stehen sollte. Plötzlich steht ein zerlumpter Mann vor ihm, der sich auf eine Krücke stützt, die bis unter seine Achsel reicht. Seine Hand, die er ihm entgegenstreckt, ist nur noch ein Stumpf ohne Finger. »Lepra!«, durchfährt es Erik. Er hat von dieser Krankheit in der Schule gehört, derartiges jedoch noch nie zuvor gesehen. Dieser arme Mensch hat an beiden Händen keine Finger mehr, sondern nur noch Stümpfe. Dieser Anblick überfordert ihn. Er blickt diesen Menschen mit Entsetzen an und versucht den bettelnd ausgestreckten Armstümpfen auszuweichen. Als Erik versucht, sich an ihm vorbei zu schlängeln, indem er sich zur Straße dreht, spürt er einen Schlag in den Rücken. Es ist nicht so, dass es körperlich schmerzte. Dieser Schlag, in dem eine Verzweiflung und vielleicht auch eine Wut über die Ungerechtigkeit der Welt liegt, trifft ihn viel tiefer. Dieser Schlag trifft seine Seele. Erik hat das Gefühl, dass er die Kontrolle verliert, so dass leichte Panik in ihm aufsteigt. In seinem Leben ist er doch der Regisseur. Diese Szene hat er jedoch weder geplant noch so erwartet. Mit einem Mal ist er nur noch ein Statist in diesem grausamen Film, über den ein anderer Regie führt. Erik ist in diesem Moment unfähig, sich dem armen Teufel zu stellen und ihm etwas zu geben. Er war bisher in der Lage, das Elend um sich herum irgendwie auf Distanz zu halten. Es war eher so, wie ein Film im Fernsehen, den er sich ansehen konnte. Er konnte bisher ausblenden, dass er selbst beteiligt war und Einfluss auf das Geschehen um ihn herum nehmen kann. Mit diesem Schlag in den Rücken steht er jedoch mitten in dieser nackten und erbarmungslosen Existenz als beteiligter Darsteller, von dem verlangt wird, dass er Notiz nimmt. Unfähig, sich der Situation zu stellen, flüchtet Erik mehr stolpernd als gehend in Richtung des wartenden Taxis und ist froh, als sich die Tür hinter ihm schließt. Er ist eher mental erschöpft, wie nach einer Niederlage oder nach einem Verlust. Er war nicht mehr Herr der Situation und war vor allem von seiner eigenen Reaktion überrascht. Er möchte jetzt nur noch zurück ins Hotel. Der Appetit ist ihm gründlich vergangen. Er fühlt sich einfach nur noch schlecht.
Auf der Rückfahrt in das Hotel fällt ihm auf, dass wohl nur die Hauptstraßen asphaltiert sind. Viele der Nebenstraßen scheinen nur aus einem fest gestampften Lehmboden zu bestehen. Erik überlegt, wie die Zustände wohl während der Monsunzeit sind, wenn alles im Schlamm versinkt. Eine schwierige Situation auch für die vielen kleinen Geschäfte, die auf ihren Karren den Straßenrand wie eine Perlenkette säumen. Ein Platz auf dem Bürgersteig oder eine Fensternische reichen aus, um die wenigen Waren anzubieten. Das Sortiment reicht von lediglich drei Apfelsinen, die ein Inder mit nur einem Zahn auf einer abgerissenen Pappe eines Kartons anbietet, über Feuerzeuge, Brillen, Uhren, Bücher und Zeitschriften bis zu Dienstleistungen wie rasieren und Haare schneiden. Selbst ein Stand für Kataloge, der unter anderem einen deutschen Quelle-Katalog anbietet, kann Erik entdecken. Vermutlich sind die Verkaufsflächen auch organisiert, überlegt Erik. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann versucht man halt etwas zu verkaufen. Von dem, was man auf einem Quadratmeter anbieten kann, wird man sicher nicht reich.
Vor einem Haus sieht Erik ein etwa drei Meter hohes Riesenrad, an dem vier Körbe befestigt sind. In jedem der Körbe sitzt ein strahlendes Kind und lässt sich durch die Muskelkraft des Betreibers im Kreis drehen. Als das Taxi vorbeifährt, erkennt Erik, dass das Karussell auf Rädern steht, so dass der Betreiber damit zu seinen Kunden fahren kann. Solch eine Fahrt für Kinder kann nun wirklich nicht viel kosten. Selbst wenn er den ganzen Tag voll ausgelastet ist, wird es dem Besitzer vielleicht gerade einmal umgerechnet einen Euro einbringen. Es wundert Erik, dass die Menschen von dem geringen Einkommen überhaupt leben können und vor allem sicherlich auch noch eine Familie ernähren müssen. Erik lehnt sich zurück und ist froh, dass seine eigenen Startbedingungen in seinem Leben deutlich besser waren.
Mit einem Mal hört er ein lautes Skandieren und Trompeten. Er erhebt sich wieder etwas aus den Polstern und sieht, wie die Querstraße vor dem Taxi durch eine große Gruppe Menschen blockiert ist, die mit Fahnen und rhythmischen Sprechchören vorbei ziehen. Etwas belustigt fragt Erik den Fahrer, um was es sich denn bei dem Umzug handelt. Die Antwort irritiert Erik dann aber doch. Die Regierung plant eine Quotenregelung für die untersten sozialen Schichten, um diesen ein Kontingent an Arbeitsplätzen in der Verwaltung zu reservieren. Genau diese Gruppe, für die diese Regelung gedacht ist, läuft aber gerade vor dem Taxi vorbei und protestiert dagegen. Der Fahrer erläutert Erik den Zusammenhang. Es gibt etliche Politiker, die diese Regelung aus persönlichen Gründen ablehnen. Daher bezahlen sie diesen Menschen Geld, damit die auf die Straße gehen und gegen etwas demonstrieren, was eigentlich ihr Leben verbessern soll. Langsam versteht Erik, wie Politik in Indien funktioniert. Korruption ist wohl ein tägliches Mittel, um seine Ziele zu erreichen.
Auch wenn das Erlebnis am Connaught Place noch immer einen unangenehmen Nachhall hat, hat diese Fahrt schon wieder so viele neue Eindrücke hinterlassen, dass dieses fade Gefühl mehr und mehr verblasst. Seine Anspannung verliert sich aber erst, als sie die Einfahrt des Hotels passieren und er den angenehmen Luxus dieser Oase im Ozean des Überlebenskampfes wieder betritt.