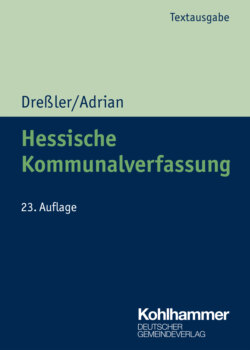Читать книгу Hessische Kommunalverfassung - Ulrich Dreßler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.Die Entwicklung des Kommunalrechts in den Jahren 2012 und 2013 im Zeichen der kommunalen Schuldenspirale
Оглавление1. Mit dem Kommunalen Schutzschirmgesetz vom 14. Mai 2012 nahm sich der Gesetzgeber den konsolidierungsbedürftigen Kommunen an, solchen also, „die die angehäuften (Kassen-)Kreditvolumina aus eigener Kraft kaum mehr in einem nennenswerten Umfang werden zurückführen können“ (LT-Drs. 18/5317 S. 1). Diese Situationsanalyse galt nach dem Schutzschirmgesetz für nahezu ein Viertel der hessischen Gemeinden (92 von damals noch 426) und für zwei Drittel der hessischen Landkreise (14 von 21)! Diesen Kommunen hat das Land staatliche Hilfe mit originären Landesmitteln angeboten; bei Inanspruchnahme mussten diese sich allerdings im Gegenzug verpflichten, ihre Haushaltswirtschaft mit vertraglich festgelegten Maßnahmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder zum dauerhaften Ausgleich (zurück) zu führen. Vor allem aber wurden die teilnehmenden 80 kreisangehörigen Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern (bis zur finanziellen Gesundung) der unmittelbaren Finanzaufsicht des jeweils zuständigen Regierungspräsidiums unterstellt. Wegen der Bedeutung der Zuständigkeitsverlagerung für alle Rechtsanwender werden die (noch) betroffenen Gemeinden in einer Fußnote zu § 136 HGO aufgeführt.
Auch auf der untergesetzlichen Ebene zog das Land im Rahmen der staatlichen Finanzaufsicht über die Kommunen, also auch und gerade über die (defizitären) Nicht-Schutzschirmkommunen, die Zügel (erneut) an. Die Hinweise des Innenministeriums vom 1. Oktober 2013 zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften in der HGO (StAnz. S. 1295) enthhielten entsprechende Gesetzesauslegungen. Am 3. März 2014 gab das Hessische Innenministerium Ergänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinie über die Konsolidierung der kommunalen Haushalte und die Handhabung der staatlichen Finanzaufsicht vom 6. Mai 2010 (vgl. dazu nachfolgend unter III.) heraus. In dem Erlass, von Kritikern als „Rosenmontags-Erlass“ bezeichnet, wurden insbesondere die folgenden Probleme angesprochen: Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzepts, Aufstellung der Eröffnungsbilanz und Ausschöpfung der Einnahmepotentiale in defizitären Kommunen. Dass in vielen (meist kleineren) Gemeinden fünf Jahre nach dem gesetzlichen Stichtag 1.1.2009 immer noch keine Eröffnungsbilanz aufgestellt wurde, war in Anbetracht der (fast) flächendeckenden freiwilligen Entscheidung für die Doppik kaum fassbar, nach dem Erlass des Innenministeriums jedenfalls nicht länger hinnehmbar. Entsprechendes galt insbesondere auch für den Verzicht auf eine gemeindliche Straßenbeitragssatzung, zumal der Hessische Landtag bereits mit Gesetz vom 21.11.2012 (GVBl. S. 436) auf Wunsch der kommunalen Spitzenverbände als Alternative zum einmaligen (wegen seiner Höhe bei den Bürgern besonders unbeliebten) Straßenbeitrag den wiederkehrenden Straßenbeitrag eingeführt hatte. Mit dem Erlass vom 29. Oktober 2014 über die kommunale Finanzplanung sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2018 (in StAnz. S. 982) – nach seinem Empfangsdatum 1 Tag später bisweilen auch als „Weltspartags-Erlass“ bezeichnet – forderte das Hessische Innenministerium den Haushaltsausgleich bis spätestens zum Haushaltsjahr 2017. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich erst später erreicht werden soll, bedürfen bei kreisangehörigen Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern die künftigen Haushaltsgenehmigungen des jeweiligen Landrats des Einvernehmens des Regierungspräsidenten. Diese Vorgaben wurden ein Jahr später erneuert und erhärtet mit dem Erlass vom 21. September 2015 über die kommunale Finanzplanung sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2019 (in StAnz. S. 999).
Die kommunale Freude über das Urteil des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 (in HSGZ 2013 S. 210) hielt nicht lange an. Mit diesem Urteil hatte das Hessische Verfassungsgericht das Finanzausgleichsänderungsgesetz 2011 korrigiert, mit dem der jährliche Finanztransfer vom Land auf die Kommunen um rund 360 Mio. Euro „korrigiert“ worden war. Das Gericht schrieb dem Land zwar ins Stammbuch, dass es seiner verfassungsrechtlichen Verpflichtung zu einem aufgabengerechten Finanzausgleich nur nachkomme, wenn es die Höhe der zur kommunalen Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzmittel kenne. Auf dem Weg zu einem bedarfsgerechten Finanzausgleich hat die Landesregierung Bouffier/Al Wazir jedoch bereits im September 2014 anlässlich einer ersten Modellberechnung klargestellt, dass sich der finanzielle Bedarf der Kommunen basierend auf einer systematischen Erfassung und Bewertung der ihnen vom Land zur Pflicht gemachten Aufgaben allenfalls in der Höhe des bisherigen Finanztransfers bewege. (Zur Novelle des Finanzausgleichsgesetzes im Sommer 2015 vgl. oben I. 3.).
Viele Kommunen machten daher geltend, das Land saniere sich vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse auf Kosten seiner Gemeinden. Dabei muss allerdings fairerweise im Auge behalten werden, dass das Land selbst in der jüngeren Vergangenheit nun schon zweimal die Grunderwerbsteuer anhob, es also keineswegs allein den Kommunen überließ, den Bürgern die unangenehme Nachricht von Abgabe-Erhöhungen zu überbringen.
2. Mit dem Änderungsgesetz vom 21. November 2012 wurde auch das Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit geändert. Die Unternehmensform „Kommunale Anstalt“, die den Gemeinden und Landkreisen erst mit der Kommunalrechtsnovelle 2011 zur Verfügung gestellt wurde, wurde als weitere Form der kommunalen Zusammenarbeit in öffentlich-rechtlicher Form etabliert (Gemeinsame kommunale Anstalt).
3. Im Rahmen der (großen) Dienstrechtsreform vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 217, 367), die als wesentliche Neuerung das Altersgeld für (freiwillig) aus dem öffentlichen Dienst ausscheidende Beamte – auch Wahlbeamte – beinhaltete, wurde § 130 HGO redaktionell überarbeitet.