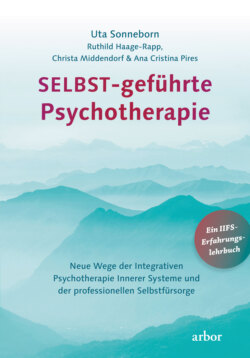Читать книгу SELBST-geführte Psychotherapie - Uta Sonneborn - Страница 25
Für Gegenübertragung gibt es zwei Definitionen.
Оглавление1 Die erste meint die Übertragung von Gefühlen, Bedürfnissen, Erfahrungen und auch Wünschen an die Beziehung zum Klienten vonseiten des Behandlers, die aus dessen eigener Lebensgeschichte und seinen unerfüllten Bedürfnissen stammen. Hier verbergen sich nicht selten Wünsche nach Wertschätzung und Anerkennung für seine außergewöhnlichen, aufopfernden Leistungen. Die Klienten sind jedoch nicht dazu da, dem Behandler etwas geben zu sollen, was er in seiner Vergangenheit hat entbehren müssen. Nicht selten leider werden jedoch Klienten in der Therapie emotional oder gar auch sexuell missbraucht. Hier sind Selbsterfahrung und Selbstreflexion unabdingbar notwendig und hilfreich, um nicht unbewusst in diesen Gegenübertragungsmodus zu verfallen und um für klare Grenzen in der Therapeuten-Klienten-Beziehung zu sorgen. Auch die unbewussten Reaktionsmuster und Resonanzen des Behandlers auf den Klienten zählen in die Kategorie der Gegenübertragung. Gegenübertragungsgefühle sollte der Behandler jedoch niemals am Klienten ausagieren, sondern sie sorgfältig wahrnehmen und an ihnen arbeiten. Es ist unerlässlich, dass er sich selbst für so wichtig nimmt, dass er ihn belastende Gefühle überhaupt als solche wahrnimmt, sie nicht einfach aushält, sondern nachverfolgt, auf welchem Hintergrund sie entstanden sind. Sind es eher ihn persönlich betreffende Gefühle oder doch Gefühle des Klienten, mit denen er sie verwechselt? Um das zu klären, ist die Supervision ein guter Ort, der dann aufzusuchen ist. Das gehört auch zur Professionellen Selbstfürsorge. Siehe auch Teil 4.
2 Die zweite Definition entspricht eher dem Gegenübertragungsbegriff bei Sándor Ferenci, der die Gegenübertragung zum Nutzen des Klienten instrumentalisiert sehen wollte, um so den Klienten über das im Therapeuten empfundene Gefühl besser verstehen zu können. Wir nehmen manchmal Gefühle wahr, die Gefühle unseres Gegenübers spiegeln und zu denen noch kein emotionaler und/oder bewusster Zugang besteht. Diese Gegenübertragungsgefühle therapeutisch nutzen zu können, setzt voraus, dass der Behandler auch Gefühle auf seinem Resonanzboden bewusst wahrnehmen kann, die nicht seine eigenen sind. Sie werden dadurch ausgelöst, dass der Klient gerade diese Gefühle bei sich unbewusst ausklammert oder abspaltet. Es ist eine hohe Herausforderung und braucht intensive Selbstkenntnis sowie eine gute Schulung der Gefühlswahrnehmung, um diese Unterscheidung treffen zu können. Was ist die Resonanz meines eigenen Inneren und was löst jemand anders in mir an Gefühlen, Empfindungen, Reaktionen etc. aus, das eigentlich nicht zu mir gehört?
Für therapeutische Begegnungen ist es ein riesengroßer Gewinn, den eigenen Resonanzboden und seine Gefühle gut zu kennen und die Gegenübertragungsgefühle von diesen unterscheiden zu können und sie nicht unbewusst auszuagieren. Dann können diese Gegenübertragungsgefühle als Diagnostikum und als Therapeutikum nutzvolle Anwendung finden. (Siehe auch Oszillieren, Metaebene, Resonanz.)
Ein mir sehr eindrückliches Beispiel möchte ich gerne hier schildern.
Ein etwa 55-jähriger Mann, klein und drahtig mit Halbglatze, überfreundlich und beflissen, mir all seine Beschwerden minutiös darlegend, kam aufgrund von Knieschmerzen zur Akupunktur in meine Sprechstunde als Ärztin. Bei der Schilderung seiner Beschwerden fügte er nach fast jedem Satz hinzu: »Wissen Sie, Frau Doktor?« Dies geschah in einem immer drängenderen Automatismus, dass er diesen Satz mindestens zwanzigmal und gefühlt jedes Mal lauter sagte. War ich zunächst freundlich zugewandt, merkte ich bald nach jedem Mal: »Wissen Sie, Frau Doktor?!,« dass ich diesen Satz so erlebte, als würde er mir im Stakkato um die Ohren gehauen und spürte ich in mir eine mir so nicht bekannte heftigste Aggression aufsteigen. Mich durchfuhr der Gedanke: »Wenn du jetzt diesen Satz jetzt noch einmal sagst, dann dreh ich dir den Hals um.« Wow, so was war mir noch nie passiert. Ich sagte zu dem Klienten: »Kleinen Moment, ich habe draußen etwas vergessen.« Ich musste einfach hinausgehen, um mich erst mal zu sortieren und herunterzuregulieren, atmete einmal tief durch und sagte zu meiner Mitarbeiterin, schon mit etwas Abstand: »Du, so was hab ich noch nie erlebt. Ich bring gleich jemanden um.« Sie entgegnete locker: »Das machst du doch aber sonst nicht«, und wir mussten beide lachen. Ich wusste, dass dieser heftige Impuls nicht meinem persönlichen Resonanzboden entsprang, ich mir dieses Gefühl aber gut merken musste, um den Patienten bei Gelegenheit beiläufig nach Gefühlen von heftiger Wut oder Ärger zu befragen.
Ich ging wieder in das Behandlungszimmer, war von meinen reaktiven Emotionen wieder heruntergekommen und fuhr mit der ganzheitlichen Anamnese fort, die den Patienten auch nach seinen Gefühlen befragt. Auf die Frage, wie er es denn so mit Gefühlen von Ärger und Wut habe, schrie er mir fast entgegen: »Ha, ich habe 21 Prozesse am Laufen.« Ich bekam einen kurzen Schreck, konterte dann aber cool, mit Herzklopfen, und fragte, was ich tun müsse, um der 22. zu sein. Darauf ging er beschwichtigend ein. Ich war wieder in meiner Mitte angelangt und konnte ihn ehrlich, mitfühlend und interessiert fragen, wie es denn gekommen sei, dass er so viel Kraft in diesen Prozessen für seine Gerechtigkeit aufwende. Er erzählte mir seine Geschichte von der Flucht von einem Gutsherrenhof und den Ländereien seines Vaters in der ehemaligen DDR, früheren und jetzigen Entbehrungen und empfundenen Ungerechtigkeiten und der Hoffnung, dass er dieses Land nach der Wende zurückbekäme. Ich erahnte, dass er stellvertretend in den ganzen Prozessen wie ein Rächer für »sein« verlorenes Land kämpfte. Er hatte in den letzten zehn Jahren seine ganze Arbeitskraft in diese Prozesse hineingesteckt, war darüber arbeitslos und noch ärmer geworden. Dennoch kämpfte er weiter gegen die Mühlen der Bürokratien und das ihm vermeintlich zugefügte Unrecht mit einer Mordswut – diesem Gefühl, das ich so hautnah an mir erlebt hatte. Ich wusste nun, woher es kam. Es gehörte zu der Geschichte des Klienten und ich konnte es mit Mitgefühl und in Respekt für sein erlebtes Leid bei ihm lassen. Das hat gereicht, um in der weiteren Behandlung bei seinem immer wieder mal einfließenden »Wissen Sie, Frau Doktor« keine aggressiven Affekte mehr zu haben. Ich konnte nun meine eigene Resonanz spüren und ihm ohne Worte ein verständnisvolles »Ja, jetzt weiß ich etwas von Ihrer Geschichte« in den Raum zustellen. Die weitere Behandlung gestaltete sich ohne Gefühlsstürme meinerseits und ohne Verwicklungen und Komplikationen.
Ein wichtiger zu erwähnender Sonderfall von Gegenübertragung ist die Projektive Identifikation. Hier identifiziert sich der Behandler unbewusst mit Menschen und deren meist schrecklichen Verhaltensweisen aus der Vergangenheit des Klienten, die diesem schwer geschadet haben, und agiert diese Verhaltensweisen unbewusst am Klienten aus. Häufig zu finden sind solche Beispiele bei Menschen mit Suchterkrankungen oder auch bei Traumatisierten, bei denen die Behandelnden unbewusst den Teil des Gefühlsszenarios aus der Kindheit der Klienten in Ansätzen ausagieren, der durch Gewalt, Erniedrigung, Missbrauch aller Art sowie Gefühlsausbrüche der Täter geprägt ist. Sie »erleben« diese Gefühle dann als Resonanz in teils erschreckenden und für sie nicht üblichen Ausbrüchen und agieren derbe Entwertungen am Klienten aus. Diese Gefahr sollte natürlich so früh wie möglich erkannt und gebannt werden. Ein Ausagieren dieser Gefühle schädigt Klienten in besonders dramatischer Weise, wenn sie zuvor Vertrauen zu den Behandelnden gefasst haben. Es ist für die Begegnung und für die Therapie von großer Wichtigkeit, solche Gefühle in sich zu erkennen und nicht zu verdrängen. Sie offenbaren einen Teil der Geschichte dieses Patienten, und es kann daran gearbeitet werden, aber eben ohne sie auszuagieren.