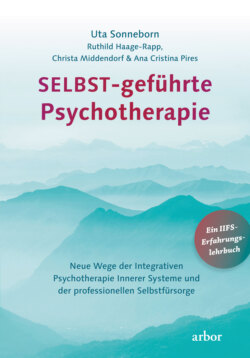Читать книгу SELBST-geführte Psychotherapie - Uta Sonneborn - Страница 35
Entstehung der Methode und das Innere System
ОглавлениеAls ursprünglich systemisch ausgebildeter Therapeut wurde Richard Schwartz immer neugieriger, mehr über die Innenwelt seiner Patienten und Klienten zu erfahren. Er stellte sich dem Experiment, über Jahre hinweg ausschließlich zuzuhören, zu sehen, zu beobachten, empathisch und neugierig seine Patienten zu begleiten, und versetzte sich mehr und mehr in die Lage, das in der Ausbildung Erlernte – Psychopathologie, Lehrmeinungen über Persönlichkeit und Therapie, Annahmen über Zusammenhänge, Hypothesenbildung – eher in die zweite Reihe zu stellen, um sich der inneren Welt seiner Patienten widmen zu können, ihnen wirklich zuzuhören, offen, interessiert und mit viel Empathie.
So erfuhr er von den sich in seinen Klienten widerstreitenden Anteilen, die wie richtig echte (Teil)Persönlichkeiten ihre Konflikte miteinander und gegeneinander austrugen, was heftigen inneren Kämpfen entsprach, solange die Klienten mit dem jeweiligen Anteil identifiziert sind. Sobald jedoch die Klienten die Anteile mit ein wenig Abstand sehen und erleben konnten, hörten, was diese Anteile dachten, fühlten, taten, die Situation, in der sie entstanden waren, würdigen konnten, kam eine veränderte Stimmung, Haltung, Mimik in diesen Klienten zum Vorschein, die sich mit liebevoller und ruhiger Stimme den Anteilen zuwandten. Diese »Desidentifikation« (Externalisierung, Separierung, Distanzierung, Entschmelzung, Abgrenzung) des Selbst von dem Persönlichkeitsanteil (»Teil x« genannt) konnte Richard Schwartz einladen, wenn er die Klienten bat, den Teil x etwas beiseitetreten zu lassen, damit sie ihn besser sehen und wahrnehmen könnten. Mit der Frage, was die Klienten für den Teil x fühlten, bekam er Antworten vom Selbst, die von tiefem Verständnis, Mitgefühl, Liebe, Dankbarkeit oder Wertschätzung geprägt waren, einhergehend mit einem veränderten Seinszustand. Oder es wurden neue Teilpersönlichkeiten deutlich, die mit Bewertung, Ablehnung, heftigen Gefühlsausbrüchen, Ablehnung, Hass, Identifizierung reagierten.
Diese inneren Persönlichkeitsanteile kann man sich als reale Persönlichkeiten vorstellen. So gibt es in uns Menschen Teile, die Perfektionisten und Schlamper sind, Organisatoren und Chaoten, Kritiker und Schönredner, Streber und Faule, Multitasker und Monotasker, Besserwisser und Sein-Licht-unter den-Scheffel-Steller, Draufgänger und Schüchterne, Kontrolleure und Laissez-fairerer, Schweiger und Quasselstrippen, Entwertete und Entwerter, Verletzte und Angreifer, zu Beschützende und Beschützer der harmloseren Art und auch der gewalttätigen oder (selbst-)destruktiven Art wie Furien, Süchtige und Zerstörer und u.v.a.m. in allen Geschlechtern.
Er fand heraus, dass die unterschiedlichen Anteile bestimmte Funktionen in der Geschichte eines Menschen übernahmen, die er in beschützte (Verbannte) und zu beschützende Anteile (Manager und Feuerbekämpfer) unterteilte. Das Selbst unterscheidet sich durch andere Qualitäten; es ist kein Teil.
Schwartz entdeckte, dass Teile bei verschiedenen Personen vergleichbare Rollen übernehmen und dass sich die Beziehungen zwischen den Rollen immer wieder ähnlich entwickeln. Diese inneren Rollen und Beziehungen waren nicht festgefahren, solange achtsam und wertschätzend mit ihnen umgegangen wurde. Dann waren sie sogar bereit, oft erstaunliches, bisher noch nicht bekanntes Material preiszugeben, ihre Geschichte zu erzählen und wie es dazu kam, dass sie diese Rolle übernommen haben – ja übernehmen mussten! Meist verfolgten sie in der Zeit ihrer Entstehung eine gute Absicht aus ihrer Sicht heraus und waren sich nicht im Klaren, dass sie »ihrem Menschen« heute damit unter Umständen sogar schaden könnten. Ja, oft kannten sie das Selbst »ihrer« Person gar nicht. Aus einer ursprünglichen – damals dramatischen, traumatisierenden, verletzenden – Situation heraus wollten sie Schaden abwehren und fanden so in ihre Rolle des Beschützers. Dessen höchstes Bestreben ist es, dass »sein Mensch« nie wieder mit dieser Situation und den dabei aufgetretenen Schmerzen, verletzten Gefühlen, Entwürdigungen etc. konfrontiert sein soll, koste es, was es wolle. Für die damalige Situation ergab es Sinn, dass der Mensch in einer traumatischen Situation die dazugehörenden Gefühle, Körpergefühle, Gedanken, Bilder, Erinnerungen und selbstabwertenden Kognitionen abspaltete. Und Beschützeranteile entwickelt – Abwehrmechanismen, Symptome und Krankheiten, wie wir sie als Traumafolgestörungen kennen (Essstörungen, Süchte, Dissoziationen, Selbstverletzungen, Suizidalität, Ängste, Panikstörungen, Schmerzstörungen und Depressionen), um mit den aus dem Trauma resultierenden Seelenschmerzen nie wieder in Kontakt zu kommen. Diese Seelenschmerzen sollen beschützt werden und in der Verbannung bleiben. Aus dieser Haltung heraus ist die Arbeit der Beschützer zu verstehen und zu würdigen. Vorher können sie nicht sehen, dass sie heute »ihrem Menschen« damit nicht nur nicht nutzen, sondern oftmals eher Schaden zufügen. Hier ist eine freundliche Klarstellung angezeigt, ohne die Anteile manipulieren zu wollen. Wenn das Selbst des Klienten mit seinen Beschützeranteilen in Kontakt tritt und diesen achtsam und mit Wertschätzung begegnet, dann sind die Beschützer meist bereit, dem Selbst zu vertrauen. Sie können dem Selbst ihre Geschichte anvertrauen, und sie erleben, wie heilsam die Verbindung vom Selbst zu ihnen und den verbannten Anteilen wirken kann. Sie sind bereit, dem Selbst die Führung zu überlassen und ihm den Zugang zu den verbannten Anteilen zu gewähren. Das Selbst bezeugt die Geschichte des Verbannten und die Arbeit der Beschützer, und wenn die Zeit dafür reif ist, entlastet es die Teile von den Folgen des Erlebten. Dann können sich die Teile vorstellen, aus ihren extremen Rollen zu schlüpfen und die ihrem eigentlichen Wesen entsprechenden Aufgaben zu übernehmen. So könnte der Selbstverletzungs-Impuls als blitzartig auftauchender Beschützer wahrgenommen werden, der vor Verletzungen beschützen will, und statt sich destruktiv auszuagieren, überlässt er es dem Selbst, die entsprechenden Maßnahmen zum Schutz vor Verletzung zu ergreifen. Die Teile können in ihrer entlasteten Form in die ihnen eigentlich innewohnende positive, nicht mehr extreme Rolle zurückkehren. Auch den Teilen wohnen Selbstqualitäten inne, zu denen sie zurückfinden können. Sie verbinden sich gerne mit dem Selbst ihres Menschen und fühlen sich gut dabei, Teil eines größeren Selbst, eines größeren Ganzen zu sein.