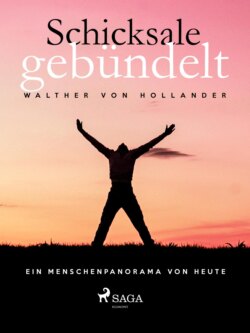Читать книгу Schicksale gebündelt - Walther von Hollander - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSeit dem Jahre 1911 bewohnte der Bankbeamte Melchior Lange eine Vierzimmerwohnung in der grauen und lauten Hamburger Straße in Altona. Er hatte von seinem Vater, dem Oberpfarrer Lange, außer dem seltenen Vornamen ein kleines Vermögen geerbt, dessen Zinsen für die angenehmen Überflüssigkeiten des Lebens draufgehen durften, weil das Einkommen für die Notwendigkeiten ausreichte.
In den Krieg zog Lange als Leutnant der Reserve. Heraus kam er als Hauptmann und Bataillonsführer, Ritter hoher Orden. Er gewöhnte sich nur schwer in das bürgerliche Leben zurück. Die Revolution und die Bank waren ihm gleich zuwider. Er versuchte, den Krieg zu verlängern, indem er gegen die Münchener und Bremer Räte zu Felde zog. Aber dann mußte er den Beruf wieder aufnehmen, und bald tat er dasselbe wie bis 1914: er verrichtete seine Arbeit und lebte in seiner Freizeit.
Die alten Klubs traten wieder in ihre Rechte, der Segelklub machte den stattlichen Hauptmann a. D. zum ersten Vorsitzenden. Im Tennis- und im Hockeyklub wurde er seines Zivilberufes wegen Kassierer. Die Inflation setzte nämlich langsam ein. Die Klubvermögen schmolzen zusammen. Man brauchte sachverständige Finanzverwalter. Lange verstand nicht allzuviel von Wirtschaftszusammenhängen. Er verfocht z. B. bis zum Schluß die Möglichkeit der Markzurückwertung, und so kam es, daß er zwar die Gelder des Klubs auf Drängen der Gesamtvorstände einigermaßen wertbeständig anlegte, sein eigenes Vermögen aber in Mark liegen ließ.
Kurz bevor der Nullpunkt erreicht war — im Januar 1923 — heiratete Melchior Lange ein Fräulein Rosa von Zwink, die einzige Tochter seines verstorbenen Regimentskommandeurs, eine sommersprossige Blondine, die beim Lachen wie ein Chinese, beim Weinen wie eine Nonne aussah und nur in großer Gesellschaftstoilette, mit Korsett und hochgestelltem Busen, wie eine Offizierstochter.
Rosa brachte in die Ehe das Mahagonischlafzimmer ihrer Eltern mit, eine Anzahl von Hirschgeweihen mit Schießdaten und eine Sammlung von alten Schwertern, Lanzen und Pistolen, die der Wohnung ein martialisches Aussehen verliehen. Sie sah im ersten Jahre der Ehe zu ihrem Mann auf, fand sein in Würdefalten zementiertes Gesicht anziehend und seine dicke Oberlippe mit dem Strohschnurrbart „ulkig und lieb“. Das polterig-schneidige Auftreten hielt sie für ein männliches Geschlechtsmerkmal.
Sie war ein paar Monate ganz zufrieden. Dann kamen ihr Zweifel. Sie dachte nach, verglich. Scheinbar hatte sie doch nicht das große Los gewonnen. Zum mindesten spürte man beim Zusammenleben nichts von Liebe. Später kamen größere Sorgen. Die Zahlen wuchsen zu Bergen, schrumpften plötzlich von einem Tag auf den andern, und man saß auf dem trockenen. Melchior Lange mußte seiner Frau mitteilen, daß man auf das Arbeitseinkommen allein angewiesen, daß man proletarisiert sei.
Rosa Lange saß ein paar Tage an ihrem winzigen Damenschreibtisch. Zum erstenmal in ihrem Leben rechnete sie genau und ausdauernd. Sie strich die Ausgaben für den Hund, für die Sommerreise, das Kostüm ging gut noch ein Jahr, die Hüte ließen sich modernisieren. Das Mädchen war zu entlassen, eine Aufwartefrau tat es auch, ja beim zweiten Durchrechnen fiel die Aufwartung einem Bleistiftstrich zum Opfer, der die ganze Seite zerriß.
Das Essen? Da kamen schon die Ausgaben, die auch Melchior angingen. Aber er war wohl eher ein Vielesser als ein Feinschmecker, und so ließ sich der Kaffee mit Zichorie schwärzen, die Kochbutter durch Rahma butterfein ersetzen. Ob er wohl auch eine billigere Zigarre wählen würde, weniger Kognak oder minderen trinken? Ging sein Sommermantel nicht auch noch ein Jahr, mußten es wirklich neue Tennishosen sein? Sie rechnete und strich. Aber am Ende ging es ohne eine völlige, einschneidende Änderung nicht: die Klubbeiträge nämlich, die Ausgaben für Sport und Tanz, die Kosten für Gesellschaften waren nicht aufzubringen.
Die junge Frau fand tagelang nicht den Mut, ihr Budget zu zeigen. Schließlich kam sie aber doch mit ihren Zetteln an. Melchior zog die Stirn noch höher als sonst, schob die Oberlippe vor und versuchte, den kleinen Schnurrbart glattzulegen. Er knurrte, schüttelte den Kopf, entschloß sich schließlich, die Sache lächerlich zu nehmen. Er schlug sie auf die Schultern, tätschelte ihr die Wangen. Das war so recht die Vorstellung eines Frauenzimmers. Man sollte zwischen seinen vier Wänden eingehen. Tages Arbeit, abends Stumpfsinn. War das Radio vielleicht erlaubt? Im Ernst: es gab für einen, der vorwärts wollte, nichts Dummeres, als sich vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen. „Ich werde es schon machen,“ schloß er sonor, „ich habe allerlei Pläne. Aber deine dilettantischen Eisenbartkuren lehne ich ab.“
Rosa Lange lag eine ganze Nacht wach. Sie versuchte, Vertrauen in die starken Worte ihres Mannes zu bekommen. Vielleicht verfügte Melchior doch über Quellen, die sie nicht kannte. Vielleicht hatte er Kräfte und Möglichkeiten, von denen sie nichts wußte. Sie wollte es gerne glauben, sie mußte es glauben, sie glaubte.
Anfangs: wenn man im „Atlantic“ mit dem Tennisklub dinierte, wenn man seinen Logenanteil beim Boxkampf bezahlte, den Bummel durch Sankt Pauli unnütz ausdehnte, wenn man eine Gesellschaft für 18 Personen gab — ganz einfach natürlich, mit drei Gängen und zwei Weinen, mit Zigarren, Kuchen, Likören —, dann brach die Angst immer wieder durch. Das konnte man doch tatsächlich nicht für dreihundertachtzig Mark im Monat haben? Da mußte doch ...?
Mit der Zeit gewöhnte sie sich. Melchior ließ sich keine Unruhe anmerken. Er murrte wohl zuweilen, wenn das Geld zu Ende war. Aber das tat jeder Hausherr. Und wenn er in seiner Brieftasche nachsah, so fand sich immer noch ein Fünfzigmarkschein oder wenigstens zwei bis drei Zehner.
Rosa wagte sogar einmal, ihn damit zu necken, indem sie meinte, die Brieftasche gleiche dem Ölkrüglein der biblischen Witwe, und man werde durch Gottes Wunder über alle Klippen und Fährnisse wegsteuern. Damals hätte sie die Wahrheit erfahren können. Denn Melchior Lange wurde erst käsebleich. Dann stand er schnell auf und ging ans Fenster. Die Tränen schossen in seine Augen. Die Hände zitterten ihm. Er drehte sich blitzschnell um. Er wollte seiner Frau gestehen ... Vielleicht konnte man doch noch etwas ändern. Aber Rosa war erschreckt in die Küche geflüchtet. Dort stand sie und wehrte die Wahrheit ab. Um Gottes willen, sie wollte noch nicht Bescheid wissen.
So kam denn noch ein schöner Sommer. Die Langes lebten in ungestümer Heiterkeit. Vom Ansegeln bis zum Verpacken der Boote, vom Frühlingsfest über das Sommerturnier bis zum Schlußpokal von Hamburg versäumten sie kein Fest. Im Juli fuhren sie in die Berge. Im September waren sie eine Woche auf Helgoland. Ende September machten sie ein Trabrennen mit, wetteten hoch auf einen Außenseiter und gewannen eine große Menge Geld.
Es war der einzige Tag, an dem Rosa Lange unsicher wurde. Sie hätte ihren Mann zu gern gefragt. Reichte es vielleicht, konnte man vielleicht doch weiterleben? Auch Melchior Lange rechnete. Das Defizit der Hockeykasse, bei der die Revision am nächsten Tage war, konnte er nun tatsächlich decken. Aber das Geld der Tenniskasse mußte acht Tage drauf da sein. Das konnte er nicht beschaffen, nachdem durch Generalversammlungsbeschluß des Hockeyklubs der Friedenszustand wiederhergestellt und die Kassenführung einem Dreimännerrat anvertraut war.
Am Nachmittag des 5. Oktober 1925 meldete sich Lange bei seinem Vorsteher krank. Er hatte Fieber. Seine Backen brannten. Das Gesicht zog sich in nervösen Zuckungen zusammen. Er kam um halb vier zu Hause an, weckte Rosa unsanft aus dem Nachmittagsschlaf. Er mußte es ihr sofort sagen. Er konnte nicht warten, bis sie von selbst aufwachte. „Es ist aus,“ sagte er und fuhr sich mit den Händen an die Schläfen, „ich habe ...“ Er holte tief Atem. Er dachte, er müßte nun wohl genau erklären, was geschehen war, wie es geschehen war, wie aus kleinen Anleihen die großen Unterschlagungen entstanden waren. Aber Rosa schien alles zu wissen. Sie saß auf dem Diwan, vom Schlaf noch fröstelnd. Sie sah ihren Mann nicht an. Sie wagte es nicht. Sie hatte ein so schlechtes Gewissen. Hatte sie es denn nicht immer gewußt?
„Armer Melchior“, sagte sie und weinte bitterlich an seinem Hals. Nun ist es also so weit, dachten sie beide. Und jeder wollte jetzt den andern schonen. Aber dann mußte es doch besprochen werden. Im ganzen hatten sie in 1½ Jahren achttausend Mark verschwendet, dreitausendachthundert waren durch den Renngewinn ausgeglichen, viertausendzweihundert mußte man auftreiben, oder ...
Rosa nickte. Gut, das „oder“ blieb einem ja. Vorher aber wollte sie versuchen. Es war da ein Freund ihres Vaters, der Bankier Merz, und schließlich auch noch die Tante Babette von Zwink, die einige Renten gerettet hatte. Melchior sollte sich nicht zu viel Hoffnungen machen, aber versuchen konnte man es.
Sie stülpte sich den kleinen weinroten Filzhut auf. Die Fohlenjacke zog sie zum erstenmal in diesem Jahr an. Denn es war bitterkalt. Sie lief schnell noch ins Badezimmer, um sich zu pudern, schüttete sich vor Aufregung den Inhalt der ganzen Puderdose in den Hals, pustete, schüttelte sich, lachte ihren Mann an, küßte ihn, lief die Treppen fast übermütig hinunter, sprang in ein Auto und fuhr davon. Es war vier Uhr fünfzehn Minuten. Um vier Uhr fünfundzwanzig ließ sie sich beim Bankier Merz melden. Sie mußte fast eine halbe Stunde warten. Dann kam er hochrot und aufgeregt aus seinem Büro geschossen. Welch ein Großkampftag! Die Börse! Unübersehbare Verluste! In zwanzig Minuten ging außerdem sein Zug nach Paris. Konnte er der lieben kleinen schönen Frau mit irgend etwas dienen außer mit Geld? „Außer mit Geld,“ wiederholte er und lachte dröhnend, „denn davon kann ich heute keinen Pfennig entbehren.“
Rosa Lange errötete, sie hatte noch nie Geld von Merz gewollt. Woher wußte er das? Also, wenn er ihr keines geben konnte ... „Nein, nein,“ stotterte sie, „ich wollte nur mit dir plaudern, Onkel Merz.“
Merz zog sie noch eine Sekunde ins Büro. Heute ging es wirklich nicht. Aber in acht Tagen? Rosa nickte. „Gut,“ sagte sie, „wenn ich nicht noch anrufe, komme ich.“
Ihr war kalt geworden. Sie hatte nun doch Angst. Um fünf Uhr dreißig erschien sie bei Babette von Zwink draußen in Groß-Flottbeck. In den letzten zwei Jahren hatte sich nichts geändert. Im Flur roch es immer noch nach Mottenpulver. Es waren auch immer noch Fräulein von Kneiff und die Baronin Prilleken bei ihr zum Tee.
Tante Babette setzte die Nichte streng in einen Sessel. Zunächst hieß es Konversation machen, einen Tee nehmen, zwei oder drei Stück Zucker? Milch? Man fiel mit seinen Angelegenheiten nicht gleich ins Haus. Der Kuchen war von Mathilde selbst gebacken und wirklich vorzüglich geraten. Kinder hatte Rosa keine? Baronin Prilleken hatte unterdes fünf Enkel zur Welt gebracht. Endlich ließ sich Babette von Zwink von ihrer Nichte ins Nebenzimmer zerren.
„Was ist also los?“ polterte sie. „Was brennt, was liegt im Sterben?“
„Wir“, antwortete Rosa leise und begann zu weinen.
Tante Babette hörte sich die Geschichte genau an. Also unterschlagen hatte dieser Pastorenjunge. Dafür konnte sie nicht ihr letztes Geld hergeben. Da sollte Melchior sehen, wo er blieb. Gefängnis und Amerika lagen beide nicht weit von Hamburg. Rosa aber sollte hierherziehen und die Scheidung einreichen.
Rosa trocknete ihre Tränen. Daran hatte sie nicht gedacht. Ihr war eine Sekunde federleicht zumute. Sie bat noch einmal, ob die Tante nicht doch Geld hergeben würde. Fünfzig, achtzig, ja hundert Mark monatlich konnte man zurückzahlen. Aber Babette von Zwink blieb hart. Sie brachte die Nichte selbst zur Tür, küßte sie hastig und herzlich. „Schweig und komm“, flüsterte sie feierlich und schob die junge Frau in den kalten Flur.
Rosa ging langsam durch die Vorstadtstraßen. Sie hatte einen Zorn auf die Tante. Sie war aber auch böse auf Melchior. Sie wollte wirklich gern mit ihm sterben. Aber daß er es so selbstverständlich verlangte, machte sie doch traurig. Nein, wie ekelhaft war das Leben, und gut, daß man zu Ende kam.
Sie war vor einem Laden stehengeblieben. Sie musterte die Delikatessen. Sie sah in ihrem Portemonnaie nach. Melchior hatte ihr das letzte Geld anvertraut. Siebenundvierzig Mark. Kindlich lächelnd betrat sie den Laden. Sie durfte alles ausgeben. Sie brauchte kein Geld mehr. Also Gänseleberpastete, ein Viertelpfund Kaviar, Trüffeln, Gänsebrust, Hummer in Mayonnaise, eine halbe Flasche Kirschwasser für Melchior, eine halbe Flasche Portwein für sich selbst. Ja, und für eine Mark Sahnebonbons. Eines wollte sie nur gleich essen. Vergnügt kauend fuhr sie mit dem Riesenpaket nach Haus.
Lange hörte sie die Treppe heraufkommen. Er beugte sich über das Geländer. Sie schwenkte das Paket, kaute noch immer die zähen Bonbons. „Gott sei Dank“, rief er und umarmte sie heftig. Sie wurde totenblaß. Was dachte sich dieser Mann? „Nein, nein,“ flüsterte sie, ging ins Wohnzimmer, riß das Paket auseinander, „nein, nein, wenn ich Geld bekommen hätte, hätte ich doch dies nicht.“
Er verstand nur langsam. „Aus“, sagte er dann. Ging in sein Schlafzimmer, kam mit dem Revolver, zielte auf seine Stirn. „Aus“, wiederholte er gedehnt. Aber sie nahm ihm die Waffe resolut weg. Noch war es nicht so weit. Sie wünschte noch ihr Abschiedsfest. Er sollte seinen Frack anziehen, sie das Tüllkleid.
Eine halbe Stunde später aßen sie. Anfangs ohne Appetit. Dann tat der Alkohol seine Wirkung. Sie hatten ja beide eine Vorliebe für steinschwere Delikatessen. Gänseleber, so viel sie wollten! Kaviar! Nur an nichts denken! Hummern! Das konnte man eine Henkersmahlzeit nennen! Es war auch noch Käse da. Kaffee, ausreichend für einen Mokka. Dann aber gab es nichts mehr als Alkohol und Zigarren. „Prost denn, Melchior,“ sagte Rosa, „es war ja schließlich ganz schön.“
„Prost denn“, antwortete er. Daß sie keine Angst hatte! Er hatte ja schließlich hundertmal dem Tode ins Auge gesehen. Aber sie? Nein, ihr war das Sterben neu. Sie mußte es lernen. Sie setzte sich auf seinen Schoß, sie sah ihm ausdauernd in seine leeren Augen. Kein Trost! Womit konnte man das Leben verlängern? Ja, man mußte wohl einen letzten Willen hinterlassen, irgendeinen Zettel, um zu erklären, warum und wieso. Schließlich kamen noch Leute in Mordverdacht.
Melchior weigerte sich. Er wollte nicht aufschreiben, daß er unterschlagen hatte, und daß sie sich selbst erschossen hatten, ergab sich doch klar.
Rosa war damit nicht zufrieden. Sie dachte voll Reue, wie sie bei der Tante nach dem Leben geschielt hatte. Wenn nun Melchior sie niederschoß und selbst nicht den Mut fand? Wenn er auf sich schoß und wieder gesund wurde? Wenn er zum Schluß doch ins Gefängnis wollte, statt in den Tod? Zuerst bekam sie noch einen Zorn auf ihn. Er sollte auf alle Fälle mit in den Tod. Dann aber erkannte sie, daß es sie nichts mehr anging. Sie faßte endlich den Entschluß, ihre Rechnung ganz zu bezahlen, und dazu gehörte, daß sie dem Mann die Freiheit ließ, weiterzuleben, wenn der Zufall oder seine Feigheit oder sein Mut es wollten. Sie riß also ein Blatt Papier vom Block und schrieb: „Ich habe aus Zorn auf meinen Mann geschossen und mich dann getötet.“
Sie las es genau durch. Ja, so war das richtig. Sie streichelte das Papier. Kniffte es zusammen. Steckte es in den Gürtel. Nun mußte sie nur noch das Geschirr in die Küche räumen, den Gashahn zudrehen, und dann gab es keine Pflichten mehr.
Melchior hatte die Waffe mit sechs Schuß geladen. Das Schwerste also zuerst. Rosa legte sich auf den Diwan. „Jetzt schnell“, sagte sie. Aber er kam nicht. Er zitterte so sehr, daß er nicht gehen konnte. „Melchior,“ rief sie vorwurfsvoll und ging auf ihn zu, „Melchior, du Feigling!“
Sie flüsterte das fragend und entsetzt. Aber er wurde wütend, daß man ihm, dem Hauptmann, so etwas sagen durfte. Er nahm sie mit hartem Griff um die Schulter. Rosa spürte etwas wie einen Schlag, einen Steinwurf dicht hinter der Schläfe. Sie fühlte sich noch sinken. Dann war alles dunkel.
Melchior Lange sah die Liegende prüfend an. Nun erst war es entschieden. Nun mußte er schnell machen. Er zog den Zettel aus dem Gürtel. Was? Sie hatte gefürchtet, daß er nicht folgen würde? Er Angst? Das wollte er ihr schon zeigen. Hastig, ohne zu zielen, gab er einen Schuß auf sich ab, traf sich in die Brust, sank in die Knie, schoß sich schnell dreimal hintereinander in den Kopf. Der dritte Schuß erst tötete ihn. Er klappte zusammen, rollte unter den Tisch.
Zehn Tage später wachte Rosa Lange als Polizeigefangene in der Charité auf. Sie mußte ein paarmal erwachen, ehe sie sich zurechtfand. Nicht möglich! Nicht einmal schießen konnte Melchior! Sie weinte und weinte! Man hatte ihr nämlich verboten, zu weinen, weil es lebensgefährlich für sie sei. So konnte man vielleicht mit Tränen eher zu Tode kommen als mit Kugeln.
Als sie einigermaßen zu Kräften gekommen war, erschien der Untersuchungsrichter an ihrem Bett. Es war ein junger, liebenswürdiger Mann, sie kannte ihn flüchtig vom Segeln her. Sie begrüßte ihn beschämt. Nun mußte sie es verantworten, obwohl sie doch eigentlich auch tot war. Die Unterschlagung war nicht mit Melchiors Tode erledigt.
Der Untersuchungsrichter wollte aber nichts von der Unterschlagung wissen. Er vernahm sie vielmehr wegen Mord und Totschlag. Er brachte bereits das fertige Geständnis mit. Die Sache war einfach genug: Rosa hatte von den Verfehlungen ihres Mannes gehört, hatte ihn im Zorn niedergeschossen und dann unter Zurücklassung eines Geständnisses Selbstmord verüben wollen. Menschlich war sie tief zu bedauern, juristisch leider nicht freizusprechen, wenn auch mildernde Umstände ...
Rosa hörte schon gar nicht mehr hin. Sie konnte, sie wollte nicht erklären. Der Kopf fing wieder an zu dröhnen. Schwere Dampfhämmer schlugen drin auf und ab. „Ja,“ sagte sie und nickte zu allem, „jaja, geben Sie nur den Füllfederhalter. Es war schon so.“
Der Untersuchungsrichter gab sich nicht zufrieden. Das Geständnis war zu schnell, zu tränenlos. Er bat sie, doch ja das Entlastende mit vorzubringen. Aber sie sagte nichts mehr. Es machte ihr keinen Spaß. Sie erklärte sich auch dem Arzt gegenüber nicht näher, dem Anwalt nicht, und die Tante Babette, die unter Opfern zu ihr vorgedrungen war, wies sie einfach aus dem Zimmer.
Im März kam sie in Untersuchungshaft. Sie war eigentlich ganz gesund. Nur wenn sie zu viel grübelte, dröhnte ihr Kopf. Nachts wachte sie manchmal davon auf, daß sie einen Schlag gegen die Schläfe bekam. „Melchior“, sagte sie dann immer, oder: „Herein, herein!“ Aber es kam niemand. Es war wirklich nichts auf dieser Welt, das sie noch etwas anging. Aber sie hatte viel Zeit, darum nahm sie ihre ganze Vergangenheit noch einmal genau durch. Sie dachte an ihren Vater, an ihre Mutter, an ihre ganze Jugend. Was war nun geblieben? Sie hielt sich an die Ideale des Oberstleutnants von Zwink. „Mut,“ flüsterte sie, „Haltung, Königstreue!“
Sie konnte keinen Trost darin finden und erst recht nicht in dem Leben der Mutter, das ganz im Gerede der Leute und in der Beachtung der Rangunterschiede aufgegangen war.
Endlich, weil der Gefängnisgeistliche sie besuchte, erinnerte sie sich an Gott. „Lieber Gott,“ sagte sie einen ganzen Abend, „lieber Gott, du lieber Gott.“ Aber als sie es am andern Tag überdachte, mußte sie gestehen, daß sie in ihrer Einsamkeit keine Verbindung mit Gott bekam.
Warum sie dann noch bis zum Tage vor der Verhandlung aushielt, ist nicht zu erraten. Sie wußte es wohl selber nicht. Aber ob nun die letzte Unterredung mit dem Anwalt sie so erregt hatte oder die Nachricht, daß Babette von Zwink ihre Unterstützung endgültig einstellte und darum nicht mal mehr Geld für Zigaretten da war, oder ob ganz einfach die Kraft nicht weiterreichte, jedenfalls beschloß sie, nun zum zweitenmal zu sterben.
Und dieses Mal war es viel einfacher: sie hatte keine Angst zu überwinden, kein Herzklopfen, sie mußte auf niemanden achten, für niemanden besorgt sein. Als das Licht gelöscht war, riß sie aus ihrem Laken lange Streifen. Knüpfte sie um die Heizung, steckte den Kopf in eine Schlinge und holte zweimal tief Atem. Wie oft man wohl stirbt, dachte sie, als sie sich fallen ließ, und daß es diesmal keinen Kaviar zuvor gegeben hatte.
Dann hatte sie ihren zweiten, einen leichten Tod gefunden. Ob sie allerdings ebenso leicht gestorben wäre, hätte sie genau gewußt, daß es das endgültige Ende war?