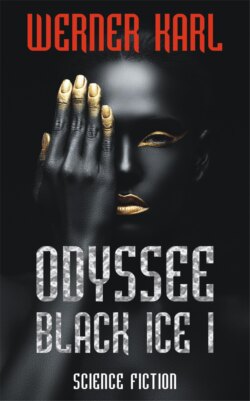Читать книгу Odyssee - Werner Karl - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stampede
ОглавлениеBérénice lag flach auf dem Boden und stieß zischend den angehaltenen Atem aus. Ihre Brust hob und senkte sich in rasendem Tempo. Schweißtropfen standen ihr dicht an dicht auf der Stirn. Ihr ganzer Körper klebte an der inneren Schicht des verfluchten Sambolli-Raumanzuges. Ihr Atem reduzierte sich nur langsam auf ein normales Maß und die Angst stand ihr immer noch in den geweiteten Pupillen. Doch wer sollte dies bemerken? Schließlich lag sie relativ sicher in einem verstaubten Wartungsschacht und erholte sich von der Hetzerei der letzten drei Stunden.
Kaum hatte sie ein Wartungsluk in der Außenhülle nah des Treibstofftanks wieder geschlossen, war auch schon ein Hüllenalarm erschollen. Sie hatte ohnehin damit gerechnet und sich bereits auf eine Flucht eingestellt. Aber was dann folgte, grenzte schon eher an das Drei-Planeten-Iron-Species-Rennen, an dem sie zwei Mal teilgenommen hatte. Das erste Mal hatte sie es überraschend locker gepackt, doch beim zweiten Mal wäre sie beinahe draufgegangen, so hatte sie sich verausgabt. Nun, die Drei-Planeten-Iron-Species-Rennen fanden immer auf neuen Planeten statt, und ein Rennen war auf keinen Fall mit einem anderen vergleichbar. Dieser Umstand hätte sie damals fast das Leben gekostet. Heute hatte ihr ihre Fitness schlichtweg das Leben gerettet.
Alles hing mit diesem verdammten Anzug zusammen. Am Beginn ihrer Flucht vor den Reparaturteams und Wachtrupps hatte sie sich geweigert, den Anzug irgendwo zu verstecken. Schließlich konnte es sehr gut sein, dass sie ihn noch einmal brauchte. Als sie recht rasch danach erkannte, dass sie diese Möglichkeit höher einschätzte als den Nachteil, den ihr das Ding beim Rennen verursachte, wäre es um ein Haar zu spät gewesen. Sie hatte einfach keine Zeit mehr gehabt, das Ding unbemerkt loszuwerden. Sie hatte sich geschworen, dies sobald als möglich nachzuholen. Mindestens einmal hatte man sie aus der Entfernung gesehen, vielleicht sogar bei einer zweiten Gelegenheit. In beiden Fällen war sie nicht sicher gewesen, ob man sie als Mensch erkannt oder für einen zu kleinen oder missgestalteten Sambolli gehalten hatte. Auf jeden Fall musste es verdächtig gewirkt haben, dass sie sich verdrückt und auf die Anrufe nicht so reagiert hatte, wie man es von einem unbescholtenen Stationsmitglied erwartet hätte. Ob man sie für einen Schmuggler, flüchtigen Verbrecher oder was auch immer hielt, war ihr schlussendlich egal. Eine Gefangennahme würde sofort offenbaren, was und wer sie war.
Ihre Rettung war eine beschädigte Bodenklappe gewesen, durch die sie in eine kleine Halle gestürzt war, in der Dichtungsmaterial für alle möglichen Zwecke lagerte. Sie fiel fast zwanzig Meter tief, landete aber auf weichen Ballen mit dicken schwarz-grünen Matten und ebensolchen Würfeln. Sie versank weitere fünf, vielleicht sechs Meter und war schließlich völlig von dem Zeug umgeben. In der ersten Sekunde war sie in Panik geraten, da sie die Orientierung verloren hatte und in allen Richtungen die Ballen wie verrückt gefedert hatten. Sie zwang sich zur Ruhe und wühlte sich nach unten. Die Arbeit in völliger Dunkelheit, umgeben von wackeligen Ballenstapeln und merkwürdig schmatzenden Geräuschen, trieb ihr zusätzlich Schweiß aus allen Poren. Als sie endlich den Boden erreicht hatte, war sie schon wieder durchnässt und fluchte ausgiebig vor sich hin.
Ihr war sonnenklar, dass man sie früher oder später auch hier entdecken konnte, also zwang sie ihre mittlerweile müden Glieder nach vorne und kroch über den Boden. Fast hätte sie vor Wut und Enttäuschung das Katana gezogen und sich einen Weg freigehackt, aber bevor sie dazu kam, stießen ihre suchenden Hände auf simple Verriegelungshebel, die aus der Halle führen mussten. Wohin konnte sie natürlich nicht ahnen. Nach Luft ringend hielt Bérénice fast 5 Minuten inne und lauschte mit einem Ohr an dem Schott. In völliger Dunkelheit und Stille wartete sie. Die Einfachheit der Schottverriegelung und das Fehlen irgendwelcher elektronischen Anlagen ließen sie hoffen, dass das Öffnen des Schotts nicht einen neuen Alarm auslösen und die abgeschüttelten Suchteams wieder auf ihre Spur bringen würde.
Der Gang hinter dem Schott war gottlob leer und sie zögerte nicht lange, als sie einen Zugang zu einem Wartungsschacht fand. Anscheinend war der ganze Trakt voller Treibstofftanks, Hüllenmaterial und Ähnlichem so schwach frequentiert und daher für eine elektronische Überwachung unbedeutend, sodass Bewegungsmelder, Kameras und anderer Hightech-Schnickschnack den zivilen Betreibern der Station an dieser Stelle zu teuer gewesen sein mussten. Auf einer militärischen Raumbasis wäre das ganz sicher anders gewesen. Die Staubschicht im Wartungsschacht unterstrich ihre Annahme und Bérénice fand zu ihrem normalen Atemrhythmus zurück.
Sie richtete sich auf und schälte sich in gebückter Haltung mühsam aus dem Anzug. Mit einem Fluch auf den Lippen stieß sie mit den Füßen das Ding zur Seite und hockte sich wieder hin. Mit gierigen Schlucken trank sie von ihrem ziemlich geschrumpften Wasservorrat und kaute anschließend lustlos auf den deutlich ramponierten Früchteresten des Samboll-Dschungels herum. Der fremde, aber sehr aromatische Geschmack hatte sich längst verloren und sie war sich auch nicht sicher, ob das Zeug noch bedenkenlos verdaubar war. Aber im Moment hatte sie nichts anderes. Also schlang sie die Brocken hinter und spülte mit dem letzten Schluck Wasser ihren Mund aus.
»Scheiße, wenn das so weiter geht, werde ich die Erde nur als klapperndes Skelett erreichen.« So langsam gewöhnte sie sich an Selbstgespräche. Dr. Muramasa fiel ihr wieder ein.
»Haben Sie keine Angst davor, mit sich selbst zu reden. Sie werden nicht verrückt. Es ist für einen einsamen Menschen völlig normal, fehlende Gesprächspartner durch sich selbst zu ersetzen. Es ist sogar eine Überlebensstrategie. Ein Mensch kann auf Dauer nicht alleine leben, ohne geistigen Schaden zu nehmen. Allerdings sollten Sie nicht dazu übergehen, einen Gegenstand zu ihrem Gesprächspartner zu machen, ihm vielleicht sogar einen Namen geben: Das ist krank.«
Mit diesem Gedanken sank sie auf den weichen Anzug nieder und war eingeschlafen, bevor sie sich bequem ausgerichtet hatte.
Bérénice Savoy erwachte und stöhnte augenblicklich auf, als ihre verspannte Muskulatur bei der ersten Bewegung unangenehme Schmerzschauer durch den Körper schickte. Sie schloss die Augen wieder und versuchte, sich in eine gerade Position zu legen. Über eine halbe Stunde blieb sie so liegen und tat nichts anderes als Lauschen und Atmen. Anschließend begann sie, in kleinen Übungen die Gliedmaßen zu bewegen, anzuspannen, anzuhalten und loszulassen. Anspannen, halten und loslassen. Immer wieder und wieder. Danach erhob sie sich in Sitzposition und wiederholte einige der Übungen und fügte neue hinzu. Leider konnte sie sich nicht völlig aufstellen, dazu war der Schacht zu niedrig, aber am Ende war sie mit dem Ergebnis zufrieden.
Weniger zufrieden war sie mit ihrem Äußeren, geschweige denn mit dem Duft, den sie verströmte. Auf ihrer Haut lag eine Schicht aus getrocknetem Schweiß, durchsetzt von Fasern der innersten Anzugschicht und samboll´schem Staub, aus was zur Hölle der auch immer sich zusammensetzte. Alles in ihr schrie nach einer Dusche. Sie würde sich auch mit einer Waschschüssel zufriedengeben, wobei sie bezweifelte, dass sich hier auf der Station so etwas finden ließe.
»Nun denn, Mädchen«, sagte sie und machte sich fertig. Nach kurzer Zeit stand sie gebückt vor dem Wartungsluk, den Anzug zu einem dichten Packen in ihren Vorratssack gefaltet, der aufgrund geschwundener Vorräte gerade genug Platz dafür bot. Die beiden Sauerstoffbehälter inbegriffen. Sie hatte sich überlegt, den Anzug zwar bei nächster Gelegenheit loszuwerden, wollte ihn aber wenn möglich vernichten. Wenn sie ihn irgendwo versteckte und er würde doch von jemandem gefunden, konnte auch ein Sambolli Eins und Eins zusammenzählen. Ein wenig unschlüssig hielt sie das Katana vor sich.
»Soll ich es auspacken oder nicht?« Mit grimmiger Entschlossenheit wickelte sie die dreifache Verpackung ab und warf diese achtlos in die Dunkelheit des Schachtes hinter sich. Der manipulierte Anzug wäre eine zu deutliche Spur, ein bisschen Verpackungsmaterial konnte von wo-weiß-wer herstammen. Die Wahrscheinlichkeit einer DNS-Analyse war dagegen äußerst gering. Die Scheide samt Schwert schob sie an die übliche Position auf dem Rücken, zwischen Schultergurt und Vorratssack. Ein letztes Mal horchte sie an dem Luk, dann trat sie hinaus.
Einen halben Tag später stand Bérénice Savoy angespannt hinter einem dicken rechteckigen Stützpfeiler eines Frachthangars und beobachtete die lärmende Betriebsamkeit in der riesigen Halle. Ein übergroßer Frachtraumer beanspruchte mit seiner Teleskoprampe die halbe Fläche der Außenschleuse, die andere Hälfte flimmerte silbern glitzernd im halbtransparenten Doppelschutzschirm. Vage waren dahinter der freie Raum und etliche weitere Raumschiffe zu erahnen. Allein durch die Größe konnte Bérénice davon ausgehen, dass sich alle möglichen Schiffstypen im Umfeld der Station herumtrieben. Das übliche Szenario also.
»Ganz schön viel los, Mädchen«, flüsterte sie sich selbst zu und verfolgte das Gewusel mit voller Aufmerksamkeit. »Gut für mich. Je mehr los ist, desto besser!«
Überhaupt fühlte sie sich auch selbst wohler. Den verräterischen Anzug hatte sie in einem Abfall-Konverter entsorgt, der jedermann frei zur Verfügung zu stehen schien. Im Laufe des individuell empfundenen Vormittages – sie hatte keine Ahnung, welches Datum und welche Uhrzeit es wirklich war – hatte sie eine Waschanlage für Frachtcontainer entdeckt und sich im letzten Abschnitt ausgiebig der Spülvorrichtung ausgesetzt, welche nach der Grobreinigung und Desinfektion die Behälter mit klarem Wasser nachspülte. Sie hatte sogar die Gelegenheit wahrgenommen, ihre Kleidung zu waschen, die sie längst durch Körperwärme getrocknet wieder trug. Ein kleiner Schluck hatte ihr allerdings verraten, dass es sich in keinem Fall um Wasser in gewohnter Trinkqualität handelte, aber es war besser als nichts. Sie hatte es trotzdem bei dem kleinen Schluck belassen.
Mittlerweile knurrte ihr der Magen, leider hatte sie nichts Genießbares – und vor allem Unbewachtes – gefunden. Der Weg in eine Kombüse oder Mannschaftsmesse schloss sich selbstverständlich aus. Auf ihrem Zickzackkurs durch die Station – schließlich kannte sie deren Aufbau nicht und hatte auch keine Übersichtstafel oder Ähnliches entdeckt – hatte sie alles Mögliche gesehen, nur keine Nahrung. Und jetzt hatte sie zwar Hunger, aber keine Lust mehr, diese Position im Frachtraum aufzugeben. Was wusste sie schon vom Zeitplan der Station? War diese Geschäftigkeit immer so oder gab es auch Ruhezeiten? Wenn die Sambolli auch nur annähernd dachten wie Menschen, gäbe es im Frachtsektor niemals Ruhe. Time is money! Oder auch: Eine Stadt schläft nie! Und nichts anderes war eine zivile Raumstation: eine Stadt, eine Großstadt, ein Geschäft. Und was für eines!
Bérénice hatte sich längst den Plan zurechtgelegt, ein möglichst großes Schiff als blinder Passagier zu nutzen. Je größer, desto besser. Bei kleineren Frachtern wären vielleicht die Kontrollen schlampiger, da weniger Raum für Schmuggelware zur Verfügung stand, aber die Versteckmöglichkeiten wären sicher erheblich geringer. Sie hatte ausgiebig darüber nachgedacht, einen der kleinen Frachter zu kapern, aber rasch die Idee in den Lokus geworfen, schließlich war sie allein und nur mäßig bewaffnet. Und die Sambolli, als verschriene Kontrollfreaks, würden wohl auch die kleinen Schiffe gründlich inspizieren. Schlampigkeit konnte man ihnen nicht vorwerfen. Also war ihre Wahl auf einen der großen Brummer gefallen.
Sie registrierte erfreut, dass sich außer Sambolli auch andere Spezies auf der Station tummelten, vor allem hier im Frachtsektor, und noch erfreulicher: in geradezu bunt gemischter Vielfalt besonders hier im Hangar. Aber sie hatte auch eine unerfreuliche Zahl bewaffneter Posten und kleinerer Wachtrupps entdeckt, allesamt Sambolli mit ihren typischen Dreiecksköpfen.
»Wie soll ich an denen vorbei ko…«
Sie hielt inne, als aus dem großen Frachter ein neuer Container die teleskopartig ausgezogene Rampe herunterschwebte. Das Prallfeld unterhalb des halb offenen Containers brummte seine Anstrengung bis zu ihr herüber. Das Ding war nur deshalb kein geschlossener Behälter, da sich eine große Zahl lebender Tiere darin befand. Bérénice erschauerte, als sie die Viecher erkannte. Es war die gleiche Art, die sie im Dschungel erlebt hatte. Der blutige Tanz der Bestie auf dem zermanschten Sambolli-Jäger stand ihr noch hochaktuell im Gedächtnis. Die Tiere waren nicht betäubt, vielleicht würden sie bei ihrem Gewicht sich sonst gegenseitig erdrücken. Andererseits würden die Bestien auch auf einem längeren Transport ungemütlich werden. Bérénice konnte eigentlich nicht sicher sagen, ob es samboll´sche Wesen waren oder von einem anderen Planeten nach Samboll gebracht wurden.
»Für die Jagd …« Der Gedanke erschien ihr nur logisch. Es konnte aber auch umgekehrt sein, sodass auf anderen Planeten ebenfalls Jäger in den Genuss solcher Beute kommen sollten.
»Ein Exportartikel, in welche Richtung auch immer«, stellte Bérénice fest.
Als eines der Biester seinen typischen Schrei ausstieß und sofort alle anderen einfielen, richteten sich sämtliche Augen und ähnliche Körperteile gleicher Funktion in der Halle auf die Tiere. Mit scheinbar lang erworbener Übung schlenderten einige der begleitenden Händler an den Container heran und warfen riesige Brocken Grünzeug durch die großen Maschen des Stahlkäfigs, die den oberen Teil des wannenartigen Containers bildeten. Die Tiere machten sich sofort an die Mahlzeit und innerhalb weniger Augenblicke war der Lärm verebbt und die Aufmerksamkeit sämtlicher Lebewesen im Hangar wandte sich wieder ihrer Arbeit zu. Der Container mit den mampfenden Tieren wurde am Rand der Halle abgestellt und das Personal entfernte sich. Nur Sekunden später lächelte Bérénice.
Ich hab´ da eine Idee.
Es hatte sie fast eine Stunde gekostet, sich hinter den Rand des Tiercontainers zu schleichen. Eine weitere halbe Stunde, in der sie sich an dem Schloss des Behälters abarbeitete und unbeobachtet die mehrfach gesicherten, aber rein mechanischen Verschlüsse öffnete. Jetzt brauchte sich nur eines der Tiere mit seinem gewaltigen Körper der kurzen Seitenwand zu nähern, die auch als Verladerampe diente, und die Show konnte beginnen. Bérénice hatte anschließend die unmittelbare Umgebung des Containers verlassen, schließlich wollte sie in dem zu erwartenden Chaos nicht das erste Opfer sein.
Und auch nicht das letzte, fügte sie in Gedanken hinzu.
Sie stand nun zwischen anderen Kisten, Ballen und Containern. Versteckt in einer Entfernung, die sie aus der Gefahrenzone hielt. Von wo aus sie aber bei der ersten passenden Gelegenheit zu der Teleskoprampe eilen könne, aus der unentwegt weiter entladen wurde. Sie hatte allerdings den Eindruck, dass die Händler nun mit weniger Elan arbeiteten. Die Schinderei über fast den ganzen Tag hinweg war ihnen anzusehen. Einmal hatte Bérénice bereits einen Schichtwechsel verfolgt, aber die zweite Besatzung zeigte mittlerweile auch schon Anzeichen von Ermüdung.
Entweder kommt bald die nächste Schicht oder die Entladung ist beendet, überlegte sie angespannt. Und dann geht sicher das Beladen los … Also keine Pause, Jungs. Mit bösem Blick schaute sie zu den Tieren im Container hinüber. Nach stundenlangem Mampfen und ausgiebigem Wiederkäuen standen die Biester nur still und friedlich herum, dämliche Trägheit verbreitend. So kam sie nicht weiter. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Empfänger mit seinem Team antrabte und seine Lieferung abholte. Also musste sie aktiv werden.
Dabei hatte ich so ein schönes Plätzchen gefunden, dachte sie und zog vorsichtig und lautlos das Katana aus der Scheide. Den leeren Sack ließ sie zwischen den Behältern liegen. Sie nahm den gleichen Weg zurück, den sie vom Container bis zu ihrem jetzigen Versteck genommen hatte, hielt drei, vier Mal in der Deckung unbenutzter Frachtkräne und Laderoboter an, bis sie wieder bei den Tieren war. Beinahe wäre sie in einer Pfütze stinkender Bestienpisse ausgerutscht, die orange aus Schlitzen und Rissen tropfte. Sie ging auf die Seite, welche dem losen Schloss gegenüberlag und suchte sich ein Opfer aus. Ein letzter Blick in die Halle, dann stach sie zu.
Der schmerzerfüllte Schrei, den die Bestie von sich gab, zerriss die verhaltene Geräuschkulisse des Frachtbetriebes mit überraschender Heftigkeit. Das gequälte Tier erhob sich innerhalb einer Sekunde aus seiner satten Dumpfheit und verwandelte sich in das, was es ja war: eine gefährliche Monstrosität, angestachelt im wahrsten Sinne des Wortes und bereit den Quälgeist zu vernichten. Doch seine wild rollenden Augen fanden niemanden, den es angreifen konnte und das heizte seine Wut noch mehr an. Es strampelte und brüllte, tobte herum, zumindest versuchte es das. Denn der Platz, der ihm zur Verfügung stand, reichte bei Weitem nicht aus, um seinem Zorn Raum zu geben. Also stampfte es mit aller Macht um sich und es wäre nicht die Natur dieser Viecher gewesen, wenn sie sich dies ohne Reaktion hätten gefallen lassen. Aus der noch vor einer halben Minute stillen Gruppe wurde eine Meute wütender Monster, die ihre Verwirrung, Angst – und Kraft – an jemandem austoben lassen wollten. Die kurze Verladeöffnung war bei der ersten Bewegung des nächsten Tieres krachend zu Boden gedonnert und hatte die Tiere mit dem kanonenähnlichen Schlag auf den Metallboden des Hangars zusätzlich erschreckt. Jetzt stand dem Drängen der Meute nichts mehr im Weg.
Beim ersten Schrei des verletzten Tieres hatten sich die meisten Arbeiter in der riesigen Halle dem Container zugewandt. Jetzt ging ein Ruck durch jedwedes Lebewesen und außer den wenigen Wachtrupps schoss alles den zahlreichen Ausgängen, Frachtwegen und Schotten entgegen. Nur die bewaffneten Wächter wussten einen langen Augenblick nicht, was sie tun sollten. Sie konnten nicht so ohne Weiteres die Viecher töten, dazu kosteten diese viel zu viel. Andererseits durften sie nicht zulassen, dass Lieferanten – schlimmer noch: Kunden! – womöglich zu Schaden kämen. Leider hatten sie nur tödlich wirkende Waffen bei sich. Möglichkeiten zur Betäubung, die bei solchen riesigen Wesen wirken würden, hatten sie nicht dabei.
Doch auch wenn die Wachen nicht gezögert hätten, hätten sie das folgende Chaos nicht verhindern können. Die Bestien – es waren zehn oder zwölf Stück – hatten mittlerweile den Container verlassen und stoben in allen Richtungen durch den Frachthangar. Eines der Tiere nahm sogar den Weg durch die immer noch offene Teleskoprampe zurück in den Frachtraumer, mit dem es hierhergekommen war. Es verschwand aus Bérénices Blickfeld und sie hörte es in dem breiten Zugang rumoren. Die anderen Bestien hatten endlich Ziele gefunden, an denen sie sich für die Störung ihres Daseins und überhaupt für alles auf der Welt bedanken konnten: die fliehenden Frachtarbeiter und die herumzappelnden Wachen.
Erst als zwei, dann drei der um Hilfe schreienden Arbeiter niedergetrampelt wurden, entschlossen sich die Wachen ihre Waffen einzusetzen, Wert der Tiere hin oder her. In die verzweifelten Schreie der Verletzten und Sterbenden und das kreischende Gebrüll der sich immer mehr in Wut steigernden Tiere, mischte sich das fauchende Donnern Laser-gestützter Handwaffen. Aber entweder handelte es sich bei den Wachen um blutige Anfänger oder grässliche Stümper. Ihr Beschuss der Tiere war unkoordiniert, die Schüsse erfolgten einzeln und zu langsam. Auf jeden Fall konnten sie die Bestien nicht aufhalten. Die Folge davon war, dass zum einen zwei Wachen selbst niedergetrampelt wurden, ohne dass die Viecher die einzelnen Schüsse aus den Handwaffen auch nur bemerkt, geschweige denn beeindruckt hätten. Die zweite Folge war noch schlimmer: Die angeschossenen Bestien verfielen nun in eine Raserei, die durch nichts mehr zu stoppen war. Ob Sambolli, Wache, Kran oder Laderoboter, alles erschien den Monstern nun wert, angegriffen zu werden. Und sie taten es mit einer Vehemenz, die selbst Bérénice tief erschreckte.
Längst war sie dem vorherrschenden Tohuwabohu entflohen, hatte die Rampe nur kurz hinter der verirrten Bestie passiert und sich in Sicherheit gebracht. Nun beobachtete sie aus einer verlassenen Kontrollkanzel am oberen Galeriering des Frachtschiffes das Unheil, das sie ausgelöst hatte. Alle Tiere waren so mit ihrem Vernichtungswerk beschäftigt, dass sie gar nicht wahrnahmen, dass sich kein lebendes Wesen mehr in der Halle befand. Die meisten waren geflohen, viele lagen tot, verstümmelt und teilweise zermatscht zwischen den Trümmerteilen, die einmal wertvolles Frachtgut gewesen waren. Die Monster verstanden natürlich nicht, dass sie die eigentliche Übeltäterin nicht erwischt hatten, die sie mit aufgerissenen Augen von der Höhe aus beobachtete.
Die stämmigen Beine der Wesen stampften, sprangen, trampelten unentwegt, sie rammten mit ihren massiven Schädeln alles, was sie finden konnten. Sogar wenn sie sich dabei selbst verletzten, hielten sie nicht inne. Im Gegenteil, jeder Schmerz, den sie erlitten, steigerte ihren Amoklauf.
Bérénice zuckte von der Kanzelscheibe zurück, als der Irrläufer wieder aus dem Frachter-Zugang zurück in die Halle stürmte. Offensichtlich hatte er es geschafft, eine Stelle zu finden, an der er sich umdrehen konnte. Dicht hinter ihm folgte eine Reihe samboll´scher Raumfahrer, allem Anschein nach mit den Viechern vertraute Händler. Denn in ihren Händen hielten sie langstielige Treiberpulser, die einen undurchdringlichen Schild an Pulsenergie vor ihnen aufbauten. Sie trieben die Bestie in die Halle, erkannte Bérénice nun. Sie ließ die ganze Truppe passieren und wartete ab, ob noch weitere Besatzungsmitglieder auftauchten. Als dem nicht so war, verließ sie die Kanzel und verzog sich ins Innere des Schiffes.
Es interessierte sie nicht, wie die Händler und das Stationspersonal die Tiere wieder zur Raison brachten. Das Einzige, was sie interessierte, war, dass ihr Ablenkungsmanöver geklappt hatte. Ein wenig erschrocken war sie über ihre eigene Fähigkeit, stillschweigend den Tod so vieler Zivilpersonen in Kauf zu nehmen. Okay, die Sambolli waren Feinde der Menschheit, und es waren nicht die einzigen Feinde. Aber die Lebewesen auf dieser Station waren Zivilisten gewesen, keine Soldaten.
Kollateralschaden, dachte sie grimmig und das Bild von an Wände genagelten Trooperskeletten im Gefangenenlager tauchte aus den Tiefen ihres Gedächtnisses auf.