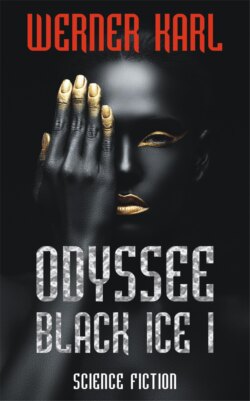Читать книгу Odyssee - Werner Karl - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Allein unter Leichen
ОглавлениеEs war dunkel, also war es entweder Nacht oder sie lag mit einer Unzahl weiterer Särge – und Leichen – in einem unbeleuchteten Raum. Alles war mucksmäuschenstill. Sie hatte eine geschätzte Stunde darauf gewartet, dass sie Geräusche von Wächtern, Totengräbern oder Priestern vernahm, die sich der gruseligen Fracht annahmen, bis ihr einfiel, dass sie nichts über die Gepflogenheiten der Sambolli gegenüber Toten wusste. Als intelligente Spezies würden sie sicher irgendwas mit den Verstorbenen anstellen, aber bisher hatte darüber noch kein Mensch Informationen erlangen können.
Ich werde die Erste sein.
Bérénice hatte weder Hunger noch Durst. Auch war sie mit den Gedankenspielen, was ihr alles passieren könnte, mehr als ausreichend – zumindest geistig – beschäftigt. Der Leichengestank war unangenehm, aber auszuhalten. Scheinbar verfielen Sambolli-Leichen langsamer und weniger ekelerregend als menschliche Körper. Recht schnell nach dem Eintreten der Stille um sie herum, hatte sie den Kopf des ursprünglichen Inhabers des Sarges beiseitegeschoben. Danach umständlich ihr Katana in eine Position gebracht, mit der es ihr nach einigen Versuchen gelungen war, die Dichtung der Sichtscheibe soweit aufzuhebeln, dass ihr wenigstens ein Erstickungstod erspart bleiben würde. Leider war die Scheibe viel zu klein, um ihren zugegeben sehr schlanken Körper dort hindurchzuzwängen. Eine Chance, die beiden Verriegelungen links und rechts davon zu erreichen, war ebenso illusorisch wie die Tatsache, dass, selbst wenn ihr dies gelungen wäre, sie niemals an die anderen Riegel gekommen wäre. Also blieb nur eins: Auf die Bestatter zu warten und zu hoffen, dass sie diese überrumpeln konnte.
Wenn sie auch nur im Entferntesten ähnlich gestrickt sind wie wir, dürften sie einen gehörigen Schrecken bekommen, wenn einem Sarg ein lebendes Wesen entsteigt; dazu noch ein menschliches.
Mit diesem Gedanken nickte Bérénice ein. Als Soldatin war sie es gewohnt, jede mögliche Gelegenheit für Schlaf wahrzunehmen. Ihre Sinne waren so trainiert, dass sie beim leisesten Geräusch ohnehin erwachen würde. Den Sambolli-Kopf hatte sie sich nicht wieder über ihr Gesicht gerückt, denn er hatte am Halsansatz ein paar Tropfen von sich gegeben. Mit würgenden Schlucken hatte sie sich die Spuren mit dem Leichentuch vom Gesicht gewischt. Das Katana hatte sie so ausgerichtet, dass sie es sofort griffbereit hatte, von außen durch die Scheibe aber nicht zu sehen war. Das Tuch – doppelt gefaltet – lag locker auf ihrem Gesicht. Zum einen sollte dies ein Beschlagen der Sichtscheibe des Behälters verhindern, zum anderen natürlich, dass sie sofort gesehen werden konnte. Sie rechnete damit, dass ihr Sarg ohnehin auffällig war, da die Scheibe nicht korrekt saß und dahinter eben kein Sambolli-Toter den Bestattern sein Antlitz darbieten würde. Vielleicht war gerade diese Unregelmäßigkeit der Grund dafür, dass sie nicht zu lange auf die Öffnung des Sarges würde warten müssen.
Die junge Frau wusste es natürlich nicht, denn kein Mensch hatte jemals eine samboll´sche Bestattungszeremonie beobachten oder ihr gar beiwohnen können, doch vor Kriegsausbruch wäre ihre Wahl, einen Sarg als Fluchtmöglichkeit zu nutzen, ihre letzte Entscheidung gewesen. Denn auf Samboll war es aufgrund der Fauna und Flora – insbesondere der Aasmaden – Usus, Verstorbene so rasch als möglich einer Feuerbestattung zuzuführen. Diesen Brauch hatte man bei der Expansion auch auf andere Planeten übertragen, welche die Sambolli besiedelt hatten, auch wenn dort die örtliche Tier- und Pflanzenwelt weit weniger an im Boden bestatteten Verstorbenen interessiert gewesen wäre. Alleine die Tatsache, dass die Hinterbliebenen zwingend einen allerletzten Blick auf den Verblichenen werfen mussten und wollten, führte dazu, dass anstelle der gebräuchlichen Holzsärge nun Kunststoffbehälter zum Einsatz kamen. Sie sollten den Transport vom Kampfgebiet zurück zum jeweiligen Heimatplaneten ermöglichen, und aus Kostengründen selbstverständlich Mehrwegbehälter sein. Daraus ergab sich schlicht und ergreifend die Notwendigkeit, dass die zwar langsam, aber dennoch verfallenden Körper so herzurichten waren, dass die Trauergemeinde dem oder der Verstorbenen in ein Gesicht blicken konnte, welches als solches noch erkennbar war. Die Sambolli-Führung legte allergrößten Wert darauf, dass der Krieg die Jahrhunderte alten Zeremonien nur so wenig wie möglich beeinflusste. Nur aus diesem Grund lag Bérénice jetzt in einer Lagerhalle in einem Kunststoffbehälter und wartete unruhig schlummernd auf ein Kontingent einer Berufsgruppe, die erst auf wenige Jahre Praxis zurückblicken konnte.
Natürlich hatte sich sehr bald daraus auch ein Geschäft entwickelt, schließlich waren die Sambolli begnadete Kaufleute. Und der Konvoi, der sich aus weiter Ferne der Lagerhalle am sonst eher unscheinbaren Raumflughafen näherte, wirkte für Beobachter wie ein Festzug. Auch um den schrecklichen Anblick hunderter oder auch tausender Särge der Bevölkerung zu ersparen, waren die Transporter bunt geschmückt, was noch deutlicher auffiel, da Carbon seinen Namen nicht zu Unrecht trug. Im Prinzip waren große Teile der Oberfläche offen liegende Kohleflöze, die fast planetenweit im Tagebau abgetragen wurden. Carbon war ein Industrieplanet, eine einzige gigantische Ressource. Sicher, es gab weitaus effektivere Methoden Energie zu erzeugen, doch keine einzige war so billig zu haben wie auf dem Kohleplaneten.
Die lange Reihe der rädergetriebenen Transporter mit primitiven, aber ebenso unglaublich kostengünstigen Verbrennungsmotoren, zog viele schwarzgraue Schwaden aus Abgasen hinter sich her, mit denen die mehrere Meter langen, in leuchtenden Farben wehenden Textilfahnen konkurrierten. Aus allen Fahrzeugen klang eine festliche, getragene Trauermelodie, die aber deutliche Merkmale von Freude und Hoffnung beinhaltete. Die synchron erschallende Musik war eines von vielen Stücken, welche die Sambolli komponiert hatten, um auch akustisch ihrer Ansicht Ausdruck zu verleihen. Nämlich, dass der Tod – auf welche Weise auch immer erlitten – die Verstorbenen vom Leid, welches sie im Diesseits getragen hatten, befreite. Auch die Verbrennung war in ihren Augen ein Akt der Befreiung, ein Lösen der Seele vom physischen Körper.
Als die Kolonne der Fahrzeuge an der Lagerhalle ankam, weckte genau diese Musik Bérénice aus ihrem leichten Schlaf. Sie wusste zwar nicht, dass die Musik den Toten galt, doch als kurz darauf Licht die Halle erleuchtete, reckte sie ihre Glieder, um sich auf körperliche Aktivität vorzubereiten.
Kaum war das Lied aus den Lautsprechern verklungen, als kräftiger Gesang aus Dutzenden Kehlen anhob, genauso getragen-melodisch wie das Instrumentalstück zuvor. Bérénice war fasziniert von den Stimmen und sogar die Melodie gefiel ihr.
Lass dich nicht ablenken, Mädchen, ermahnte sie sich. Es sind immer noch unsere Feinde dort draußen, zwar keine Soldaten, aber trotz alledem Feinde.
Ein Schatten verdunkelte kurz das durch die Sichtscheibe einfallende Hallenlicht, dann ein weiterer und noch einer. Jedes Mal hatte die singende Stimme eine andere Klangfärbung, kam näher, zog vorbei und entfernte sich wieder. Ihr Atem ging eine Frequenz höher, blieb aber immer noch gleichmäßig. Dann verstummte der Gesang und für einen Augenblick wurde es still in der Halle. Eine in der Nähe sich befindende Stimme sagte einige Worte, die sie nicht verstehen konnte, dann hörte sie Geräusche von aufschnappenden Verschlüssen. Die Sambolli arbeiteten nun schweigsam und Bérénice hatte den Eindruck, dass sie dies aus Ehrfurcht den Toten gegenüber taten. Vielleicht aber auch nur, um sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren und nicht unnötig viel Zeit mit der unangenehmen Erledigung derselben zu vergeuden. Sie konnte hören, dass jemand an einem der nächsten Särge neben ihr arbeitete. Nach den Singstimmen zu urteilen, schloss sie auf eine Anzahl von 20 oder 25 Bestattern, aber sie konnte sich auch täuschen. Was sie aber mit stiller Genugtuung und fast mit Sicherheit registrierte, besser gesagt nicht registrierte, waren die harten, befehlsgewohnten Stimmen von Soldaten oder Wachmannschaften. Innerlich erleichtert aufseufzend, lockerte sie ein weiteres Mal ihre Muskeln, denn es näherten sich ihrem Standort leichte Schritte und ein huschender Schatten zog am Sichtfenster vorbei, kam wieder zurück und verharrte darüber.
Jetzt …
Zu ihrer Überraschung erfolgte kein Alarm oder ein Ausruf des Erstaunens, sondern ein Schnappgeräusch nach dem anderen. Ruhig und ohne Zögern. Vielleicht hatten die Bestatter schon einiges an schrecklichen Bildern gesehen, sodass ihnen selbst ein fehlendes Gesicht in einem Sarg unverdächtig erschien. Möglicherweise vermutete der Sambolli über ihr, dass die Leiche im Sarg schlimmer verletzt sein könnte als andere und deswegen kein Kopf zu sehen war. Das beschädigte Fenster blieb völlig unbeachtet.
Das Glück scheint mich zu lieben. Hoffentlich bleibt es dabei ...
Bérénice kam nicht mehr dazu, den Gedanken weiterzuführen, denn mit einem zügigen Schwung hob sich der Deckel des Sarges und sie ließ dem Sambolli keine Gelegenheit, sie wirklich wahrzunehmen. Sie erhob sich blitzschnell in Sitzposition und ihre geballte Faust, das Heft des Katanas umklammernd, schoss senkrecht nach oben. Sie traf den sich tief niederbeugenden Bestatter an der Kehle. Nicht genau in der Mitte, aber immerhin so hart, dass ihm die Stimme versagte. Mit einem überraschten Gurgeln sackte er zusammen und blieb in kniender Haltung vor dem Sarg sitzen. Seine Hände zuckten zum Hals und sein Oberkörper wankte hin und her, sichtlich rang er um Atemluft. Sein Gesicht lief ein wenig dunkel an, dann schien er sich zu fangen. Doch da war die Trooperin schon aus dem Sarg geschlüpft, hinter den – jetzt als männlich erkennbaren – Sambolli getreten und hieb ihm mit aller Kraft die Schwertfaust in den Nacken. Mit erschlaffendem Körper sank der Bestatter nieder und rührte sich nicht mehr.
Dafür erschallten nun rings um Bérénice Rufe der Überraschung. Die ehrenvolle Ruhe und andächtige Tätigkeit wandelte sich in ein zunehmend aufgeregtes Szenario verwirrter Sambolli, die – je weiter sie von der Menschenfrau entfernt standen – ihre Verblüffung und Fassungslosigkeit mit immer lauter werdenden Rufen ausdrückten. Die näher Stehenden jedoch fassten sich erstaunlich schnell und erkannten augenblicklich, wer ihre Arbeit störte: ein Feind!
Doch sie waren unbewaffnet und weit und breit war kein Wachpersonal zu sehen. Wer sollte auch eine Halle voller Toter bewachen? Und wozu? Militärische Ehre würde man den Gefallenen selbstredend bei der eigentlichen Bestattung zugutekommen lassen, dort wo die Hinterbliebenen – und die Medien – von dem Schauspiel etwas hätten. Aber hier?
Bérénice Savoy war kaltblütig genug, dass sie trotz des wachsenden Geschreis sich einen Überblick über das Geschehen in der Halle machte. Ohne den Blick von den tatsächlich über 40 Sambolli zu nehmen, schnappte sie sich ihre Habseligkeiten und legte rasch den selbst fabrizierten Rucksack an. Dann hastete sie mit gezogenem Schwert durch die starr stehenden Zivilisten und strebte dem Hallentor zu.
Sie hatte es fast erreicht, als einer der Sambolli auf die wenig glorreiche Idee kam, sich ihr in den Weg zu stellen. Bérénice hatte eigentlich längst damit gerechnet, aber in diesem Augenblick reagierte sie aus einem Reflex heraus. Jemand versperrte ihr den Weg und brachte sie in Gefahr, womöglich tödliche Gefahr. Sie machte nur einen Schritt zur Seite, um den Gegner zu täuschen, und prompt fiel er auf die einfache Finte herein. Er machte ebenfalls einen Schritt, um sie erneut abzufangen, und lief ihr genau in den Schwung ihres herabsausenden Schwertes. Das Katana schnitt blitzsauber durch den ungeschützten Körper. Keine Schutzkleidung, keine Panzerung, keine Abwehrwaffe stand der höllisch scharfen Klinge im Weg. Einzig Muskeln und Knochen trafen auf Stahl und hatten nicht die geringste Chance, den Weg der Schneide auch nur um einen Millimeter zu verändern, geschweige denn aufzuhalten. Widerstand gegen ein Katana sah anders aus.
Das Ergebnis war ein in zwei ungleich großen Stücken niedersackender Körper, aus dessen glatten Schnittflächen sich das Blut ergoss. Die Teile lagen schon am Boden, als nach dem ersten Schock das Blut in kräftigen Fontänen aus den Hauptschlagadern pulste. Doch nicht lange, dann erstarb auch dieser Fluss. Alle drei Herzen des Sambolli hatten ihren Dienst abrupt eingestellt. Der Rest des Blutes glitt in stetigem Strom in die rasch wachsende, nougatbraune Pfütze. Die entsetzten Blicke aller Umstehenden saugten sich förmlich an der Blutlache fest. Einzig Bérénice hatte nicht eine Sekunde innegehalten, sondern war bereits an dem unglücklichen Sambolli vorbei, bevor dessen Blut einen See aus Schokolade bilden konnte.
Sie hatte die Kolonne der Transportfahrzeuge erreicht, als hinter ihr aus dem Halleneingang einige Sambolli drangen, die ihre Erstarrung überwunden hatten und laut um Hilfe brüllten. Andere blieben hilflos an ihrem Standort stehen, doch das sah Bérénice nicht. Ihre Konzentration richtete sich auf einen Uniformierten, der einige hundert Meter in Richtung Landefläche an einem Servicefahrzeug hantierte. Die lauten Rufe erweckten seine Aufmerksamkeit, doch offenbar konnte er die Worte weder verstehen, noch rechnete er in irgendeiner Weise mit etwas Bedrohlichem. Zu Bérénices Glück hatte er keine direkte Sicht auf sie, doch immerhin warf er ein Werkzeug zur Seite, erhob sich und fingerte nach einem Gerät, das eine verteufelte Ähnlichkeit mit einem menschlichen Kommunikator hatte.
Bérénice überlegte nicht lange, was er möglicherweise in das Gerät sprechen wollte, sondern ließ ihre Ausrüstung vom Rücken gleiten und spurtete schnurgerade auf ihn los. Sie konnte es sich nicht leisten, jetzt irgendwelche militärischen Einheiten auf sich aufmerksam zu machen.
Sie hatte etwa fünfzig Meter zurückgelegt, da hatte der Sambolli sie endlich entdeckt. Für ein, zwei Sekunden starrte er sie völlig fassungslos an, dann hatte er sich gefangen. Er erinnerte sich an das Funkgerät in seiner Hand und tippte eine Reihe von Zeichen ein. Gleichzeitig versuchte er, eine kleine Handwaffe aus einem Gürtelfach zu ziehen und auf die Frau vor ihm zu richten. Sein Fehler war aber, dass er versuchte, ein besseres Schussfeld zu erhalten, indem er sich seitlich bewegte. Leider musste er dafür den Winkel zu Bérénice, die mit fliegenden Beinen auf ihn zuschoss, verkürzen, denn sonst hätte er die Bestatter, die nun in großer Zahl aus der Halle hinter Bérénice herrannten, getroffen.
Dann passierten mehrere Dinge gleichzeitig.
Die Gegenstelle seines Kommunikators meldete sich mit einem deutlichen Summton, den selbst Bérénice schon hören konnte. Eine gelangweilte Stimme erkundigte sich wahrscheinlich nach seinem Begehr. Der Soldat – es musste sich eher um einen Techniker handeln, dem man eine Waffe in die Hand gedrückt hatte – versuchte zu schießen und gleichzeitig eine anständige Meldung zu machen, von der er selbst nicht einmal wusste, was sie beinhalten sollte. Der überaus schlecht gezielte Schuss verfehlte die anstürmende schwarze Furie, versengte ihr aber mit glühend heißem Atem den linken Arm. Ihre mühsam geschneiderte Kleidung schmolz augenblicklich und ihre Haut warf sofort zentimetergroße Blasen. Bérénice trieb es Schmerz- und Wuttränen in die Augen, doch dann war sie heran.
Vielleicht wirkten die Tränen in ihren Augen wie ein Lupenglas, doch sie erkannte sich selbst im Spiegelbild der glänzenden Augenoberflächen des Sambolli. Schwarz, schwitzend, mit gefletschten blütenweißen Zähnen. Und sein blankes Grauen. Mit vom Zorn geschwellten Muskeln hackte Bérénice ihm die Waffenhand ab und sein markerschütternder Schrei ließ sowohl die Stimme im Kommunikator verstummen, als auch die nachrückenden Bestatter erneut zu Statuen erstarren. Endgültig hatten sie erkannt, dass sie diesem Feind nicht das Wasser reichen konnten. Trotz vor Schmerz fest zusammengebissenen Kiefern griff Bérénice mit einer überaus eleganten Bewegung nach der Waffe, welche die abgeschlagene Hand noch immer umfasste. Der sich windende Sambolli-Techniker war viel zu sehr damit beschäftigt, seinen blutenden Stumpf zusammenzupressen, als dass er die Frau in irgendeiner Weise erneut hätte angreifen können. Zwar warf er hastig einen Blick auf das am Boden liegende Funkgerät, doch auch dieses wechselte nun den Besitzer. Ohne weiter auf den überwältigten Gegner zu achten, warf sich Bérénice herum und rannte zu ihrem Häufchen Ausrüstung zurück, das ohne Beachtung zwischen zwei Transportern lag.
Fieberhaft überlegte sie im Laufen, was sie tun konnte. Sie konnte schlecht alle Bestatter und den Einarmigen umbringen, um allgemeinen Alarm zu vermeiden. Wie um ihre Gedanken zu bestätigen, erklang in weiter Ferne ein verhaltener Heulton, der im seltsamen Rhythmus an- und abschwoll. Irgendwie hatte Bérénice den Eindruck, dass der Heulton ein Signal für einen Störfall darstellte, denn ein Alarm-Ton für eine Katastrophe oder einen Feind hörte sich sicherlich auch bei den Sambolli grässlicher an. Und sie war definitiv beides, eine Katastrophe und ein Feind.
Sie griff sich ihren Tornister und die Rationspakete, sprang in das Cockpit des Transportes unmittelbar vor ihr und fingerte rasend über die wenigen Bedienelemente. Wahrscheinlich mehr aus Zufall oder aufgrund idiotensicherer Anordnung erwischte sie den Startknopf für den Antrieb; manche Hebel vor ihr schrien ihre Funktion geradezu hinaus. Einer steckte in einem waagrechten Schlitz, der Zweite in einem senkrechten. Also rechts/links und vor/zurück. Kombiniert ließen sich damit auch Kurven fahren. Pedale für Beschleunigung und Bremsen fand sie nicht, auch als sie sich rasch unter die Konsole beugte. Sie hatte schon befürchtet, dass die Körpergröße der Sambolli mögliche Antriebspedale für sie unerreichbar bleiben ließ. Doch ihre Suche hatte trotzdem Erfolg. In Kniehöhe fand sie Beulen, in denen perfekt Sambolli-Knie passten, nur ihre nicht. Sie war trotz ihrer Körpergröße von 1,82 Metern zu klein, daher die Ausbuchtungen für sie zu hoch. Doch Bérénice war schon immer ein Improvisationstalent gewesen. Sie zückte ihr Katana und schnitt vom Beifahrersitz die Sitzfläche ab, platzierte diese zusätzlich auf dem Fahrersitz, und hockte sich darauf.
»Ein wenig wacklig, aber besser als nichts«, grinste sie und probierte die Hebel aus. Der Motor lief gleichmäßig, doch der Gestank nach Abgasen raubte ihr fast den Atem. Auf der Erde gab es Verbrennungsmotoren schon seit Mitte des 21. Jahrhunderts nicht mehr. Vor lauter Freude über ein bedienbares Vehikel hätte sie beinahe die Truppe der Bestatter vergessen, die plötzlich rings um sie auftauchte und Anstalten machte, an Bord zu klettern. Der Grund für ihren aufflammenden Mut war Bérénice sofort klar: Sie brauchte beide Hände und Knie, um das Fahrzeug zu bewegen. Da blieb keine Hand zum Kämpfen frei.
»Dumm seid ihr nicht, Jungs«, murmelte sie grimmig und rammte ihr Knie in die Tempo-Mulde. Mit einem wilden Satz, der ihr fast beide Hände von den Richtungshebeln gerissen hätte, bockte der leere Transporter nach vorne und in allerletzter Sekunde konnten vier oder fünf Bestatter zur Seite springen. Dann lag vor Bérénice freies Gelände und sie drückte kräftig aber kontrolliert ihr rechtes Knie in die Mulde. Mit überraschendem Tempo fegte das Fahrzeug über die Piste, eine schnell kleiner werdende Gruppe immer noch erschütterter Bestatter und einen wimmernden Techniker zurücklassend.
Bérénice blickte ein wenig enttäuscht in die Ebene hinab, in der einsam und verlassen der Bestattungstransporter stand. Ausgebrannt im doppelten Sinne. Vielleicht war im Bunker nicht mehr genug Kohle für eine längere Reise gewesen, wahrscheinlich sollten die Fahrzeuge am Landeplatz neu befüllt werden, bevor sie den Weg zurück in bewohnte Gebiete nahmen, wo die Hinterbliebenen die Trauerfeierlichkeiten abhalten wollten. Zusätzlich hatte Bérénice das Fahrzeug mittels des Handstrahlers in Brand gesetzt, um ihre Spuren so gut als möglich zu verwischen, auch wenn ihr klar war, dass die befragten Bestatter sie eindeutig als Mensch beschreiben konnten. Doch wie hatte ihre Ausbilderin, Drill-Sergeant Angela Montgomery, immer gesagt: »Nimm jede Gelegenheit wahr, dem Feind Informationen vorzuenthalten! Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass er schon weiß, was du zu verbergen suchst, ist es noch lange keine gesicherte Tatsache, dass er diese Information schon hat. Also: Verbirg, was du verbergen kannst!«
Natürlich dachte sie daran, dass die dünne Rauchsäule wie ein Mahnmal auf ihren Standort hinwies. Aber sie hatte in der einen Stunde, in der sie mit Höchstgeschwindigkeit fernab von Straßen durch die Ebene gefahren war, keinerlei Anzeichen von Verfolgern feststellen können. Im Grunde bedeutete das nicht viel. Doch sie hatte immerhin mehrere Seitentäler genommen, einmal sogar wieder die Richtung zum Raumflughafen eingeschlagen, um nach wenigen Kilometern im scharfen Winkel erneut einen Haken zu schlagen. Sie hatte bedauert, dass sie nicht verhindern konnte, dass das brennende Fahrzeug Rauch produzierte. Aber sie hatte sich trotzdem dafür entschieden, da jeder geringste Windhauch ohnehin Kohlenstaub ziemlich weit nach oben wirbelte. Und in der Luft waren ständig graue und schwarze Partikelschleier verteilt, die je nach Windbewegung auf und ab stiegen, sich drehende Staubteufel und ähnliche Erscheinungen bildeten. Daher hoffte sie, dass ihre Rauchfahne im allgemeinen Szenario nicht weiter auffiel. Das, was ihre Enttäuschung mitbegründete, war jedoch die Tatsache, dass es ausgerechnet jetzt fast windstill war und die dünne Rauchsäule mehr oder minder senkrecht nach oben stieg. Aber das konnte sich jede Sekunde ändern.
Sie hatte mittlerweile eine größere Anhöhe erklommen, die den Anfang eines weitläufigen Vorgebirges bildete. In großer Distanz glaubte sie, in der grauen Luft das Gebirge zu erkennen, das auf das Vorgebirge folgte. Aber sie konnte sich auch täuschen, die Sicht war für einen klaren Blick einfach zu schlecht.
Als ein wenig Wind aufkam, drehte sie sich zurück und registrierte mit stiller Freude, wie ihre Rauchsäule sofort zerfaserte und schließlich ganz erstarb. Es war kein brennbares Material mehr in dem Transporter, das dem Feuer noch Nahrung hätte geben können.
Für einen Moment spielte sie mit dem Gedanken, sich bis auf die ohnehin mausgraue Militär-Unterwäsche auszuziehen, um so selbst optisch kein farbiges Ziel zu bieten, das sich dazu noch bewegte, entschied sich aber nach kurzer Überlegung dagegen.
Sie justierte die recht wirksame Staubmaske, die sie vor dem Gesicht trug, ein wenig nach und dachte an die anderen fünf Stück dieser Masken, welche sie ihrer Ausrüstung zugefügt hatte. Offensichtlich schätzten es auch Sambolli-Fahrer nicht, wenn ihnen bei langen Fahrten der allgegenwärtige Kohlenstaub sämtliche Kopföffnungen verstopfte.
Sie sah nun aus wie der sprichwörtliche Tod: schwarz von Kopf bis Fuß. Denn ihre von Natur aus sehr dunkle Hautfärbung hatte nun zusätzlich eine Kohlepatina angenommen, genau wie ihre Kleidung und andere Ausrüstungsgegenstände. Ihr Haar war ebenso tiefschwarz wie ihre Augen. Einem Beobachter wären in dieser vorherrschenden Schwärze einzig die strahlend weißen Augäpfel aufgefallen, die überdeutlich aus der Finsternis ihrer Erscheinung leuchteten, wie zwei Lampen in der Dunkelheit. Doch es gab hier keinen Beobachter.
Hier nicht.
Bérénice hatte keine Chance, die Spionagesonde zu bemerken, die am Rande der obersten Luftschichten fast stationär genau über ihr stand. Die Sonde bewegte sich nur, wenn Kohleschleier die Sicht zu schlecht für ihre hochsensiblen Systeme werden ließ und sie dafür einige hundert Meter tiefer sinken musste.