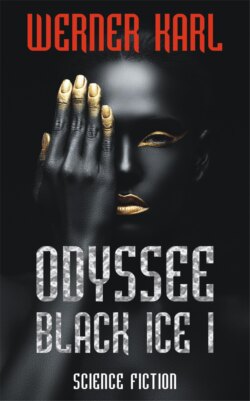Читать книгу Odyssee - Werner Karl - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Planet Samboll
ОглавлениеBérénice hetzte nun schon die zweite Stunde durch den Dschungel von Samboll und sie war völlig durchnässt, sowohl von außen durch den andauernden Regen als auch von innen durch Schweiß. Doch sie nahm es mit stoischer Ruhe hin. Ihr blieb auch nichts weiter übrig, wenn sie nur die geringste Chance zu überleben nutzen wollte. Und sie wollte. Nein, sie musste. Ihre sehnig-athletische Figur verriet ihre haitianische Abstammung, ihre dunkle, fast schwarze Haut kontrastierte extrem mit ihrer knallroten Gefangenenkluft. Wenn man die recht strapazierten Reste des Anzuges noch als Kleidung bezeichnen wollte. Ihre schwarzen Haare – zu einem Zopf geflochten – hüpften im regelmäßigen Takt ihres Dauerlaufes auf dem Rücken, auf dem sich ein kleines Bündel und eine einfach gefertigte Schwertscheide befanden.
Sie war eine schöne Frau, doch im Augenblick würde ein Beobachter – und sie hoffte, dass niemand sie momentan beobachtete – jetzt nur einen schwarz-roten Schatten durch den dämmrigen Dschungel huschen sehen. Sie war hochgewachsen und ihr Gesicht von einer klassischen Anmut, welche durch den symmetrischen Aufbau von dunklen Augen, vollen Lippen und hohen Wangen nur noch unterstrichen wurde. Sie konnte damit jedoch ein ziemlich großes Repertoire an Grimassen schneiden, was ihr in geselliger Runde weitere glühende Anhänger eintrug.
Doch jetzt war fast jede freie Stelle ihres Körpers von Schnitten, Kratzern und kleinen Wunden übersät, welche ihr Dornen, peitschende Äste, Lianen und anderes Geflecht dieses verfilzten Waldes eingebracht hatten. Sie blutete aus etlichen der kleinen Verletzungen und zusammen mit ihrem Schweiß lief sie geruchsintensiv, wie ein olfaktorisches Leuchtsignal durch den Dschungel. Sie war sich dessen bewusst, konnte aber im Augenblick nichts daran ändern. Sie hoffte, dass der Regen intensiv genug war, um einerseits ihren intelligenten als auch weniger intelligenten Verfolgern die Witterung zu erschweren.
Nach vierzehn Wochen grausamster Gefangenschaft bei den Sambolli hatte sie beschlossen, eher zu sterben, als auch nur noch eine Woche weiter in dieser Hölle gefangen zu bleiben. Und die Chance zu sterben, lag hier im Dschungel nur geringfügig niedriger als im Gefangenenlager. Nun, sie zog eine Chance von 5 % zu Überleben einer von 100 % zu Sterben eindeutig vor. Ihre Mitgefangenen, was konkret das halbe Bataillon der 45. Spacetrooper bedeutete, hatten sich während ihrer Gefangenschaft von anfangs knapp 500 gefangenen Troopern auf 312 reduziert. Ein Trooper-Bataillon zählte normalerweise 1.000 Personen.
Jetzt 311, dachte sie grimmig und wich zum hundertsten Male einer Faustfliege aus, die nach wenigen Metern Verfolgungsflug aufgab und sich ein anderes Opfer suchte, was nicht so groß und so schnell war wie Bérénice.
Die schlanke Frau fühlte, dass sie vielleicht noch eine halbe, höchstens aber eine Stunde das Tempo würde halten können. Danach würde sie sich noch mindestens eine weitere Stunde mit dem Körperschutz beschäftigen müssen, bevor sie sich den dringend benötigten Schlaf gönnen konnte. Aber wie zum Trotz steigerte sie für einige Minuten ihr Tempo, wie um es sich selbst zu beweisen, was sie doch für ein harter Hund war. Als sie das zweite Mal beinahe in eine Rasierer-Falle getreten wäre, bremste sie ernüchtert und frustriert ab und fiel in ihr altes Lauftempo zurück.
Bérénice – von allen Freunden aufgrund ihrer unumstrittenen Schönheit nur Nice und von ihren Nichtfreunden respektvoll Ice genannt – widmete ihrer Umgebung wieder mehr bewusste Aufmerksamkeit. Der samboll´sche Dschungel stellte jeden irdischen Dschungel um ein Vielfaches in den Schatten. Das betraf zuallererst seine Größe, denn der Planet Samboll bestand fast ausschließlich aus Dschungel. Der Rest aus unzähligen Wasserflächen, welche die Bezeichnung Meer nicht im Ansatz verdienten, sondern von großen Seen, Abertausenden kleineren und kleinsten Wasseransammlungen, Strömen, Flüssen und Rinnsalen gebildet wurden. Da sich die höchsten Erhebungen noch unterhalb der Waldgrenze befanden, setzte sich die grüne Landschaft auch dort ungehindert fort. Einzig die Dichte des Pflanzengewirrs lichtete sich oben ein wenig und erlaubte seltene Ausblicke auf das immer gleiche Bild: Grün, soweit das Auge reichte.
Die Richtung, in die Bérénice rannte, war ihr egal. Zumindest für den Moment. Nur so weit weg vom Lager, wie sie nur konnte. Es hatte keine Mauern, Zäune oder irgendwelche anderen Hindernisse gegeben. Die Sambolli kannten ihren Planeten und selbstverständlich den Dschungel – und alles, was darin kreuchte und fleuchte – in- und auswendig. Aber sie kannten die Menschen noch nicht gut genug. Und schon gar nicht eine Frau wie Bérénice Savoy.
Die Sambolli waren entfernt humanoid und zum Erstaunen der Menschen empfanden sie die menschliche Spezies sogar als hübsch. Als mörderischen Todfeind, aber rein optisch als hübsch. Vielleicht trug das dazu bei, dass sie Bérénice nicht zutrauten, eine Flucht zu wagen. Schließlich waren muskulösere, stärkere Männer, in deren Augen echte Gegner, an der Flucht gescheitert. Die Skelette, welche der Dschungel übriggelassen hatte, zierten zu Dutzenden die Wände der Aufseher-Unterkünfte. Der Kommandant machte sich jeden Morgen die Freude, der schrumpfenden Gefangenenschar für eine geschlagene Stunde in brütender Hitze in stiller Andacht die Skelette beim Appell im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen zu führen. Ein besonderes Vergnügen bereitete ihm die Neuplatzierung eines weiteren gescheiterten Fluchtversuches während des Appells.
Bérénice lief trotz der ultrafeuchten Hitze ein kalter Schauer über den Rücken. Sie warf einen kurzen Blick hinter sich, mehr um sich selbst davon zu überzeugen, dass der Schauer nicht auf einen Verfolger gründete, sondern auf das tief empfundene Grauen, welches der Anblick der Skelette immer noch in ihr erzeugte. Sie fiel in einen langsameren Trott, beobachtete noch genauer den dichten Wald.
Sie suchte bereits nach einem Essigbusch für das Nachtlager. Erfahrungsgemäß fanden sich diese hochinteressanten Pflanzen am oberen Hang eines Hügels oder kleinen Berges, in mehr oder weniger deutlichem Abstand zu allen anderen Gewächsen des Dschungels. Es hatte ziemlich lange gedauert, bis die Spacetrooper die Vorzüge dieses Busches erkannten und zu schätzen gelernt hatten. Ein menschlicher Körper, möglichst direkt auf der Haut und komplett mit den flexiblen Blättern des Essigbusches bedeckt, war so in etwa das abscheulichste, was die restliche samboll´sche Flora – und Fauna – kannte. Was bedeutete, dass man recht ruhig in einer Umgebung sich zur Nachtruhe begeben konnte, die nur so von mörderischem Zeug wimmelte. Und man ertrug gerne den penetranten Geruch, der an edlen Weinessig erinnerte.
Nun ja, auch in der Hölle soll es einen Pausenraum geben, grinste Bérénice vor sich hin, als das Gelände anstieg und eine Viertelstunde später die gelbgrün gefleckten Blätter eines Essigbusches auftauchten. Wie erwartet stand der Busch relativ alleine. Er war nicht besonders groß: etwa 2,5 m hoch, dafür aber fast 5 m im Durchmesser. Leider eignete er sich nicht für einen permanenten Schutz, da seine abgepflückten Blätter nach circa einem Tag trotz des vorherrschenden Saunaklimas völlig aushärteten. Dieser Prozess stellte noch eines der einfacheren ungelösten Geheimnisse des Essigbusches dar. Die papierdünnen Blätter wurden dabei steinhart und an den Kanten rasiermesserscharf, was ein längeres Tragen am Körper unmöglich machte. Bérénice indes war es egal, dass sie jede Nacht neue Blätter würde pflücken müssen. Hauptsache, sie konnte sich niederlegen und wieder aufwachen, ohne gefressen worden zu sein.
Bérénice hielt für einen Moment inne, um zu verschnaufen. Und das rettete ihr das Leben, denn so leise sie sich auch bewegt hatte, ihr Dauerlauf verursachte auch auf dem weichen Pflanzenboden tapsende Geräusche. Dazu raschelnde Blätter, der Wind, der eigene Atem. Als durchtrainierte Spacetrooperin mit Hang zu Marathonläufen funktionierten ihre Lungen wie automatische Blasebälge, die gleichmäßig und vor allem leise arbeiteten. Nichtsdestotrotz machte alles zusammen aber ein Geräuschszenario, welches wirklich fast unhörbare Räuber übertönte. Sie stand vielleicht eine halbe Minute still und exerzierte eine Atemübung, die es ihr erlaubte, in kürzester Zeit flacher zu atmen, da hörte sie es. Ein leises Flattern, das ein normaler Mensch sicher irgendeinem exotischen Blattwerk zugeordnet hätte. Bérénice nicht. Dafür war sie schon zu lange auf diesem Planeten.
Mit einer fließenden Bewegung griff sie sich auf den Rücken, zog das einem Katana ähnliche Schwert und warf sich mit dem Rücken an den nächsten Stamm. Sie hielt das Katana beidhändig schräg gesenkt vor sich, als die ledrigen Schwingen des halbintelligenten Flugaffen auch schon aus dem Blätterwerk brachen. Das Wesen hatte erkannt, dass seine Deckung sinnlos geworden war und es – wenn es noch Erfolg haben wollte – sofort angreifen musste, bevor sich sein Opfer völlig auf die neue Situation eingestellt hatte. Die mannslangen Flügel schlugen heftig, um mehr Geschwindigkeit zu erzeugen. Das reißzahnbewehrte Maul öffnete sich gierig. Eigentlich zählte der Flugaffe eher zu einer Fledermausspezies, doch seine Kopfform und sein dichtes Fell hatten ihm – zumindest bei den Menschen – den Namen Flugaffe eingebracht. Bérénice spannte ihre Muskeln. Sie wusste, dass sie nur einen einzigen Schlag würde machen können. Denn wenn der Flugaffe auf sie stürzte, würde er sie mit seinem schieren Gewicht zu Boden drücken und ihr die Handlungsfreiheit nehmen. Einmal in seinen unterarmlangen Klauen, ein Biss seiner Fangzähne, und sie wäre das nächste Skelett an einer Sambolli-Hauswand. Rasch verdrängte sie dieses Bild aus ihrem Kopf.
Der Flugaffe machte jetzt seinen zweiten Fehler: Anstatt seine Flügelklauen in das Fleisch des Menschen unter ihm zu schlagen, reckte er der Frau den Kopf mit seinen Reißzähnen entgegen. Er war auf einen halben Meter an sie heran, als Bérénice in letzter Sekunde einen kleinen Schritt zu Seite machte und mit einem gewaltigen Aufwärtshieb den Kopf vom Leib des Flugaffen trennte. Sie konnte nicht mehr verhindern, dass der Rest des Körpers sie zu Boden riss und wand sich mit aller Kraft unter dem Tier hinweg, um nicht erdrückt oder von ihrem eigenen Schwert verletzt zu werden. Das, was sie nicht verhindern konnte, war, dass eine der Krallen ihr die Seite aufschlitzte. Bérénice ächzte aufgrund des Schmerzes und der Kraftanstrengung und befreite sich mit einem letzten Tritt ihrer Beine von dem Kadaver. Mehr aus antrainiertem Reflex heraus trat sie einen weiteren Schritt zurück, stöhnte erneut, als sie dabei die Wunde mit dem Ellenbogen berührte, und blickte in die Höhe. Sie drehte sich langsam einmal vollständig herum, versuchte dabei sich völlig lautlos zu bewegen und lauschte angestrengt. Flugaffen jagten manchmal auch zu zweit, vor allem wenn es Paarungszeit war. Doch ob dies gerade der Fall war, konnte sie nicht sagen. Sie hoffte es nicht, denn ein zweiter Flugaffe wäre jetzt gewarnt und würde sie nur noch aus dem Hinterhalt anfallen, ohne sich wie dieser vorher durch ein Geräusch zu verraten. Sie hörte nichts. Nun, das hatte noch nichts zu sagen. Entweder war das Vieh tatsächlich alleine, was die Regel war, denn Flugaffen pflegten einen ausgesprochenen Futterneid. Sollte jedoch Paarungszeit sein, dann würde der Partner überaus hartnäckig sein, denn ein Männchen benötigte große Beute um ein Weibchen zu beeindrucken. Und ein Weibchen verlangte über das normale Maß Nahrung, da es sich Fett anfressen musste, um das Junge im Bauch zu versorgen. Doch es blieb still.
Bérénice wandte sich wieder dem Kadaver zu und beobachtete, wie es rings um den toten Körper zu rascheln begann. Mit Ekel beobachtete sie, wie sich erst drei, dann acht, dann immer mehr armdicke Aasmaden aus dem Boden schlängelten und sich sofort an die Arbeit machten. Sie trat ein paar Schritte zurück und hob noch einmal die Augen in die Wipfel. Alles blieb ruhig. Sogar die Aasmaden verzehrten ihre Mahlzeit mit einem fast unhörbaren Schmatzen. Sie hatte doppeltes Glück gehabt; der Flugaffe war alleine gewesen, denn sonst wären die Maden nicht so schnell an die Oberfläche gekommen. Diese Mistviecher konnten selbst durch das dichteste Pflanzenbett jegliches Lebewesen riechen, ob lebendig oder tot. Ein zweiter Flugaffe wäre ihnen nicht entgangen und sie wären im Boden versteckt geblieben.
Sie behielt das Schwert in lockerer Haltung in der Rechten. Mit der Linken bedeckte sie die Wunde. Sie schritt langsam den Hügel hinauf und näherte sich dem Essigbusch. Es war ein kleinerer Hügel, vielleicht zwölf, höchstens fünfzehn Meter hoch, doch jeder Schritt tat ihr weh. Als sie den Busch erreicht hatte, machte sie noch einmal eine komplette Drehung und versuchte im dampfenden Dschungelnebel auffällige Landmarken auszumachen. Vergeblich.
Also gut, dann eben erst morgen früh, dachte Bérénice und steckte das Schwert zurück in die Scheide am Rücken. Sie dankte Gott für Dr. Muramasa, der ihr das Ding geschenkt hatte. Sie sah wieder sein Gesicht vor sich. Traurig, da er ihr sein Schwert gegeben hatte, das er für seine Flucht erschaffen hatte. Aber auch froh, in dem Bewusstsein, dass es ihr sicher mehr helfen würde als ihm. Sie hatte ihn nicht gefragt, wie und woraus er es hergestellt hatte. Sie hatte es dankbar angenommen. Ihre Dankbarkeit hatte sich in stille Verehrung verwandelt, als er ihr eröffnet hatte, warum er es ihr gegeben hatte und nicht selbst damit geflüchtet war. Er hatte sich bei einem seiner Patienten den kyllranischen Narbenkrebs geholt. Eine der wenigen Krebsarten, die manchmal ansteckend war. Doch er hatte auch gelächelt, denn sie hatte nicht nur das Schwert angenommen, sondern – im Gegensatz zu einigen sturen, besserwisserischen Männern, die geflohen waren und nun als Skelettzierden fungierten – auch seinen Rat.
»Wenn Sie Ihre Flucht vorbereiten, Bérénice«, hatte er sie beschworen, »dann legen Sie sich keine Fluchtvorräte an, basteln Sie sich nichts, stehlen Sie nichts!« Sie hatte verwundert den Kopf gehoben und ihn angesehen, als wäre er verrückt geworden.
»Warum nicht, Doktor?«
»Weil die Sambolli echte Kontrollfreaks sind. Der schreckliche Morgenappell dient nicht nur der Zählung der Gefangenen und dem Anblick der Skelette, sondern die Wärter filzen in den Baracken alles, und ich meine alles.« Sein Tonfall war nachdrücklich, ja fast verzweifelt gewesen. Wie oft hatte er gescheitere Flüchtlinge zusammenflicken müssen, die entweder gar nicht das Lager verlassen hatten oder nicht weit gekommen waren. Es waren wenige genug, die überhaupt noch am Leben waren.
»Die spärlichen Lebensmittel, die wir erhalten, sind exakt portioniert. Jegliches Material und Werkzeug wird mehrfach überprüft: wer es bekommt, wie lange er damit arbeitet, was er damit tut und wann er es wem zurückgegeben hat. Die Baracken sind nicht nur deswegen so mickrig, weil es sich aus Sicht der Sambolli nicht lohnt, erträglichere, geschweige denn komfortablere Unterkünfte zu bauen, sondern auch, um zu verhindern, dass die Gefangenen irgendetwas nicht als absolut überlebensnotwendiges Material für irgendwelche Basteleien verwenden könnten.«
Ihr Blick war bei diesen Worten auf das Katana gefallen und sie glaubte zu ahnen, was es ihn gekostet hatte, es geheim herzustellen und – wo auch immer – versteckt zu halten. Umso mehr traf sie die Tragik hinter dieser Waffe. Wahrscheinlich hatte er seit seiner Ankunft im Lager daran gearbeitet, Monat für Monat, wahrscheinlich Jahre. Sie wusste nicht, wie lange Dr. Muramasa schon Lagerarzt war.
»Nehmen Sie es ruhig, ich brauche es nicht mehr. Meine … Flucht benötigt keine Waffen. Und auch die Sambolli können mich nicht aufhalten. In drei, vier … höchstens sechs Monaten werde ich …«
Sie hatte ihm die Hand auf die Schulter gelegt und ihn lange und still, von Tränen überströmt, auf die Wange geküsst. Als sie sich getrennt hatten, hatte er glücklich gelächelt. Erst jetzt begriff sie, dass er glücklich war, da sie seine Flucht vollzog und er davon überzeugt schien, dass sie es schaffen würde. Sie hatte damals nur einen leisen Dank flüstern können und das Schwert an sich genommen.
»Danke, Doktor«, sagte sie jetzt erneut im Schatten des Essigbusches und begann ihre spärliche Bekleidung abzulegen. Das Schwert steckte sie locker in Griffweite direkt neben sich in den Boden. Sie zog sich mechanisch aus und ihre Augen beobachteten die Umgebung, gleichzeitig kramte ihr Gehirn eine weitere Szene hervor.
»Wie soll ich im Dschungel überleben, wenn ich nichts mitnehme?«
»Das Wichtigste ist das Katana. Sie bekommen es von mir am Tag Ihrer Flucht, am besten in der Minute, in der Sie abhauen wollen. Nicht vorher! Der Dschungel von Samboll bietet Ihnen alles, was Sie brauchen: Wasser, Nahrung, Deckung. Deckung im doppelten Sinne, erinnern Sie sich an den Essigbusch! Die unglaubliche Vielzahl an Lebewesen macht es sogar Bioscannern unmöglich Sie zu orten. Sie haben ohnehin keinerlei technisches Gerät dabei, was man anpeilen könnte. Der Boden ist so mit Metallen angereichert, dass sogar das wenige Metall des Schwertes unmöglich zu orten ist. Sollten Sie das unwahrscheinliche Glück haben, irgendein technisches Gerät in einer Station, einer Mine oder sonst wo zu finden, benutzen Sie es auf keinen Fall. Nehmen Sie mit, was Sie glauben mitnehmen zu müssen, aber denken Sie daran: Geschwindigkeit ist das Wichtigste! Rennen Sie, bis Sie zu müde sind, einen weiteren Schritt zu tun. Je weiter Sie vom Lager entfernt sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, auf Suchtrupps zu stoßen. Halten Sie die Richtung, orientieren Sie sich an irgendeinem Sternbild, keinem Kompass! Keine Funkpeilung! Sollten Sie ein Funkgerät finden, nehmen Sie es mit, aber funken Sie damit nicht, bevor Sie den Planeten verlassen haben!«
»Den Planeten verlassen? Wie soll ich das schaffen?«
»Später«, hatte er ungeduldig geantwortet. Dr. Muramasa hatte sich in Aufregung geredet. »Wasser finden Sie in Lotus-ähnlichen Blumen. Achtung, es schwimmen immer – immer! – Parasiten darin. Gottlob sind die Dinger daumennagelgroß; nehmen Sie zwei Stöckchen, um sie aus dem Kelch zu fischen, nicht die Finger! Die Biester beißen sofort zu. Und sie dann wieder aus dem Körper zu entfernen, ist ohne chirurgisches Werkzeug nicht zu schaffen. Trinken Sie ohne Angst. Das Wasser ist frisch, auch wenn es lauwarm ist. Es ist sehr gut. Ich habe es hier getestet.«
Sein Blick hatte sich ein wenig getrübt und Bérénice hatte nicht gefragt, wie er es getestet hatte. Schließlich stand ihm keinerlei Laborausrüstung zur Verfügung.
»Folgendes an Nahrung können Sie verzehren: nämlich alles, was fliegt und in den Bäumen haust. Verzichten Sie auf alles, was Sie am Boden finden, insbesondere Aasmaden, die sind voller Bakterien. Auch wenn Ihnen ein Bodentier in seiner Erscheinungsform einem irdischen sehr ähnlich vorkommt und essbar erscheint, verzichten Sie darauf! Es ist fast die Regel, dass diese Tiere von den gleichen Bakterien verseucht sind wie die Aasmaden. Klettern Sie auf die Bäume und holen Sie sich die Eier aus den Gelegen, die können Sie roh essen. Jegliches Fluggetier müssen Sie leider braten und das ist eigentlich das Schwierigste dabei. Denn in dem schwülfeuchten Dschungel werden Sie an der Oberfläche kein trockenes Stück Holz finden. Und eine Rauchsäule aus feuchtem Brennholz ist wie ein Leuchtfeuer für die Verfolger.«
»Wie soll ich dann ein Feuer machen? Eine Laserwaffe habe ich nicht, chemische Zünder …«
»… müssen Sie sich selbst herstellen«, hatte der Doktor lapidar den Satz beendet. »Sie behalten die Knochen der Flugtiere und zerreiben sie nach einer Woche mit einem Mahlstein zu Staub; basteln Sie sich aus Rinde einen kleinen Korb und dichten Sie ihn mit den anfangs elastischen Blättern des Essigbusches von innen ab. In einem größeren Sack – den Sie von mir bekommen – sammeln Sie die Blätter des Körperschutzes, wenn Sie ihn am Morgen abnehmen.« Er schmunzelte dabei, vielleicht hatte er sich die Szene vorgestellt, in der sie ihre atemberaubende Figur im wahrsten Sinne des Wortes völlig entblätterte. Sie hatte ihn dabei durchschaut und war rot geworden.
»Und was soll ich als Brennmaterial verwenden, Dr. Muramasa?«
»Etwa einen halben Meter unter der lockeren Pflanzenschicht finden Sie abgestorbene Wurzeln. Machen Sie trotzdem nur sehr kleine Feuer, nur so viel, wie Sie für den Braten benötigen. Es ist sinnvoll, kleinere Flugtiere zu erlegen, als ein größeres, das ohnehin nur Aasfresser anlockt, bevor Sie es zerlegen, braten, geschweige denn verzehren können. Wedeln Sie beim geringsten Rauch die Fahne so weit auseinander, wie Sie können. Die Chance, dass der Rauch als dampfender Dschungel wahrgenommen wird, ist durchaus gegeben. Sicherer ist es jedoch, wenn Sie auf solche Tätigkeiten verzichten, wenn Sie nicht absolut der Meinung sind, dass Sie im Umkreis von mehreren Kilometern alleine sind. Vergraben Sie alles, was auf Ihr Lager hindeuten könnte. Decken Sie den Boden wieder mit Pflanzenresten zu. Die getrockneten Blätter eines Essigbusches wären zwar trocken genug für ein Feuer, sind aber so hart und dünn, dass ihr Brennwert recht niedrig ist.«
Bérénice hatte sich während dieser Erinnerung daran gemacht, ihren Körperschutz anzulegen. Als ersten Schritt hatte sie aus mehreren Kelchen Wasser zum Waschen verwendet, nicht ohne vorher peinlich darauf zu achten, dass sie alle Parasiten entfernt hatte und sich am Boden des Kelches nicht doch noch welche versteckt hielten. Die letzten drei Kelche löschten ihren Durst. Wie der Doktor gesagt hatte, war das Wasser lauwarm, aber vom Geschmack her vorzüglich. Nackt und sauber, wie sie nun war, schob sie sich so weit in die Mitte des Essigbusches, wie sie nur konnte, pflückte die inneren, weichen Blätter ab und klebte sie auf den neuen, dünnen Schweißfilm, der ihr aus den Poren trat. Die seitliche Wunde entpuppte sich als ein langer Schnitt, der aber nicht so tief ging, dass sie sich Sorgen machen musste. Hier hatte sie besonders auf eine dicke Schicht Blätter geachtet. Wie sie es gelernt hatte, überlappte sie die Blätter großzügig, damit nicht die kleinste Lücke blieb. Als sie damit fertig war, trat sie mit einem dicken Bündel weiterer Blätter aus dem Busch hervor. Sie befolgte einen weiteren Rat des Doktors. Sie entfernte sich mehr als fünfzig Meter den Hügel aufwärts vom Essigbusch, denn auch die Sambolli wussten um dessen Funktion, und mehr als ein Flüchtiger war inmitten eines Essigbusches aufgespürt worden.
Im Dschungel war es ohnehin auch am Tag nicht besonders hell, aber jetzt kündigte sich deutlich die Nacht an. Sie häufte ihre Kleidung zu einem Pack, der ihr als Kopfkissen diente, deckte diesen mit einem halben Dutzend der großen Blätter ab und legte sich den Rest locker um den Kopf und auf das Gesicht.
»Haben Sie keine Angst, sich sozusagen blind in den Dschungel zu legen, Bérénice«, erklang noch einmal Dr. Muramasas Stimme in ihr. »Der Essigbusch ist ein Exot unter der Flora von Samboll. Sein Geruch, selbst eine gewisse Anzahl seiner Blätter, ist jedem Tier und vor allem auch jeder Kriechpflanze so verhasst, dass Sie beruhigt schlafen können. Natürlich schützen Sie die Blätter nicht vor einer Entdeckung durch einen Verfolgertrupp. Ich bin übrigens der Meinung, dass die Pflanze gar keine einheimische samboll´sche Pflanze ist, sondern von Raumfahrern nach Samboll gebracht wurde. Ich kann nicht sagen, ob es die Sambolli selbst oder andere waren. Aber danken Sie – wem auch immer – dafür, dass er es getan hat. Sonst wüsste ich nicht, wie Sie alleine die Nacht überleben sollten. Ein Dschungeltag auf Samboll ist schon schlimm genug.«
Bérénice Savoy erwachte aus ihrem leichten Schlaf durch ein Geräusch, das nicht weiter als zwanzig Schritte entfernt erzeugt wurde. Mit unglaublicher Willensanstrengung zwang sie sich, nicht aufzuspringen, sondern vorsichtig den angewinkelten Arm an ihr Gesicht zu bewegen. Sie lag zwar in einem Dreieck aus dicken Stämmen verdeckt, aber sie wollte nichts riskieren. Sie zählte stumm 60 Sekunden ab, bis ihre Finger lautlos eine Lücke für die Augen geschaffen hatten. Sie blinzelte ein paar Mal und es dauerte weitere kostbare Sekunden, bis sich ihre Augen an das dämmrige grüne Durcheinander angepasst hatten. Dann sah sie am linken Rand ihres spärlichen Blickfeldes ein sandbraunes Fell gerade noch hinter einem Stamm verschwinden. Innerlich seufzte sie auf. Sie kannte das Tier. Es war einem irdischen Pekari sehr ähnlich, hatte sogar ungefähr dessen Größe, allerdings einen langen Hals, auf dem ein giraffenähnlicher Kopf saß. Der halbe Kopf bestand aus einem höchst flexiblen Maul, mit dem es genussvoll junge Triebe gerade der Pflanzen mampfte, die Bérénice als Trinkkelche gedient hatten. Der Rest des Kopfes wurde von zwei übergroßen Augen eingenommen, die misstrauisch die Wipfel beobachteten. Es war ein harmloser Pflanzenfresser, der noch nicht einmal einen menschlichen Namen erhalten hatte.
Kein Wunder, als Gefangener hast du ganz andere Probleme, als außerirdischen Viechern Namen zu verleihen, dachte Bérénice und erhob sich leise. Trotzdem nicht leise genug, denn das Tier senkte den Kopf und rannte davon. Bérénice lächelte, als sie sah, dass das Tier ihr einen vorwurfsvollen Blick zurückwarf und dabei weiterhin die Blätter, die es im Maul hatte, zerkaute. Auch wenn es noch keinen Namen hatte, wusste die Frau, die sich nun vollends aus den zerdrückten Blättern schälte, dass dieses Felltier als äußerst scheu galt und sich deshalb im weiteren Umkreis kein anderes größeres Lebewesen aufhalten dürfte.
Sie hatte trotz aller Beteuerungen des Doktors recht unruhig geschlafen und war auch mehrfach aufgewacht. Entgegen ihrer Erwartung war tatsächlich nichts passiert und sie fühlte sich mäßig erholt. Die Wunde an der Seite hatte sich geschlossen. Sie war zwar noch gerötet, aber eine Entzündung zeigte sich nicht. Sie würde wahrscheinlich wieder aufplatzen, sobald sie sich stärker bewegte, aber das ließ sich nicht ändern.
»Schmieren Sie sich ein wenig Asche aus Ihren Feuerstellen auf Wunden, sollten Sie welche haben«, hatte der Doktor gesagt, aber sie hatte noch keine Asche, dafür umso mehr Hunger.
»Ich bin noch zu nahe am Lager, also kein Frühstück«, murmelte sie sich selbst zu und untersuchte penibel ihre wenigen Kleidungsstücke, bevor sie sie anzog. Sie schüttete die Essigblätter in den Sack des Doktors und steckte das Katana in die Scheide. Neben dem Schwert stellten ihre Stiefel den kostbarsten Besitz dar. Es war der letzte Rest ihres Raum- und Kampfanzuges, den man ihr und auch den anderen Gefangenen gelassen hatte. Alles, was den Sambolli irgendwie seltsam vorgekommen war, hatte man entfernt. Sie nahm einen Schluck aus einem von Parasiten befreiten Kelch und schritt langsam an den höchsten Punkt des Hügels zurück.
»Grün, Grün und nochmals Grün.« Bérénice orientierte sich am Stand der dunkelgelben Sonne. »Das Lager ist im Norden; der Doktor hat gesagt, ich soll immer nach Süden gehen, und jegliches Wasser, das hier auf diesem Breitengrad fließt, strebt gen Süden.« Sie drehte sich in diese Richtung und entdeckte auf Südsüdost am Horizont einen Hügel, der schon eher die Bezeichnung Berg verdiente, wenn er auf diese Entfernung wesentlich aus dem Dickicht hervorragte. Ihr Magen knurrte.
»Jetzt noch nicht, Kleiner«, knurrte sie zurück und machte sich auf den Weg.
Bérénice war nach ihrem Zeitgefühl vielleicht eineinhalb, höchstens zwei Stunden in lockerem Trab unterwegs – den ersten Hunger hatte sie längst überwunden –, als ein Gefühl ihr sagte, dass in diesem Stück Wald etwas anders war. Sie hielt inne, zog lautlos ihr Schwert und rückte an einen Stamm heran. Blicke nach oben, nach allen Richtungen zeigten nichts Auffälliges. Sie atmete zwei, drei Mal tief durch und entspannte sich. Stille, alles ruhig. Sie blieb mehrere Minuten stehen, bis ihr klar wurde, was das Gefühl ausgelöst haben musste. Es war zu still.
Ihr Sichtfeld umfasste im besten Falle fünfundzwanzig, dreißig Meter, da die Bäume und anderes Gewächs zu dicht standen. Sie wagte sich nicht weiter. Ihre Augen suchten ein Versteck, und schließlich entschied sie sich, einen der dickeren Stämme zu erklettern. Erstens erhoffte sie sich davon, einer Bedrohung am Boden zu entgehen, zweitens einen besseren Überblick und drittens die Aussicht auf ein Nest voller Eier. Sie wollte gerade das Schwert in die Halterung zurückschieben, als ihr Magen erneut – und vor allem unangenehm laut – knurrte.
Verdammt, ruhig jetzt, dachte sie und wartete zwei weitere Minuten. Als sich nichts tat, begann sie mit der Kletterei. Sie packte dicke hellgrüne Lianen, vermied die älteren, dunkelgrünen. Noch ein Tipp des Doktors. Die jungen Lianen raschelten nicht und so zog sie sich zügig in eine Höhe von acht oder neun Metern. Sie machte es sich in einer Gabelung aus drei dicken Ästen einigermaßen bequem und hielt erneut inne. Ein Blick nach oben zeigte leere Wipfel, kein Flugaffennest oder anderes Viehzeug. Allerdings sah sie zwei Meter über sich eine sehr runde Blattgruppe. Das könnte ein Nest mit Eiern sein. Als hätte ihr Magen den Gedanken verstanden, meldete er sich zum dritten Mal und Bérénice verfluchte sich selbst, dass sie so lange gewartet hatte, etwas Essbares zu finden. Jetzt konnte das Knurren sie verraten. Wer oder was auch immer dort unten herumschlich, konnte vielleicht so gute Ohren haben, dass es ihm möglich war, ihren Magen zu hören. Bérénice sammelte Speichel, bis ihr Mund voll war, und schluckte dann hinunter. Sie hoffte, das würde den Magen für den Moment stillhalten. Sie probierte es ein zweites Mal, brachte aber nichts mehr zusammen und gab es auf. Allerdings schien es funktioniert zu haben. Der Magen blieb so ruhig wie der Dschungel um sie herum.
Ihre Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt und die scheinbar bequeme Haltung stellte sich zunehmend als nicht optimal heraus. Zumindest ein Fuß war ihr eingeschlafen und gefühllos. Wenn sie jetzt kämpfen oder flüchten müsste, hätte sie eindeutig ein Problem. Sie war gerade versucht, den tauben Fuß zu bewegen, als sich etwas am Boden tat. Sie sah vage die Bewegung aus einem Augenwinkel, bevor sie auch nur ein Geräusch vernommen hatte.
Meine Fresse, das nenne ich lautlos.
Sie schmiegte sich in Zeitlupentempo näher an den Stamm und lugte mit einem Auge um ihn herum.
Ein Sambolli, durchzuckte sie es und beinahe hätte sie einen Überraschungslaut ausgestoßen. Doch die Spacetrooperin kniff die Lippen zusammen. Irgendwie sah der Sambolli anders aus als die Kerle, die sie im Gefangenenlager gesehen hatte. Er stand auf seinen zwei langen Beinen, die ungemein muskulös waren, was ihm eine enorme Geschwindigkeit beim Rennen ermöglichte. Ein Mensch hatte keine Chance, einen Sambolli im Wettlauf zu schlagen. Die Taille war dünner als bei einem Magermodel, die zurzeit wieder in Mode kamen, auch wenn Bérénice dies für Schwachsinn hielt. Der Sambolli schräg unter ihr am Dschungelboden würde in diesem Punkt jeden Schönheitswettbewerb gewinnen. Den Brustkorb formte ein überdimensioniertes Dreieck mit drei riesigen Brustmuskeln. Bérénice Savoy wusste, dass sich unter dem Mittleren die Herzgruppe verbarg, tief eingebettet in steinharte Muskelmasse. Auf einem zwanzig Zentimeter langen Hals saß ein wiederum dreieckiger Kopf, in dem drei Augen waagrecht angeordnet waren. Die beiden Äußeren standen weit am Rand des Gesichtes des Sambolli, sodass dessen Blickfeld atemberaubend groß sein musste. Leider hatte Trooper Savoy bei einer entsprechenden Instruktion vor der Landung auf Samboll nicht besonders aufmerksam zugehört. Es genügte ihr jedoch zu wissen, dass das Wesen unter ihr fast hinter sich blicken konnte. Sich also von hinten an einen Sambolli anzuschleichen, war keine gute Idee. Die Haut – soweit man das wegen der Kleidung und Ausrüstung sehen konnte – war glatt, fast wie bei einer Schlange, allerdings hatten die Sambolli keine Schuppen. Sie regelten ihre Körpertemperatur über eine Vielzahl von kleinen und kleinsten Schlitzen in der Haut, die sich regelmäßig öffneten und schlossen. Das dabei austretende Sekret war deutlich dicker als menschlicher Schweiß und verhinderte im Nahkampf, dass man einen Sambolli fest zu packen bekam.
Ein hervorragender Vorteil, grummelte die Frau im Baum stumm in sich hinein. Also Ringkampf fällt auch aus.
Jetzt, da der Einheimische unter ihr sichtlich entspannt oder zumindest ruhig war, zeigten sich nur sehr wenige Schlitze in verhaltener Aktivität. Strengte sich ein Sambolli an oder war er aufgeregt, war dies völlig anders. Sicherlich auch ein Überbleibsel der Evolution aus primitiveren Tagen, in denen die Sambolli noch keine Kleidung oder moderne Waffen entwickelt hatten.
Die Haare des Wesens glichen schlanken, langen Blättern, auch wenn sie die Farbe von Haselnüssen hatten. Die Haut zeigte ein angenehmes Braun wie gedunkeltes Kiefernholz, in den Achseln und Kehlungen der Arm- und Fußbeugen mit noch dunkleren Schattierungen. Ältere Sambolli, so wusste Bérénice, zeigten blassere und grauere Bräunungen, die bis zum natürlichen Tod nachdunkelten. Allerdings hatte Bérénice noch nie einen toten Sambolli gesehen. Diesen Teil der Instruktion hatte sie jedoch noch sehr deutlich im Gedächtnis. Im Lager hätte sich jeder den Anblick eines toten Sambolli gewünscht.
Die Kleidung – jetzt fiel Bérénice auf, was ihr an diesem Sambolli so anders vorkam – hatte eine gewisse Lockerheit, die sie von den militärischen Kleidungen ihrer Bewacher nicht kannte. Auch das Ding, das er in seinen beiden kräftigen Armen hielt, war keine Militärwaffe, sondern sah eher … privat aus.
Ein Jäger … ein Sportschütze? Ist das möglich? So nahe am Lager? Sie konnte noch keine zwanzig Kilometer weit gekommen sein. War es denkbar, dass sich die Sambolli mit der Jagd als Freizeitbeschäftigung befassten? Warum nicht?
Spacetrooper Bérénice Savoy überlegte fieberhaft. Sollte sie das unverschämte Glück haben, auf einen Zivilisten gestoßen zu sein, der nicht sie, sondern irgendein Viehzeug jagte? Und wenn ja: War er allein oder Teil einer Jagdgemeinschaft? Und wie war er hierhergekommen? Sicherlich nicht zu Fuß, denn die nächste Ansiedlung oder Stadt musste Hunderte von Kilometern entfernt liegen, schließlich waren sie mit dem Gefangenentransport stundenlang geflogen. In gemächlichem Tempo, aber eben sehr lange.
Also hat er oder haben sie ein Fahrzeug! Diese Erkenntnis vertiefte ihr Gefühl, an einen glücklichen Zufall zu glauben. Was jagt der Kerl überhaupt? Sie hatte den Gedanken noch im Kopf schwirren, als sie eine weitere Bewegung, weit entfernt im Dickicht der Bäume, wahrnahm. Doch es war nicht die Beute, sondern ein zweiter Sambolli, und direkt neben diesem schob sich langsam aus dem Blattgewirr ein Dritter. Beide nickten dem Ersten zu und entfernten sich unglaublich langsam voneinander.
Sie teilen sich, um dem Jäger aus zwei Positionen Deckung geben zu können, durchfuhr es Bérénice und sie verfolgte gespannt die Bewegungen der beiden. Der Erste stand unverändert still, nur seine Augen waren hellwach. Die Frau betete darum, dass er nicht zu ihr nach oben blickte. Auf diese kurze Distanz musste er sie sofort sehen. Allerdings blieben seine Augen parallel zum Boden gerichtet. Die beiden anderen Sambolli schienen ihre Ziele erreicht zu haben und hielten an. Die Läufe ihrer Waffen hatten sie die ganze Zeit waagrecht gehalten, nun schwenkten sie ein paar Grad nach oben.
Sie jagen ein Bodentier, und zwar ein großes!
In diesem Moment gab ihr Magen ein langes, fürchterlich lautes Knarren von sich und Bérénice wäre vor Schreck fast vom Baum gefallen. Der Sambolli unter ihr hatte es natürlich gehört und sein Kopf zuckte in ihre Richtung. Doch bevor er auch nur einen Laut von sich geben konnte, wurde die Stille des Dschungels in einer Art und Weise unterbrochen, wie es sich die Menschenfrau nicht hätte vorstellen können.
Ein Ungetüm mit der unerfreulichen Größe von drei Metern bis zur Schulter, der Brustbreite eines ausgewachsenen Elefanten und Beinen, die an dorische Säulen erinnerten, brach durch die Blätterwand der dicht beieinanderstehenden Bäume. Dass es dabei kleine bis mittlere Bäume niederwalzte, störte seinen Lauf nicht im Geringsten. Das Vieh stieß ein Röhren aus, welches einem Ozeandampfer alle Ehre gemacht hätte, gefolgt von einem wütenden Gurgeln. Was das Tier so wütend gemacht hatte, sah Bérénice erst, als es vollständig sichtbar war: In einer Körperseite steckten mehrere kurze Stacheln, die, so wie sie jetzt beobachten konnte, aus den seltsamen Waffen der Sambolli stammten. Die beiden Partner des Jägers schossen einen Stachel nach dem anderen aus ihren harpunenähnlichen Geräten, doch das Monstrum zeigte sich davon völlig unbeeindruckt. Umso mehr war Bérénice vom Verhalten des ersten Jägers beeindruckt. Er hatte sie vielleicht gesehen, ignorierte sie jetzt aber oder wollte sich zuerst seiner Beute widmen. Er blieb einfach stehen und ließ das Tier auf sich zu rennen. Auch er hob zwar seine Waffe, schoss damit aber nicht. Jetzt begriff Bérénice.
Er spielt den Lockvogel! Das Vieh ist so auf den sichtbaren Gegner fixiert, dass es die beiden seitlichen Schützen gar nicht wahrnimmt. Bérénice beugte sich ein wenig vor, um das Geschehen weiter verfolgen zu können, das jetzt teilweise durch den dicken Baumstamm verdeckt wurde, hinter dem sie sich verbarg. Und wieder ließ sich der Sambolli von ihr ablenken. Vielleicht lag es daran, dass er in seiner Konzentration auf die Jagdtrophäe nicht mit dem Anblick eines ihm möglicherweise unbekannten Lebewesens gerechnet hatte. Schließlich war dies seine Jagd, sein Dschungel, sein Planet! Vielleicht war er aber auch nur ein schlechter Jäger, mutig, aber unerfahren. Seine beiden Kameraden schienen zu bemerken, dass etwas nicht stimmte, und schossen mit aufflammender Panik einen Stachel nach dem anderen in die Flanken der anstürmenden Bestie.
Doch es half nichts.
Das Tier ließ sich allein dadurch nicht aufhalten. Bérénice vermutete, dass die beiden auf irgendeine Aktion des Ersten gewartet hatten, die nun nicht kam, weil sie ihn abgelenkt hatte. Sollte er eine bestimmte todbringende Stelle mit seiner Waffe treffen, sollte er mit seinen kräftigen Beinen hoch in die Luft springen; sie wusste es nicht. Ihr Magenknurren hatte er zwar gehört, sie aber nicht gesehen. Ihre Bewegung hatte sie zum Teil aus ihrer Deckung gebracht, und das hatte er gesehen. Er musste völlig überrascht und eventuell sogar verwirrt worden sein.
Auf jeden Fall kam seine Reaktion jetzt zu spät. Das Tier war heran und tat, was es von Anfang an hatte tun wollen: Es walzte mit seinem Körper auf den Sambolli zu, rammte ihn, stemmte sich mit allen Säulenbeinen tief in den Dschungelboden, um seinen Schwung abzubremsen, und ruckte augenblicklich herum. Der am Boden liegende Jäger hatte keine Chance mehr zu einem eigenen Schuss. Seine beiden Partner schossen nun mit aller Verzweiflung Stachel auf Stachel, jetzt auch in den Kopf des Tieres, was sie vorher tunlichst vermieden hatten. Bérénices Gedanken wirbelten wie verrückt. Sicher wäre dies die Trophäe gewesen. Der Kopf des Monsters. Nun krümmte sich der erste Jäger am Boden, vermutlich schwer vom Stoß des Tieres verletzt und kroch – ein verdrehtes Bein hinter sich her schleifend – auf die Waffe zu, welche ihm aus den Händen gefallen war. Er würde sie nicht mehr erreichen. Das Tier war zurück und begann nun auf dem Jäger herumzutrampeln, der sich schon nach dem ersten Tritt nicht mehr rührte.
Das ist meine Chance, erkannte Bérénice und ließ sich aus der Gabelung fallen. Als sie auf den Boden auftraf, rollte sie sich geschickt ab und zog im Aufschwung das Katana aus der Rückenscheide. Mit rasenden Schritten – die tausend Ameisen im linken, gehemmten Fuß zähneknirschend unterdrückend – eilte sie auf einen der beiden Sambolli zu. Der war viel zu überrascht, um auch nur zu begreifen, was da auf ihn zukam. Sein Blick – und seine Waffe – schwenkten zwischen dem Tier und dem neuen Gegner hin und her. Seine Unentschlossenheit kostete ihn das Leben. Bérénice versuchte gar nicht erst, das Herz in der Körpermitte zu durchstoßen. Schließlich verfügte sie nicht über ein echtes japanisches Katana, sondern nur um eine primitive Ausgabe davon. Diese genügte aber immerhin, um den Kopf des Sambolli mit einem blitzartigen, sauberen Schnitt vom dünnen Hals zu trennen. Der Körper stand noch, als Bérénice wie eine Furie auf den letzten Gegner zuschoss.
Doch dieser hatte sich von seinem Schreck erholt. Sein erster Partner war nur noch braunroter Matsch in einer ständig tiefer werdenden Mulde, in der sich das Untier immer noch austobte. Aus dessen Körper ragten mittlerweile mindestens vierzig bis fünfzig Stacheln, die es töten mussten. Aber die Raserei des Tieres verhinderte, dass es selbst begriff, dass es tödlich getroffen war. Der letzte Sambolli hatte seinen zweiten Partner fallen sehen; in zwei Teilen. Er verstand, dass momentan nicht das Tier, sondern dieses dunkelhäutige Geschöpf mit dem Schwert die gefährlichste Bedrohung in diesem Teil des Dschungels darstellte. Er wollte seine Waffe auf Bérénice richten und schaffte es auch. Aber im Magazin des Stachlers war kein einziges Projektil mehr. Im gleichen Augenblick, als die Betätigung des Abzuges ein leises Klicken erzeugte, war Bérénice heran und schlug ihm den rechten Arm von schräg unten nach oben ab. Mit einem senkrechten Hieb hackte sie den Schädel und den langen Hals entzwei. Erst als sie auf die Schulterknochen und das Muskelpaket des Brustkorbs traf, drang ihr Schwert nicht weiter ein.
Mit einem wütenden Ruck zog sie die blutverschmierte Klinge aus dem Brustansatz und rollte sich weiter weg von dem waidwunden Tier. Mit keuchendem Atem und zitternden Beinen beobachtete Bérénice Savoy, wie die Kraft der Bestie erlahmte, sie nach zwei, drei letzten schwachen Tritten innehielt und nach einer quälend langen Pause seitlich wegkippte. Eine Gruppe von Beinmuskeln ließ den ganzen Körper mit einem Zitteranfall erschauern, dann lag er still. Die Kreatur lebte noch, hatte aber mit ihrem primitiven Gehirn nun vielleicht endlich verstanden, dass es keine Gegner mehr gab und ihr eigenes Leben zu Ende ging. Sie atmete schwer, durchzogen von nass klingenden Gurgellauten, die Abstände von Mal zu Mal länger werdend. Der letzte Atemzug zischte wie aus einem defekten Luftballon, dünn und lang gezogen, dann lag sie tot in der Mulde, die sie in ihrer Raserei selbst geschaffen hatte.
Bérénice konnte es nicht glauben: Sie hatte es überlebt. Drei tote Sambolli, ein riesiges Monster ebenso, von dem weder sie noch irgendein anderer Mensch je gehört hatten. Der Dschungel hielt wieder den Atem an, scheinbar traute sich keines der anderen Tiere, einen Mucks von sich zu geben. Wie lange hatte der Kampf gedauert? Drei, vier, höchstens fünf Minuten. Sie fühlte sich, als wären es zwei Stunden gewesen. Ihre seitliche Wunde war wieder aufgeplatzt und rotes Blut zierte die Fetzen ihres Gefangenenanzuges mit frischer Farbe. Sie wusste, dass sich die Stille nicht lange halten würde. Spätestens dann, wenn der Leichengeruch der vier Lebewesen – seltsam in diesem Zustand noch von Lebewesen zu sprechen – zu verführerisch wurde, würde sich ein Wettlauf um die besten Brocken erheben. Die Versuchung, sich selbst von dem riesigen Kadaver das Lendenstück herauszuschneiden, war übergroß. Doch sie hörte schon Dr. Muramasa schimpfen, wenn sie sich auch nur ein Fitzelchen davon holte. Also ließ sie es.
Sie riss sich zusammen, unterdrückte den Schmerz der wieder aufgebrochenen Seite und kletterte ihren Baum erneut hoch, zielstrebig das mutmaßliche Nest vor Augen. Wie zur Belohnung lagen fünf faustgroße Eier darin. Drei stach sie mit der Spitze ihres Katanas an und schlürfte begierig den Inhalt, die beiden anderen verstaute sie tief im Paket ihrer Essigblätter.
Sie wollte sich schon wieder auf den Weg nach unten machen, als der Dschungel erwachte. Die Bilder und Geräusche, die sie in den nächsten Stunden zu sehen und zu hören bekam, sollte sie so schnell nicht wieder vergessen. Es war ihr unmöglich, die Vielzahl der Aasfresser zu bestimmen, die sich über den gedeckten Tisch vor ihr am Boden hermachten. Reißen, Kauen und Schlucken waren noch die angenehmsten Geräusche, die sie vernahm. Nach wenigen Minuten sah sie nicht mehr hin, was sich da alles an der Beute gütlich tat. Sie wollte die beiden verbliebenen Eier essen, aber ihr verging der Appetit bei dem schrecklichen Gelage unter ihr. Also verlegte sie sich auf die Wundpflege und die Beobachtung des Wipfels über ihr. Sie machte es sich diesmal wirklich bequem und war nach einer halben Stunde trotz anderen Vorhabens wieder eingeschlafen.
Trooper Savoy erwachte ohne Anlass und bemerkte als erstes das Fehlen von Schmatz- und Kaugeräuschen, als zweites die erfreuliche Tatsache, dass die Eltern der von ihr verspeisten Eier nicht sie verspeist hatten, was gut hätte passieren können. Vielleicht hatte ja die Ansammlung der Bodenräuber die Flugtiere von einer Landung in ihrem Nest abgehalten. Was wusste sie schon von samboll´scher Fauna?
Bérénice richtete sich auf und betrachtete das Schlachtfeld am Boden. Fein säuberlich abgenagt lagen dort vier Skelette, ein riesengroßes und drei kleinere. Sie packte die wenigen Sachen zusammen, die sie besaß und stieg mit gespitzten Ohren nach unten. Es war nicht ausgeschlossen, dass die Horde der Aasfresser auch Raubtiere anlockte, welche sich von ihnen ernährten. Doch sie hörte nur das mittlerweile vertraute allgemeine Crescendo des Dschungels.
Zuerst das Praktische, dachte Bérénice und nahm eine der Sambolli-Waffen auf. Sie drehte sie vorsichtig nach allen Seiten und konnte nichts Außergewöhnliches an ihr finden. Im Grunde bestand sie wie eine irdische Harpune aus einem langen Schaft, an den eine Spannvorrichtung angebracht war. Dazu ein Auslöser, ein Schulterstück, eine primitive Zielvorrichtung, die eine verteufelte Ähnlichkeit mit Kimme und Korn aufwies, und einen kleinen Sicherungshebel, sodass der Schütze nicht ungewollt einen Stachel abfeuerte. Der deutlichste Unterschied zu einer irdischen Harpune war das Magazin, das parallel zum Schaft knapp darunter angebracht war. Es ließ sich rasch öffnen und fasste – nach den Einrastungen abgezählt – 37 Stachel. Bérénice zählte zweimal nach, es blieb bei 37 Stück.
Nun ja, die Sambolli müssen ja nicht unbedingt das Dezimalsystem kennen, und wenn doch, hat die Zahl der Stachel vielleicht einen ganz anderen Grund, überlegte sie und sammelte dabei alle Projektile, die sie finden konnte. Auch die, welche in dem Monster gesteckt hatten. Nebst den blitzblanken Knochen lagen die Stacheln ebenso sauber im Skelett der Bestie. Sie vermied es dabei, die Spitzen zu berühren, glaubte zwar nicht, dass diese vergiftet sein könnten – sonst wäre das Vieh wahrscheinlich viel eher tot gewesen –, aber sicher war sicher. Als sie ihre Sammlung beendet hatte, wurde ihr ein weiterer Vorteil der Waffe klar: Sie war erstens fast lautlos und zweitens vor allem nicht energetisch; das hieß, sie konnte auch nicht angepeilt werden. Bérénice lächelte zufrieden. Also würde sie das zusätzliche Gewicht nur zu gerne tragen. Neben ihrem Katana als Nahwaffe besaß sie nun eine ebenso nicht energetische Fernwaffe. Ohne Skrupel steckte sie eine Handvoll kleinerer Knochen in den Sack.
Dann blickte sie sich weiter um und ging den ganzen Kampfplatz systematisch ab. Sie wusste eigentlich gar nicht, was sie suchte, aber als sie es sah, tätschelte sie sich in Gedanken selbst die Schulter.
»Man soll sich doch wirklich ab und zu ein paar Minuten Zeit nehmen, Bérénice«, mahnte und bestätigte sie sich selbst und trat einen Schritt an das kleine Ding vor ihr auf dem Boden heran. Bevor sie sich danach bückte, lauschte und sah sie noch einmal ringsum in den Dschungel. Alles normal laut, kreischend, pfeifend, surrend … und beruhigend weit entfernt. Sie nahm den Gegenstand auf und drehte ihn in der freien Linken; die Rechte hielt den entsicherten Stachler.
Es war ein flacher Quader, etwa zehn bis zwölf Zentimeter lang, ungefähr fingerdick und recht schwer. Die äußere Hülle war anthrazitschwarz und matt. Alle Seiten bis auf eine der großen Flächen waren glatt. Die Oberfläche der strukturierten Seite zeigte keinerlei Symbole oder Schriftzeichen, sondern nur geometrische Vertiefungen, deren Bedeutungen sich ihr verschlossen. Das Ding konnte alles Mögliche sein: Eine Art Datenträger, ein Messinstrument, ein Funkgerät, sogar eine Waffe … oder vielleicht auch nur ein samboll´sches Manikür-Set; was wusste sie schon? Eine Vorrichtung, um es zu öffnen, sah sie auf den ersten Blick nicht. Auch wenn es zusätzliches Gewicht bedeutete und Muramasas Stimme sie stumm tadelte, sie steckte es trotzdem ein. Weitere Gegenstände fand sie nicht.
Danach stand sie eine Weile unentschlossen herum und überlegte ihre nächsten Schritte. Sollte sie auf dem Baum warten, bis die Flugtiere kamen, um ihr Nest zu kontrollieren? Sollte sie diese dann erlegen und als Nahrung verwenden? Sollte sie schleunigst aus dieser Gegend verschwinden, da eventuell die drei Sambolli-Jäger irgendwo vermisst und gesucht wurden? Deutete der Einsatz der relativ primitiven Stachlerwaffen darauf hin, dass die Jäger nicht entdeckt werden wollten und möglicherweise sogar illegal gejagt hatten? Oder sollte sie sich Gedanken machen, wo das Fahrzeug der Jäger stand, es suchen und zur weiteren Flucht benutzen? Wenn sie es fand, konnte sie es denn gefahrlos benutzen oder konnte das Ding – was es auch immer sein mochte – angepeilt werden? Da die Sambolli laut Dr. Muramasa Kontrollfreaks waren, wäre Letzteres wahrscheinlich. Aber die Gelegenheit, damit eine weite Entfernung zwischen sich und das Gefangenenlager zu bringen, war sehr verlockend.
Schließlich zuckte Bérénice die Schultern und schlug den Weg zu dem kleinen Berg ein, der ihr Ziel am südöstlichen Horizont darstellte. Sollte sie auf dem Weg dorthin das Vehikel finden: gut. Sollte sie es nicht: nicht gut, aber nicht zu ändern. Sie hatte keine Lust, die ihr völlig unbekannte Gegend abzugrasen, nur um schlussendlich doch einer Wärtergruppe in die Hände zu laufen. Also, weg von hier! Und Flugtiere gab es sicher auch auf jedem anderen Baum im Dschungel, da musste sie nicht hier verweilen.
Nach sechs Tagen harten Marschierens und Dauerlaufs, unterbrochen von der Jagd auf adlergroße Flugwesen mit seltsamem Federkleid, und der Vermeidung selbst als Jagdbeute zu enden, erreichte Bérénice Savoy deutlich erschöpft den Fuß des kleinen Berges. Sie hatte allerlei kleines, mittleres und großes Getier gesehen, das ihr erstaunlicherweise ausgewichen war, anstatt sie anzugreifen und zu verspeisen. Am zweiten Tag fiel ihr dazu die passende Erklärung ein: Sie war in diesem Dschungel eine unbekannte Größe, ein nicht einzuschätzender Fremdkörper. Die Tiere wichen ihr mit Absicht aus. Sie bedauerte diesen Zustand nicht, ganz im Gegenteil. Doch sie war sich sicher, dass dies nicht auf Dauer so bleiben würde. Schließlich mussten etliche Tiere die schmackhafte Bekanntschaft von Menschen gemacht haben. Vielleicht aber noch nicht in dem Maße, dass es sich von Tier zu Tier bis in diese Gegend herumgesprochen hatte. Die Pflanzenwelt hatte mit ihr nicht solche Probleme. Mehr als einmal musste sie sich mit aufdringlichen Pflanzententakeln, Schlingbüschen und ähnlichem Grobzeug auseinandersetzen. Sie dankte – zum hundertsten Male – Gott und Dr. Muramasa für das Katana.
Bérénice blieb trotz der relativen Ruhe des Dschungels wachsam. Nur zu deutlich hatte sie noch das Getöse des Monsters in den Ohren, das unvermittelt losgebrochen war, als es die Sambolli angegriffen hatte. Aber es musste sich ja dorthin bewegt haben, schließlich glaubte Bérénice nicht, dass sich das riesige Vieh stundenlang im Stillstand versteckt hatte. Ihr wurde bei solchen Überlegungen stets klar, dass sie wirklich unglaubliches Glück gehabt hatte. Und dieses Glück bis jetzt anhielt.
Sie schritt den Vorhügel des Berges hinauf, achtete wie immer auf jede Stelle, wohin sie trat und behielt ständig ihre Umgebung im Auge. Je höher sie stieg, desto leichter konnte sie sich bewegen und – was noch angenehmer war –, desto weiter konnte sie sehen. Als sie mit einem letzten Schnaufen die Spitze des Berges erreichte, bildeten nur wenige Bäume eine lockere Gruppe um sie herum und ein schwacher Luftzug bemühte sich, den Schweißfilm auf ihrer Haut zu trocknen. Bis auf zwei Essigbüsche war der Boden frei. Der ewige Pflanzenteppich aus verrottendem, altem Blattwerk und Bodengewächsen, zeigte einige wenige Stellen, an denen schwarzer Erdboden frei zutage lag. Sie senkte erleichtert ein Knie und legte das Bündel ab, in dem sie ihre wenigen Habseligkeiten verstaut hatte.
Sie hatte einige Versuche gebraucht, bis sie die Anweisungen Dr. Muramasas auch in brauchbare Gegenstände hatte umsetzen können. Aber sie schrieb dies nicht ihrer Ungeschicklichkeit zu, sondern eher der Tatsache, dass sie den Bastelarbeiten nur einen Bruchteil ihrer Aufmerksamkeit und Blicke schenken konnte. Den überwiegenden Teil davon widmete sie der Beobachtung. Sie hatte keine Lust, eine perfekte Schlafstätte herzurichten, nur um dann von einem unbemerkten Raubtier verspeist zu werden.
Sie trat aus der Baumgruppe heraus und versuchte, im aufsteigenden Dunst des Dschungels irgendeine Auffälligkeit im endlosen Grün zu finden. Minutenlang ließ sie ihre Augen sich an das Licht über den Bäumen gewöhnen. Die vielen Stunden und Tage im Dämmerlicht des Bodens machten sich bemerkbar. Die Sonne von Samboll – ihr fiel momentan der Name nicht ein – war wie immer dunkelgelb, aber jetzt erschien sie ihr viel heller als sonst. Doch so lang sie auch blickte, sich Zeit nahm und die flache Bergkuppe komplett umrundete: Sie konnte nichts entdecken, was der genaueren Untersuchung wert wäre. Deutlich frustriert setzte sie sich nieder und blickte starr voraus.
Sie saß noch keine Minute, da fing es unvermittelt zu regnen an. Die Tropfen fielen leise nieder, nur die Aufschläge auf das Blattgewirr erzeugten Treffergeräusche. Innerhalb weniger Augenblicke legte der Regen so an Kraft zu, dass ein anschwellendes Rauschen entstand, das sich bis zu einem gleichmäßigen Prasseln steigerte, als die Tropfen an Größe und Zahl enorm zunahmen. Bérénice war ohnehin durchgeschwitzt und genoss für einige Augenblicke das frische Wasser. Sie wagte es sogar, für einige Sekunden die Augen zu schließen, riss sie aber sofort wieder auf, als ihr bewusst wurde, dass sie bei dem Lärm sich nur noch auf ihre Augen verlassen konnte. Sehen konnte sie in dem dicht fallenden Regen keinen Angreifer. Ernüchtert stand sie auf und blickte erschrocken in alle Richtungen.
Sie hatte die Bergkuppe erneut halb umrundet, als ihr ein seltsamer Effekt auffiel. Im rechten Winkel zu ihrer bisherigen Fluchtrichtung nach rechts, also in etwa Westsüdwest erzeugte der strömende Regen ein für einen Dschungel unnormales Bild. In einer Distanz von circa 300 Metern traf der Regen auf eine Kugel, die aus der Ebene der Baumwipfel ein wenig hervorragte. Die eigentliche Kugel war tatsächlich nicht zu sehen, nur die auftreffenden Tropfen und das abfließende Wasser bildeten eine auffällige Schale.
Ein Schutzschirm, erregte sich Bérénice und griff sofort nach ihren Waffen. Doch mitten in der Bewegung hielt sie inne und schalt sich selbst einen Narren. Beide Waffen würden ihr nicht bei einem Energieschirm helfen. Eine Station?, überlegte sie, denn für einen Personenschirm war er viel zu groß. Sie packte ihre Habseligkeiten zusammen und eilte den Berghang hinunter. Der Regen erzeugte – zum üblichen Pflanzendickicht – einen weiteren Sichtschutz. Also wollte sie die Chance nutzen und sich an den Schutzschirm heranschleichen. Sie achtete dabei darauf, trotz aller Aufregung und Hast, die Fauna und Flora nicht zu vergessen, und zog vorsichtshalber das Katana vom Rücken. Wenige Minuten später hatte sie eine künstliche Lichtung erreicht, auf der der Schutzschirm regennass vor ihr stand. Sie war nicht so dumm gewesen, den Wald zu verlassen, sondern stand hinter einer verfilzten, triefenden Lianenpflanze versteckt und strengte ihre Augen an.
Die Lichtung war zu kreisrund und die Pflanzen auf dem Boden zu regelmäßig plattgedrückt, als dass sie natürlichen Ursprungs sein konnte. Auch der Rand der Lichtung deckte sich bis auf einige Meter mit der Wand des Energieschirmes. Der Schutzschirm musste also – zumindest für kurze Zeit – größer als jetzt gewesen sein. Vielleicht hatte man damit einen Freiraum zwischen dem Dschungel und dem Objekt – was immer es auch war – schaffen wollen. Leider war die Wasserschicht so dicht, dass sie nicht hindurchblicken konnte. Sie würde das Ende des Regens abwarten müssen. Also zog sie sich wieder ein wenig zurück, erklomm einen Baum und verbarg sich im dichten Blattwerk. Nicht ohne vorher zu prüfen, ob sich darin oder auf dem Baum irgendein Lebewesen befand, das ebenfalls vor dem immer stärker werdenden Regen Schutz suchte.
Gibt es auf Samboll eine Regenzeit wie in den irdischen Tropenregionen? Oder handelt es sich nur um einen normalen Niederschlag? Mit solchen Fragen – und möglichen Antworten darauf – versuchte sie sich die Wartezeit zu verkürzen und holte sich aus ihrem Beutel ein Stück eingewickeltes Fruchtfleisch. Es stammte von einer Pflanze, deren Namen sie nicht kannte, die ihr Dr. Muramasa aber so genau beschrieben hatte, dass sie sie nicht mit einer anderen verwechseln konnte. Die ohnehin saftige Pflanze schmeckte vorzüglich und löschte zusammen mit dem Regen sowohl ihren Hunger als auch ihren Durst. Das Fruchtfleisch hatte etwa die Konsistenz einer festen Honigmelone, schmeckte aber mehr wie Fleischpastete; nun, sie hatte keine Ansprüche. Hauptsache, das Zeug war nicht giftig, erhielt sie am Leben und bei Kräften.
Sie hielt nach ihrer Mahlzeit nur die Hände in den Regen, um den klebrigen Pflanzensaft abzuwaschen, und wechselte das Katana gegen den Stachler. Hier im Baum würde sie sich damit besser wehren können, sollte irgendwelches Viehzeug auftauchen. Der Regen nahm in der folgenden Stunde noch um einiges zu, behielt dann seine Energie bei und strömte in endlosen Stürzen hernieder. Sie war bis auf die Knochen nass und trotz der angenehmen Temperaturen begann sie zu frösteln.
Bérénice Savoy kauerte sich enger zusammen und blickte immer mürrischer vor sich hin. Ihr war klar, dass ihre Stimmung sich aus der Untätigkeit erklärte, die ihr das Wetter aufzwang. Sie war es nicht gewohnt, passiv herumzuhocken, sie war ein aktiver Typ. Allerdings musste sie zugeben, dass ihr die Zwangspause guttat. Trotz der Kühle des Regens spürte sie die körperliche Mattheit. Eine Woche Dschungelmarathon und ständige Kämpfe zehrten auch an ihren Kräften. Sie nickte weg.
Das Knarzen eines Astes ließ Bérénice aus ihrem Schlummer aufschrecken. Reflexartig spannten sich ihre Muskeln und brachten sie in eine einigermaßen brauchbare Abwehrstellung. Der Stachler lag ohnehin entsichert in ihrer Armbeuge. Vorsichtig schob sie einige große Blätter vor sich beiseite, um besser sehen zu können. Das Knarzen verstummte sofort.
Irgendetwas ist da draußen und hat mich entdeckt, dachte sie glasklar und registrierte nebenbei, dass der Regen aufgehört hatte und es schon beinahe wieder dunkel geworden war. Sie konnte fast nichts erkennen.
Auf dem Boden kann ich mich besser wehren, eventuell flüchten. Hier im Baum sind meine Möglichkeiten begrenzt.
Sie war sich nur nicht sicher, ob sie es noch bis nach unten schaffen würde. Sie wollte den Stachler gerade beiseitelegen, als sie eine Idee hatte. Zuerst ließ sie das Katana so nach unten fallen, dass es locker im Boden stecken blieb. Sie wartete eine Reaktion ab, aber sie hörte rein gar nichts. Dann legte sie an und schoss einen Stachel in die Richtung des Geräusches. Mit deutlichem Aufschlag blieb das Projektil in einem Ast stecken. Im gleichen Augenblick ließ sie sich aus der Astgabel fallen und landete direkt neben dem Schwert. Mit dem Aufschwung schnappte sie sich die Klinge und rannte drei Schritte vom Baum weg. Gerade noch rechtzeitig, denn mit einer Flut abgerissener Blätter und kleiner Äste brach ein Tier geräuschvoll durch den Baum, das sie aber noch nicht richtig sehen konnte. Sie nahm nur dunkle Flächen und ein hungriges Zischen wahr. Sie trat noch einen Schritt zurück.
Ein, nein, zwei Flugaffen landeten direkt vor ihr auf dem Boden und stampften zischend geradewegs auf sie zu. Die Lederflügel schlagend, hüpften sie mehr, als dass sie liefen, ihr entgegen. Die Rachen aufgerissen und aus dunkelrot unterlaufenen Augen sie böse anfunkelnd. Beide griffen gleichzeitig an, keines der Tiere war auch nur einen halben Schritt hinter dem anderen. Welches sollte sie zuerst attackieren?
Sie machte einen großen Schritt nach vorne und schwang das Katana im Kreis. Mehr aus Zufall oder Überraschung schnitt sie dabei einem der Tiere in die Oberlippe. Blut spritzte heraus, das Tier brüllte auf und blieb sofort stehen. Bérénice nutzte die Chance und säbelte dem anderen Tier eine Krallenhand vom Flügel. Auch dieses blieb verwirrt stehen. Zu Bérénices Erstaunen blickten sich die beiden Flugaffen kurz an. Sicherlich hatten sie sich einen schnelleren Erfolg erhofft. Dass das zweibeinige, flügellose Wesen vor ihnen – nicht viel größer als sie selbst – sich nicht in eine sinnlose Flucht begab und sein Schicksal hinnahm, überraschte sie offensichtlich.
Plötzlich griffen sie wieder an und flatterten dabei etwas in die Höhe. Und wieder tat ihr Gegner etwas Unerwartetes. Bérénice rannte erneut nach vorn, rollte sich unter das Tier mit der fehlenden Flügelkralle und stieß mit aller Macht nach oben. Sie behielt ihren Schwung bei und schlitzte in ihrer raschen Bewegung dem Tier den Leib vom Brustansatz bis zum Schritt tief ein. Ein Schwall warmen Blutes ergoss sich über sie und der ekelhafte Geruch raubte ihr für einige Sekunden den Atem. Platschend fiel ihr Opfer zu Boden und sie konnte gerade noch ihre Füße wegziehen. Mit einem markerschütternden Schrei stürzte sich der verbliebene Flugaffe auf sie. Über seinen toten Partner hinweghüpfend, drang er auf die am Boden liegende Frau ein. Hastig schob sich Bérénice mit den Füßen rückwärts von ihm weg, das Katana gerade auf den Angreifer gerichtet. Mit einem Ruck stieß sie an einen Baumstamm und blieb heftig atmend liegen. Der Affe wartete diesmal nicht und war eine Sekunde später bei ihr. Er riss sein Maul auf und Geifer lief ihm von den Reißzähnen. Mit einem teuflischen Blitzen in den Augen stieß sein Kopf auf Bérénices Hals zu. In allerletzter Sekunde rollte sie sich zur Seite, kam auf die Füße. Sie umrundete den Baum und schwang das Katana mit aller Kraft. Mit einem hässlichen Schmatzen traf sie den Hals des Flugaffen von der Seite. Ihr Schwert blieb in der armdicken Wirbelsäule stecken. Sie ließ los und hechtete von dem tobenden Flugaffen zurück. Seine beiden Flügelhände waren zu weit entfernt, um die Klinge aus dem Hals zu ziehen, also versuchte er, mit beiden eingeknickten Flügelenden die Waffe abzuschlagen. Es gelang ihm nicht. Die Waffe steckte zu fest in den Wirbelknochen. Als er das erkannte, wurde er noch wütender und rannte mit voller Wucht gegen den Stamm des Baumes. Vielleicht wollte er das waagrecht in seinem Hals steckende Schwert abschlagen. Doch damit erreichte er das Gegenteil. Als seine geballte Kraft das Schwert gegen den Stamm hieb, gab der angeschnittene Halswirbel nach und brach. Mit einem blutig-schaumigen Gurgeln stürzte der Flugaffe einen Schritt vor Bérénice nieder. Seine Extremitäten schlugen in wilden Reflexen um sich, aber noch lebte er und sah der Frau direkt in die erschrockenen Augen.
Dieses Mal zog sich Bérénice aber nicht zurück, obwohl die Schläge der Flügel und Beine die Pflanzendecke des Waldbodens zerfetzten. Die Hiebe ließen aber schon in ihrer Heftigkeit nach. So wie sich das Blut aus der tiefen Schnittwunde ergoss, erlahmten die Bewegungen des Flugaffen. Seine Wirbelsäule war zwar gebrochen, aber er weigerte sich, schnell zu sterben. Nach dem vierten oder fünften Zucken seiner Beine veränderte sich endlich der Ausdruck in seinen Augen. Die Bösartigkeit des Blickes wandelte sich in die Erkenntnis, dass sein Leben zu Ende war. Bérénice starrte zurück und glaubte im letzten Glimmen der Augen ein Verstehen, einen Schimmer von Vernunft zu erblicken, doch sie konnte sich auch täuschen.
Als der Blick des Flugaffen endgültig brach, hatte sie ebenfalls genug und sackte zusammen. Tränen brachen aus ihr hervor und ihre Schultern schüttelten sich im Weinkrampf. All die angestauten Gefühle der Angst, der Hoffnung, der Strapazen und ihr erneutes Glück ließen die Tränen fließen. Ihr Zittern erstarb rasch, die Tränen erst viel später. Sie saß noch auf dem Boden, als die unvermeidlichen Aasmaden erschienen und mit ihrem schrecklichen Werk begannen. Doch dieses Mal verspürte sie keinen Ekel mehr, sondern nahm es als Bestätigung ihres Sieges. Sie würde nicht so enden. Nein, nicht auf diese Art.
Ohne Emotionen wischte sie das Blut vom Katana und schob es auf den Rücken. Mit einiger Anstrengung kletterte sie auf den Baum und wollte sich ihre restlichen Sachen holen, die sie an ihrem Schlafplatz gelassen hatte. Schon aus zwei Metern Entfernung sah sie im Sack einen roten Schimmer. Sie hatte nichts darin, was leuchtete, außer vielleicht …
Der Quader! Sie schob sich rasch nach oben und fingerte vorsichtig den Gegenstand heraus. Tatsächlich: Ein Teil der Markierungen auf einer Seite leuchtete schwach rot. Die Dunkelheit war deutlich vorangeschritten und so erschien ihr der schwache Schimmer heller, als er wahrscheinlich war. Ein bisschen ratlos hielt sie das Ding in der Hand und betrachtete es von allen Seiten. Bildete sie es sich ein oder lag es warm in ihrer Hand?
Wenn das ein Peilgerät ist, bin ich geliefert, dachte sie und suchte nach einem Knopf zum Abschalten, der aber vorher und auch jetzt nicht sichtbar war. Sie wechselte ihre Sitzposition und kam dabei mit dem Quader in Richtung des Schutzschirms. Bérénice glaubte eine kleine Verstärkung des roten Leuchtens zu erkennen, war sich aber nicht sicher. Sie suchte die Energiekuppel und glaubte ihren Augen nicht, als sie dorthin sah.
Der Regen hatte endlich aufgehört und die Kuppel lag schwach flimmernd vor ihr. Der Anblick, der sie magisch anzog, war nicht die vermutete Station … sondern eine Personenfähre! Sie kannte die Dinger aus dem Gefangenenlager. Wärter hatten damit Versorgungs- und Wachflüge unternommen. Das Beste aber an dieser Fähre war ein schwacher roter Schein auf der ihr zugewandten Seite, dessen Farbe absolut identisch war mit der ihres Quaders. Ihr Herz machte einen Salto und in aller Hast schnappte sie sich ihre Sachen. Innerhalb einer Minute war sie vom Baum herunter, ignorierte die fressenden Maden und lief auf die Fähre zu.
Das Ding gehörte tatsächlich den drei Jägern!, triumphierte Bérénice und grinste in die Dunkelheit. Nur der schwach glimmende Schutzschirm und die beiden rot leuchtenden Stellen erhellten die allernächste Umgebung. Warum steht die Fähre eine Woche Fußmarsch von der Stelle entfernt, an der die Jäger auf mich stießen? Wie lange waren die Kerle unterwegs gewesen? Könnte es sein, dass diese Fähre einer anderen Sambolligruppe gehört und der Quader ein universelles Codegerät ist?
Denn um nichts anderes musste es sich handeln. Für eine Sekunde zögerte Bérénice und überlegte, ob noch jemand an Bord sein könnte. Dann trat sie entschlossen vor und hielt den Quader mit der leuchtenden Seite genau dem Pendant unter dem Schirm entgegen. Fast augenblicklich stellten die beiden Geräte Kontakt zueinander her. Ohne weitere Hindernisse erlosch der Schutzschirm und eine Mannluke öffnete sich direkt neben dem Signalfeld. Gleichzeitig mit dem Öffnen der Tür klappte eine kleine Treppe mit zwei Stufen herab und trüb-gelbes Licht erhellte den Raum hinter der Tür.
Bérénice atmete tief durch, warf einen letzten Blick in die Dunkelheit des Dschungels und betrat die Fähre. Es erschien ihr unsinnig, eine Waffe zu ziehen. Wenn es die Fähre der Jäger war, war sie wahrscheinlich unbemannt. Ein vierter Jäger würde nicht eine Woche lang seinen Kameraden alleine das Vergnügen gönnen und sich langweilen. Wenn es nicht die Fähre der Jäger war, wäre sie, Bérénice, wahrscheinlich von der Besatzung längst entdeckt worden. Schließlich hatte der Kampf mit den Flugaffen ziemlichen Radau verursacht.
Also kann ich es wagen …
Sie war zwei Schritte in den Raum hinter der Luke getreten, als diese sich leise schloss. Kann mir nur recht sein, dachte sie und steckte den wieder inaktiven Quader in die letzte intakte Beintasche ihres Anzuges. Sie glich mit dem zerrissenen Ding eher einer antiken Amazone, denn einem weiblichen Mitglied des 45. Spacetrooper-Bataillons. Ein recht enger Flur lief links an der leicht gewölbten Wand der Fähre nach vorne, zwei große und eine kleine Tür zweigten davon ab. Sie öffnete mit den einfachen Hebeln vorsichtig die Türen und warf kurze Blicke in die Räume dahinter. Ein Schlafraum mit sechs Liegen hinter der kleinen Tür und einer ganzen Reihe von Wandschränken. Die beiden größeren Türen führten zu einem Frachtraum in der Mitte in unmittelbarer Nähe der Luke und einem vollgestopften Raum mit dem Antriebsaggregat. Ein noch schmalerer Gang führte komplett um die Maschine herum. Dann mussten die beiden röhrenförmigen Dinger unterhalb des lang gezogenen Fährenrumpfs, die sie anfangs für Schwimmbehälter bei Wasserungen gehalten hatte, die Treibstofftanks sein. Vielleicht waren sie ja auch beides. Auch irdische Vehikel hatten ein verblüffend ähnliches Aussehen. Bérénice hoffte, dass dies auch auf die rudimentären Funktionen der Fähre zutraf.
Sie folgte dem Gang und landete erwartungsgemäß in der Pilotenkanzel, die nur zwei Sitzplätze bot, dicht umgeben von Monitoren, einer erfreulich kleinen Anzahl von Schaltern und einem etwa zwei Quadratmeter großen Frontfenster. Durch die sanft geschwungene Scheibe war nur das Schwarz der Dschungelnacht und das leicht flimmernde Glimmen des Schutzschirms zu sehen. Er musste sich ebenfalls mit dem Schließen der Luke wieder aufgebaut haben.
Das alles ist recht einfach gestrickt, freute sich Bérénice. Idiotensicher sozusagen.
»Na dann …« Sie machte kehrt und legte sich in der Mannschaftskabine in eine der oberen Liegen und war nach wenigen Augenblicken eingeschlafen. Ihr letzter klarer Gedanke war, dass sie sich diese Nacht verdient hatte und alles dafür sprach, dass sie sie auch ungestört würde verbringen können. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn jetzt noch ein Suchkommando des Gefangenenlagers sie hier aufstöberte. Es war eher anzunehmen, dass man sie längst für tot hielt.