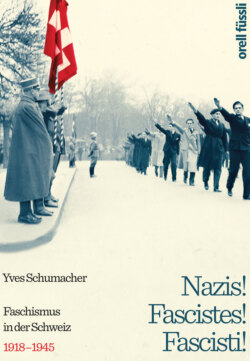Читать книгу Nazis! Fascistes! Fascisti! - Yves Schumacher - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Korporatismus mit welscher Färbung
ОглавлениеDie Ursache der ideologischen Kontamination von Gruppierungen in der lateinischen Schweiz mit italo-faschistischem Gedankengut ist in der sozialpolitischen Misere der Schweiz nach dem Ersten Weltkrieg zu suchen. Einerseits kamen in der Westschweiz reaktionäre Strömungen auf, die in der Erneuerungsdiskussion der Dreissigerjahre gipfelten; anderseits formierten sich aufseiten der Wirtschaft neue Formen des Lobbyismus, die zur Entstehung von wirtschaftspolitischen Pressure-Groups führten.[37] Die Westschweizer Erneuerungsbewegungen hatten eine gemeinsame politische Stossrichtung, die sich durch verschiedene Akzentsetzungen unterschied. Beeinflusst waren sie nicht nur von Mussolini, sondern auch von den Ideen des französischen ultrarechten Publizisten Charles Maurras, der seinen virulenten Antisemitismus unter der pseudointellektuellen Etikette «antisémitisme de raison» (vernunftsbezogener Antisemitismus) propagierte, auch wenn er in Tat und Wahrheit nichts anderes war als ein Amalgam von antijudaistischen Stereotypen, Verschwörungstheorien und politischem Kalkül. Die Judenfeindlichkeit der Erneuerungsbewegungen war mit dem Ruf nach autoritärer Führung und einer antiparlamentarischen Haltung verbunden. Von faschistoiden Tendenzen – um eine neudeutsche Wortschöpfung zu gebrauchen – können die Erneuerungsbewegungen der Zwischenkriegszeit mitnichten freigesprochen werden. Diese alle über einen Leist zu schlagen und pauschal als faschistisch zu bezeichnen, wäre aber insofern nicht statthaft, als sich verschiedene Erneuerungsbewegungen vom italienischen Faschismus und vom deutschen Nationalsozialismus entschieden distanziert hatten.
Charakteristisch für die Einstellung der Westschweizer Christlichsozialen waren die ständestaatlichen Vorstellungen einer «neuen Schweiz», die namentlich vom Freiburger Weltgeistlichen Abbé André Savoy geprägt wurden. Dieser richtete sich vor allem nach den Weisungen von Papst Pius XI., die in der Enzyklika Quadragesimo anno 1934 festgehalten waren und einen dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus aufzeigten.[38] Savoys korporatistische Phantasien lehnten sich vor allem an die berufsständischen Strukturen der Schweiz vor 1798 an und drehten sich um eine soziale Gerechtigkeit mit Einschränkung des freien Wettbewerbs durch die Korporationen selbst und nicht etwa durch den Staat.
Savoys Ideen kamen vorerst im Neuenburger Jura an. Die katholischen Freiberger Uhrmacher gründeten 1922 in Les Bois eine eigene Korporation, angeblich die erste Organisation Europas dieser Art im 20. Jahrhundert.[39] Ansonsten griff das Gedankengut des politisch aktiven Priesters in den Kantonen Freiburg und Genf besser als in der restlichen Romandie. Freiburg war Sitz des 1928 gegründeten Westschweizer Korporationsverbandes, der seine Mitglieder auch in den Kantonen Bern, Neuenburg, Wallis und Waadt rekrutierte. Angeschlossen war ein halbes Dutzend Berufsorganisationen. Als wichtigste davon galt die «Corporation de l’industrie du bâtiment (CIB)», die 1929 einen Mitgliederbestand von 700 Arbeitnehmern und 53 Arbeitgebern hatte. An der Sprachgrenze propagierte Jakob Lorenz, Professor für Soziologie und Wirtschaftskunde an der Universität Freiburg, einen Korporatismus eigener Ausprägung. Dieser ehemalige Mitarbeiter des Gewerkschaftsführers Hermann Greulich gründete 1933 die Zeitschrift Das Aufgebot, die einen von Überfremdungstheorien und Antisemitismus geprägten Korporatismus verfocht, totalitäre Bewegungen jedoch ablehnte.[40]
Im Mai 1927 lancierte der Freiburger Nationalrat Ernest Perrier die Publikation Cahiers de la corporation. Er trat für eine «Schweizer Methode» zur Einführung des Korporatismus ein, die in Opposition zum faschistischen Korporatismus Italiens stehen sollte. Sein Standpunkt: «Der Staat soll den Korporationen ihr Eigenleben lassen und sich darauf beschränken, nur in aussergewöhnlichen Fällen schlichtend einzugreifen».[41] Anfangs der Dreissigerjahre schossen in der Westschweiz unter der Bezeichnung «Les amis de la Corporation» entsprechende Fördervereine und -verbände wie Pilze aus dem Boden.
Der katholische Ursprung der korporatistischen Idee konnte die Calvinisten nicht davon abhalten, ebenfalls entsprechende Organisationen aufzubauen. So entstand gegen Ende der 1920er bis Ende des Zweiten Weltkriegs in Genf ein komplexes Netz von Berufsverbänden und Dachorganisationen, die durch wiederholte Namensänderungen ein für Aussenstehende schwer überschaubares Gefüge bildeten.
Zwischen 1926 und 1930 wurden in Genf fünf Korporationen gegründet. 1932 konstituierte sich die Dachorganisation «Fédération genevoise des corporations» mit dem Ziel, die korporatistische Doktrin geschlossen und nachhaltig umzusetzen. 1938 zählten die entsprechenden Berufsorganisationen des Kantons bereits 13 250 Mitglieder, 1 150 Unternehmer eingeschlossen. Die «Fédération genevoise des corporations» löste sich 1946 auf; ihr Arbeitgeberflügel wirkt indessen bis heute weiter und nennt sich «Fédération des entreprises romandes Genève». Parallel dazu entwickelte sich aus dem 1928 gegründeten Arbeitgeberverband die «Groupe patronal interprofessionel», die sich später mit dem christlich orientierten Gewerkschaftsverband «Groupe des syndicats chrétiens de Genève» unter der Neubezeichnung «Fédération des Syndicats Patronaux (FSP)» zusammenschloss. Diese verwaltete verschiedene soziale Institutionen und machte sich vor allem in der Unterstützung der einzelnen Berufsverbände beim Aushandeln von Rahmenverträgen mit den Gewerkschaften stark.[42]
Im Waadtland ging der Korporatismus eigene Wege, die vom jungen Rechtsanwalt Marcel Regamey erschlossen wurden. Sein Modell sah vier kantonale Kammern vor: eine für die Landwirtschaft und den Weinbau, die zweite für Handwerk und Handel, die dritte für die Industrie und eine weitere für Freiberufliche. «Die vier vereinigten Kammern bilden die Staaten der Waadt», hielt Regamey in seiner Postille Ordre et Tradition fest.[43] In der Folge des Arbeitsfriedens vereinten sich die Waadtländer Arbeitgeberorganisationen im Oktober 1940 zu den «Groupements patronaux de la Fédération vaudoise des corporations».
Eine wichtige korporatistische Rolle spielte auf nationaler Ebene der schon 1880 formell als Gewerbeverein ins Leben gerufene «Schweizerische Gewerbeverband». Nach Ende des Ersten Weltkriegs brachte sich diese Organisation bis 1942 regelmässig auf Bundesebene ein. Jakob Scheidegger, ein von 1897 bis 1915 als Präsident des Gewerbevereins tätiger Berner Schuhfabrikant, zeigte sich im Dialog mit den Arbeiterorganisationen noch kompromissbereit und förderte ein Kranken- und Unfallversicherungsgesetz. Sein Nachfolger Hans Tschumi war in sozialpolitischen Fragen hingegen ziemlich unnachgiebig. Ein definitiver Kurswechsel erfolgte 1943 unter dem Präsidium von Paul Gysler. Der Verband zeigte sich von seiner strikt freisinnigen Seite und verzichtete fortan auf staatliche Beihilfe.
Die korporatistischen Bemühungen der Verbände, auch auf Bundesebene eingreifen zu können, blieben nicht ohne Früchte. 1933 brachte der freisinnige Bundesrat Edmund Schulthess, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, in einem Exposé seine Ansichten zur Rolle der Verbände zur Sprache: «Vielleicht wäre es auch geboten, die Berufsverbände neben den Kantonen als Mitwirkende in der Bundesverfassung zu nennen. Immer zahlreicher werden die Postulate, welche eine korporative Eingliederung dieser Verbände in das System der staatlichen Verwaltung fordern. Schon anlässlich der Diskussion des Art. 34ter spielte die Frage der Bildung von Berufsgenossenschaften und die Übertragung von öffentlich-rechtlichen Funktionen an diese eine nicht unerhebliche Rolle. Seit dem Krieg und speziell seit Einführung des faschistischen Regimes in Italien wurde der Gedanke erneut lebhaft propagiert. «[…] Besonders in Zeiten der Krisis ist ja die in der Verfassung nicht vorgesehene Bildung von Zwangssyndikaten unumgänglich und solche Zwangsorganisationen können mit unter das Corporationen- oder Berufsverbandsystem gerechnet werden.»[44]
In den 1930er Jahren überbordeten in der Westschweiz entsprechende Berufsverbände unter der Bezeichnung «Les amis de la corporation», die den Untergang der Korporationen jedoch nicht aufzuhalten vermochten. Ein letzter Versuch, eine korporatistische Ordnung in der Schweiz zu etablieren, unternahm 1941 der Berner Architekt Friedrich Stalder. Mit Unterstützung von Oscar de Chastonay, einem konservativen Walliser Grossrat, Gonzague de Reynold und der «Ligue vaudoise» lancierte er eine Initiative, um die Macht des Bundesrates zu stärken, die Kantone durch die Einrichtung einer «Tagsatzung» vertreten zu lassen und den Nationalrat durch eine Handwerkskammer zu ersetzen, die auf nationaler Ebene alle Berufsverbände paritätisch vertreten sollte. Stalder brachte nur einen Fünftel der für die Initiative erforderlichen Unterschriften zusammen. Das klägliche Scheitern dieser Initiative liess die letzten Hoffnungen der Korporatisten schwinden.
Mit der heute als Public Affairs bezeichneten Politikkontaktarbeit übten immer mehr korporatistische Organisationen einen strategischen und kommunikativen Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse der Schweiz aus. Initianten entsprechender Massnahmen waren zumeist auch führende Repräsentanten der nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Erneuerungsbewegungen, die im Zusammenhang mit der Ablehnung der Volksinitiative zur Totalrevision der Bundesverfassung im September 1935 einen gesellschaftlich starken Auftrieb hatten, weil sie ihre vermeintlichen politischen und wirtschaftlichen Problemlösungen populistisch zu kommunizierten wussten. Als publikumswirksame Massnahme erwiesen sich auch die von zahlreichen Akteuren organisierten Vortragsreihen und Rhetorikkurse in öffentlichen Lokalen. In der vergleichsweise noch schwach mediatisierten Gesellschaft wurden diese Veranstaltungen rege besucht und übten einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf soziale Prozesse aus.
Als manipulative und wirkungsvolle Multiplikatorin wirkte nach 1917 die vom Publizisten Samuel Haas initiierte national-bürgerliche «Schweizer Mittelpresse (SMP)». Sie wurde als Konkurrenz der seit 1885 bestehenden «Schweizerischen Depeschenagentur (SDA)» gegründet. In den Dreissigerjahren liebäugelte diese Presseagentur sowohl in personeller wie in inhaltlicher Hinsicht mit faschistischen bzw. nationalsozialistischen Strömungen. Um 1933, zur Zeit des Frontenfrühlings, stand sie dem «Bund für Volk und Heimat» besonders nahe. Nach 1938 verbreitete die SMP rund 250 antisowjetische Medienberichte aus der Feder des Exilrussen Iwan Iljin, den sie nach Lust und Laune mit den Pseudonymen Peter Just, P.J., Hans Grau, Walter Tannen oder Anonymus zeichnete. Präsident der SMP war der Glarner Textilindustrielle Caspar Jenny. Am 2. August 1940 empfahl dieser dem Bundesrat, für Pressefragen Samuel Haas beizuziehen, obwohl er wisse, dass dieser «bei den mehr oder weniger volksfrontkranken Journalisten und Politikern nicht beliebt» sei. Der Bundesrat ging auf dieses Begehren nicht ein. Der bürgerliche Nationalrat und spätere Bundesrat Markus Feldmann hatte am 25. Juni 1940 in seinem Tagebuch vermerkt, dass die SMP einen Artikel von «absolut faschistischer Tendenz» verfasst habe.[45]
Die SMP als Vorgängerin der «Schweizerischen Politischen Korrespondenz (SPK)» belieferte mit ihren Pressemeldungen bis 1947 praktisch alle kleineren Medien, die sich keine eigenen Korrespondenten leisten konnten.
Am 28. Mai 1933 wurde im Hotel «Löwen» in Langenthal der ultrarechte, christliche «Bund für Volk und Heimat (BVH)» konstituiert, der sich in erster Linie dem Kampf gegen das Freimaurertum verschrieben hatte. Weitere Feindbilder des Vereins waren der Bolschewismus, die Gewerkschaften und der Parlamentarismus. Er verstand sich als patriotischer Zusammenschluss Gleichgesinnter, die dem Föderalismus und dem Manchester-Liberalismus anhingen. Dennoch war die Organisation nicht frei von politischen Konflikten. Sehr schnell öffnete sich ein Spannungsfeld zwischen der wirtschaftspolitisch zentrierten Zürcher Gruppe und der den frontistischen Erneuerungsbewegungen zugeneigten Berner Gruppe. An der Gründungsversammlung sprach Samuel Haas gegen die Erteilung des Schweizer Bürgerrechts an «wesens- und artfremde Elemente» und gegen das «demagogische, staatsfeindliche Auftreten der Verteidiger im Prozess gegen den Genfer Sozialisten Léon Nicole.» An der Gründungsversammlung wurde die provisorische, achtköpfige Bundesobmannschaft gewählt. Obwohl der Genfer Oberstdivisionär Guillaume Favre und der Waadtländer Nationalrat Pierre Rochat zu diesem Führungsgremium gehörten, das von einflussreichen Persönlichkeiten wie Louis E. C. Dapples, Verwaltungsratspräsident der Nestlé & Anglo Swiss Condensed Milk Co., und vom Schokoladenfabrikanten Alexandre Cailler finanziell unterstützt wurde, vermochte der BVH im Welschland nie richtig Fuss zu fassen.[46]
Der deutsche Agent und Publizist Dr. Wilhelm Grosse äusserte sich am 1. Oktober 1934 in einem streng geheimen Bericht an das Auswärtige Amt in Berlin zum «gegenwärtigen Stand der schweizerischen Erneuerungsbewegungen unter besonderer Berücksichtigung der verschiedenen ‹Fronten› und ‹Bünde›». Zum BVH meinte er: «[…] darf dem ‹Bund für Volk und Heimat› (B.V.H.), der von den Gegnern nicht ganz zu Unrecht ‹Bund vornehmer Herren› getauft wurde, die wichtigste und einflussreichste Rolle zugesprochen werden. Obwohl er es vermeidet, öffentlich aufzutreten, übt er hinter den Kulissen den allergrössten Einfluss auf das politische und wirtschaftliche Leben der Schweiz aus, was sich unschwer aus der Herkunft seiner Mitglieder erklärt. Es sind die massgebenden und führenden Persönlichkeiten aus der Grossindustrie, der Hochfinanz und den Grossbanken und nicht zuletzt eine Anzahl hoher Offiziere; die Masse der Bevölkerung steht nicht hinter ihnen.» Das Gesamturteil von Grosse über die Vielzahl der Schweizer Erneuerungsbewegungen war vernichtend: «Gerade in der letzten Zeit bieten sich einzelne Angehörige dieser Gruppen an, für Deutschland und den deutschen Nationalsozialismus in der Schweiz zu wirken, wofür sie selbstverständlich in allererster Linie einmal Geld haben wollen. Es sind in den letzten vier Monaten über ein Dutzend derartiger Angebote nachgeprüft worden, mit dem Ergebnis, dass sich vierfünftel der betreffenden Persönlichkeiten als vollkommen unfähige Schwätzer, zum Teil sogar übelste Gauner entpuppten, die den Namen des Nationalsozialismus nur für ihre persönlichen Geschäfte benutzen wollten.»[47]
In den durchweg rechtsbürgerlichen Erneuerungsbewegungen spielten sich auch immer wieder faschistisch gesinnte Akteure auf, die ihre Organisationen in Misskredit brachten, zumal ihnen ein autoritärer Korporatismus nach italienischem Muster vorschwebte und sie auch vor einer Zusammenarbeit mit den nationalsozialistischen Frontisten nicht zurückschreckten. Anderseits weist Christian Werner in seiner Lizenziatsarbeit über Erneuerungsbewegungen und bürgerliche Interessensgruppen[48] darauf hin, dass die mit fast religiösem Eifer beschworene föderalistische Ordnung ein vollständiges Abdriften des rechten politischen Spektrums der Bewegungen in den Faschismus verhinderte, weil der gepredigte schweizerische Föderalismus mit dem System der zentralistisch geführten Regime in Italien und Deutschland nicht vereinbar war. Er hebt aber auch hervor, dass in den Pressure-Groups Elemente mit widersprüchlichen Einstellungen vertreten waren: Manchesterliberalismus versus Antimaterialismus, Antietatismus versus autoritäre Staatsführung, Anpassung an das «neue Europa» versus Entschlossenheit zum militärischen Widerstand. Dennoch blieben im rechten Bürgerblock erzreaktionäre Vorstellungen en vogue. Kategorisch abgelehnt wurden von zahlreichen Akteuren der Erneuerungsbewegungen die moderne Staatsform, der Parlamentarismus und die Errungenschaften der Französischen Revolution wie die Abschaffung der Ständegesellschaft, der Geburtsprivilegien und der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte.
Die einflussreichste Pressure-Group war die in den Krisenjahren in Zürich gegründete «Aktionsgemeinschaft Nationaler Wiederaufbau (ANW) / Redressement national», die sich als Kampforganisation gegen Verstaatlichung und Zentralisierung verstand und für den Abbau der Demokratie eintrat. Ihre wirtschaftspolitische Rolle wurde ihr in den 1960er Jahren von der «Gesellschaft zur Förderung der schweizerischen Wirtschaft» streitig gemacht, die später in die «economiesuisse» überging. Seit 2001 wird die ehemalige ANW unter dem Namen «Liberale Aktion» weitergeführt und nimmt für sich in Anspruch, die Interessen des Mittelstands zu vertreten.
Unter den Gründungsmitgliedern der ANW gab es drei prominente Romands: den Freiburger Bundesrat Jean-Marie Musy, den Waadtländer Grossrat, Nationalrat und Gemeinderat von Lausanne Pierre Rochat[49] sowie den Genfer Théodore Aubert. Der Letztere war auch beim Aufbau der illegalen, aber von den Behörden geduldeten Genfer Bürgerwehrbewegung führend, die sich 1918 als Kampfverband gegen den Landesstreik formiert hatte.[50] 1923 nahm Aubert als Abgeordneter der von ihm gegründeten rechtsbürgerlichen «Union de défense économique» einen Sitz im Genfer Kantonsparlament ein, und 1935 schloss er sich Georges Oltramares faschistischen «Union nationale» an. Mit seiner im gleichen Jahr veröffentlichten Schrift Nationale Erneuerung schuf der Genfer Politiker gewissermassen das geistige Fundament der ANW. Zur Bekämpfung des Staatssozialismus forderte er eine schlagkräftige Aktion, «um damit dem Staat seine sittliche Autorität […] wiederzugeben und unserem Volk die gesunde vaterländische Gesinnung zu erhalten, die es augenblicklich zu verlieren scheint, weil es im Staat nur noch einen Mechanismus zur Verteilung von Subventionen sieht».[51] «Schliesslich», so Aubert, «muss unser Volk zu den Grundsätzen sittlicher Ordnung zurückkehren, die in der Vergangenheit seine Kraft ausmachten, die leider heute durch Verstaatlichung und den Sozialismus untergraben werden, durch die es aber allein mit der Prosperität seine Lebenskraft und seinen sittlichen Wert wieder gewinnen wird».[52] Aubert wirkte bis 1940 als erster Westschweizer Sekretär des rechtsbürgerlichen «Redressement National», der 1936 als Koordinationsstelle für Abstimmungskämpfe in Zürich gegründet wurde. Sein Nachfolger war der Genfer Jurist Raymond Deonna-Vernet, der 1957 Vizepräsident wurde. Im Mitgliederverzeichnis[53] figuriert auch Christoph Blocher, der 1980 ebenfalls zum Vizepräsidenten der Aktionsgemeinschaft erkoren wurde.
Keiner Erneuerungsbewegung gelang es, ihre korporatistischen Ideen auf überregionaler Ebene ganzheitlich durchzusetzen. Anliegen und Forderungen der Berufsorganisationen zeigten ansatzweise dennoch eine breite Akzeptanz, die sich in der öffentlichen Meinungsbildung zu nationalen Reformen und Errungenschaften zielführend niederschlug. Zum einen gehört das Friedensabkommen dazu, das die Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften der Maschinen- und Metallindustrie am 19. Juli 1937 unterzeichnet hatten und zu Gesamtarbeitsverträgen (GAV) in vielen Wirtschaftsbereichen führte. Der darin festgehaltene Verzicht auf Kampfmassnahmen wie Streiks oder Aussperrungen sowie die Vereinbarung, Interessenskonflikte fortan auf dem Verhandlungsweg zu lösen, wäre ohne korporatistische Vorarbeit möglicherweise nie zustande gekommen. Zum anderen hat die Gründung der obligatorischen Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), deren Gesetz am 6. Juli 1947 vom Stimmvolk angenommen wurde, ebenfalls korporatistische Wurzeln. Nicht zuletzt kann auch die heutige Konkordanzdemokratie als Ausfluss der Auseinandersetzung mit den Erneuerungsbewegungen gesehen werden. Dazu gehören die dank der lateinischen Schweiz vom Souverän am 6. Juli 1947 unter der Bezeichnung «Revision der Wirtschaftsartikel» angenommenen Verfassungsbestimmungen des Bundes, die das seit dem Ersten Weltkrieg geltende Notrecht mit seinen die Handels- und Gewerbefreiheit einschränkenden Bestimmungen ausser Kraft setzten, sich gleichzeitig aber interventionistische Massnahmen zur wirtschaftlichen Landesversorgung und zur Agrarpolitik vorbehielten. Ein eindeutig korporatistisches Element, das in der «Revision der Wirtschaftsartikel» übernommen wurde, war das Mitspracherecht von Berufsverbänden bei vorparlamentarischen Entscheidungsprozessen und bei Vollzugsaufgaben des Bundes, die die allgemeinverbindliche Erklärung von Gesamtarbeitsverträgen betrafen.
In gewissen liberalen Kreisen herrschte die Ansicht vor, dass der wirtschaftliche Aufschwung der Nachkriegszeit auch dem Korporationismus zu verdanken sei, der den Kapitalismus in geordnete Bahnen zu lenken vermochte.
Einen deutlichen Nachhall der rechtsbürgerlichen Bewegungen der Zwischenkriegszeit bildete die «Aktion für freie Meinungsäusserung», die den Kampf gegen die aus ihrer Sicht linke Unterwanderung der Medien, den Wohlfahrtsstaat und den Defätismus der Pazifisten aufnahm. Initiant dieser Aktion war der radikal wirtschaftsliberal orientierte Nationalrat Robert Eibel, Vorstands- und Ehrenmitglied des «Redressement National», Mitglied des «Bundes der Subventionslosen» und Mitbegründer des «Gotthard-Bundes». Als Propagandamittel dienten ihm die in einer Auflage von rund achtzehntausend Exemplaren verbreitete Zeitschrift Trumpf Buur sowie ein unter dem gleichen Titel geführter Leitartikeldienst, der von 1947 bis 1991 regelmässig Werbeanzeigen in den bürgerlichen Zeitungen schaltete.