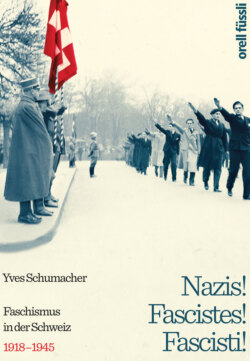Читать книгу Nazis! Fascistes! Fascisti! - Yves Schumacher - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Bundesrat laviert
ОглавлениеWährend der junge Neuenburger im bitterkalten Winter 1940 in der Todeszelle sass, erliess Hitler am 18. Dezember die «Weisung Nr. 21» an das Oberkommando der Wehrmacht (OKW), den Krieg gegen die Sowjetunion unter dem Decknamen «Fall Barbarossa» vorzubereiten. Polen war im Vorjahr gefallen; Frankreich und Grossbritannien hatten dem Dritten Reich den Krieg erklärt. Der darauf folgende, nahezu ereignislose Sitzkrieg («la drôle de guerre») zwischen Deutschland und Frankreich währte neun Monate lang. Am 10. Mai 1940 erfolgte der Startschuss der Wehrmacht zum Westfeldzug («Fall Gelb» genannt). Vorerst wurden die neutralen Benelux-Staaten überrollt und besetzt; alsdann begann die Schlacht um Frankreich («Fall Rot» genannt), die am 14. Juni mit der Besetzung von Paris für die Deutschen praktisch entschieden war. Der acht Tage später zwischen dem Dritten Reich und Frankreich geschlossene Waffenstillstand von Compiègne kam de facto einer Kapitulation der Grande Nation gleich. Nur die naivsten Schweizer glaubten, damit sei die Gefahr eines Angriffs auf ihr Land gebannt. Zwei Tage nach Inkrafttreten des Waffenstillstands war in Italien der Teufel los. Am 10. Juni 1940, Punkt 18.00 Uhr, zeigte sich in Rom Mussolini auf dem Balkon des Palazzo Venezia in der schwarzen Uniform des Ersten Ehrenkorporals der Miliz (Primo Caporale d’Onore della Milizia). Auf der Piazza wogte eine riesige Menschenmenge und jubelte ihm zu. Der Duce plusterte sich kurz auf und donnerte los: «Kämpfer zu Lande, zur See, in der Luft! Schwarzhemden der Revolution und der Legionen! Männer und Frauen Italiens, des Imperiums und des Königreichs Albanien. Hört zu! Eine vom Schicksal bestimmte Stunde schlägt im Himmel unseres Vaterlandes. Die Stunde der unwiderruflichen Entscheidungen. Die Kriegserklärung wurde den Botschaftern ausgehändigt.»[57] Diese Geschehnisse lösten im Bundeshaus vorerst eine Schockstarre aus, und der Bundesrat hüllte sich in Schweigen. Endlich, am 25. Juni, meldete sich die Regierung zu Wort. Doch statt der Öffentlichkeit vertrauensbildende Informationen zur Aussenpolitik zu geben, brachte der freisinnige Waadtländer Bundespräsident Marcel Pilet-Golaz die Nation mit einer höchst anrüchigen Ansprache in Aufruhr. Die Vorbereitungen dieses an die Schweizer Bevölkerung zu richtenden Appells traf er allerdings nicht im Alleingang. Am Vorabend hatte er den Redeentwurf mit seinen Ratskollegen Philipp Etter und Rudolf Minger in seiner Wohnung lange erörtert und die Schlussversion erstellt.[58] Etter, der später erklärte, man habe in puncto Inhalt und Argumentation völlige Einigkeit erzielt, redigierte sie und besorgte eine schwülstig geratene deutsche Übersetzung. Am nächsten Tag verlas er sie über den Landessender Radio Beromünster:[59]
«Frankreich hat soeben den Waffenstillstand mit Deutschland und Italien abgeschlossen. Welches auch die Trauer sein mag, die jeden Christ angesichts der angehäuften Ruinen und Menschenverluste erfüllen mag, so bedeutet es doch für uns Schweizer eine grosse Erleichterung zu wissen, dass unsere drei grossen Nachbarn nun den Weg des Friedens beschritten haben […] Bevor Europa zum Aufstieg gelangen kann, muss es ein neues Gleichgewicht finden, welches zweifellos sehr verschieden vom bisherigen und auf anderen Grundlagen aufgebaut sein wird als auf jenen, die der Völkerbund trotz seiner vergeblichen Bemühungen nicht zu erreichen vermochte […] Dies kann nicht ohne schwere Opfer geschehen […] Der Blick muss sich nun entschlossen nach vorwärts wenden, um mit allen unseren bescheidenen […] Kräften mitzuwirken an der im Umbruch begriffenen Welt. Der Zeitpunkt der inneren Wiedergeburt ist gekommen. Jeder von uns muss den alten Menschen ablegen […] Schliesst Euch zusammen hinter dem Bundesrat!»[60]
Die magistrale Rede war nebulös und mehrdeutig. Statt Orientierung und Zusammenhalt zu schaffen, bewirkte sie genau das Gegenteil – sie verunsicherte und polarisierte die Öffentlichkeit. In der Deutschschweiz löste sie umso grössere Wellen aus, als Etters pathetischer Vortragsstil in keiner Weise goutiert wurde. Pilet-Golaz diskreditierte sich zusätzlich, als er am 10. September 1940 den Schweizer Nazi-Schriftsteller Jakob Schaffner in Begleitung von Max Leo Keller, Führer der «Nationalen Bewegung der Schweiz (NBS)», und dessen Parteigenossen Ernst Hofmann zu einer eineinhalbstündigen Audienz empfing. Das Trio witterte Mogenluft und erhoffte sich einen zweiten Frontenfrühling. Nicht genug: Eine Woche später, an einem Sonntag, hiess Pilet-Golaz den Frontisten Max Leo Keller, der kurz vor einer Reise nach Deutschland stand, in aller Diskretion bei sich zuhause willkommen. Dieser hatte dem Bundespräsidenten für seine Intervention, patriotische Beweggründe vorgaukelnd, in Aussicht gestellt, sich bei der deutschen Führungsspitze für die Anliegen der Schweiz zu verwenden. Im «Reich» wurde Keller vom Führer-Stellvertreter Rudolf Hess tatsächlich empfangen und erwirkte, dass die NBS von Deutschland als «repräsentative» nationalsozialistische Organisation der Schweiz anerkannt wurde.[61]
Beschämend für den damaligen Bundesrat ist auch die widersprüchliche Haltung von Bundesrat Pilet-Golaz in Sachen Asylpolitik gegenüber den von den Nazis verfolgten Juden. Dies kommt einerseits in seinem Brief vom 16. September 1942 an Eduard von Steiger, Chef des Justiz- und Polizeidepartements, zum Ausdruck. Dieser hatte schon einen Monat vorher eine totale Grenzsperre für jüdische Flüchtlinge erlassen, die etwas später vom Gesamtbundesrat bestätigt wurde. Pilet-Golaz bekundet in seinem ominösen Schreiben, dass zwar keine ausländische Regierung auf ihn Druck ausgeübt habe, den Flüchtlingen die Tore zur Schweiz zu verschliessen. Das Gegenteil sei der Fall gewesen: Bestimmte Diplomaten hätten gewünscht, den Flüchtlingen die Grenzen zu öffnen. Auf innenpolitischer Ebene, meinte Pilet, würde jedoch das Risiko bestehen, dass der Zustrom von jüdischen Flüchtlingen den latenten Antisemitismus wecken könnte.[62] Anderseits traf Pilet Massnahmen, die ihm nicht hoch genug angerechnet werden können. So heckte er den Plan aus, jüdische Kinder aus Ungarn in die Schweiz zu holen, um sie vor dem sicheren Tod zu retten. Sein Vorhaben scheiterte jedoch, weil ihn die Schweizer Gesandtschaft in Budapest wissen liess, dass Deutschland die Durchreise aller ungarischen Kinder gestatte, mit Ausnahme jener, die «jüdischer Rasse» seien. Im Juli 1944 trat das US-amerikanische State Department mit dem Wunsch an Pilet-Golaz heran, die Schweiz möge in Ungarn als Schutzmacht die Interessen von El Salvador und Honduras wahren. Die Idee dahinter wurde ihm offen mitgeteilt: ungarische Juden mit Dokumenten zu versehen, um sie zu zentralamerikanischen Bürgern zu machen. Pilet willigte ein, und der Schweizer Vize-Konsul Carl Lutz, Chef der Schutzmacht-Abteilung der Schweizer Gesandtschaft in Budapest, rettete mit der Verteilung von falschen Pässen Zehntausenden Juden das Leben.[63]
Die diplomatischen Leistungen des Aussenministers und früheren Bundespräsidenten spielten sich hinter den Kulissen ab. Seine doppelbödige Rede wirkte jedoch nach, der Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in die Schweizer Regierung war erschütternd. Pilet-Golaz war von breiten Bevölkerungsteilen zum Buhmann der Nation abgestempelt worden. Er mag zwar bisweilen mit dem Endsieg des Dritten Reichs gerechnet und defätistische Ideen gehegt haben, aber ein Nationalsozialist war er mitnichten. Er bot sich als Projektionsfläche von Ängsten und Ressentiments gegenüber den Achsenmächten an. Seine anpasserische Aussenpolitik, mit der er jede Reizung der Achsenmächte vermeiden wollte, stand ganz im Gegensatz zur Haltung seines Gegenspielers Henri Guisan, der als General entschieden für den Widerstand eintrat. Dass dieser 1934 noch voller Bewunderung für Mussolini war, ihn als einen Führer bezeichnete, der «alle Kräfte der Nation zu zähmen wusste», und sich mehrmals öffentlich für eine starke autoritäre Führung mit weniger Einfluss von Parlament und Parteien geäussert hatte, tat seiner Popularität keinen Abbruch. Er hielt sich klugerweise von den aussenpolitischen Entscheidungsprozessen der Regierung fern. Zur unangefochtenen Lichtgestalt avancierte er, nachdem er sämtliche höheren Schweizer Offiziere am 25. Juli 1940, also genau einen Monat nach Pilet-Golaz’ Rede, zum Rapport auf die Rütliwiese beordert hatte. Sein Tagesbefehl war unmissverständlich: «Solange in Europa Millionen von Bewaffneten stehen und solange bedeutende Kräfte jederzeit gegen uns zum Angriff schreiten können, hat die Armee auf ihrem Posten zu stehen!»[64]
Pilet-Golaz stand auf verlorenem Posten. Durch seine elitär-arrogante Art war er auf die unterste Stufe der Beliebtheitsskala abgesunken. Seine Gegner nannten ihn abschätzig «Cervelat-Golaz», weil er sich in einer Ansprache zur widersinnigen und despektierlichen Aussage hinreissen liess, ein Arbeiter könne sehr gut mit einem Cervelat pro Tag überleben. Forderungen nach seinem Rücktritt wurden immer lauter. Doch 1943 erfolgte ein Stimmungsumschwung – seine Aussenpolitik wurde im Rückblick neu beurteilt und sein Ansehen in der Öffentlichkeit und im Parlament war wieder hergestellt; im Dezember wurde er erneut gewählt. Nachdem aber die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen der Schweiz zur Sowjetunion Schiffbruch erlitten hatte, Pilet von Stalin als «Faschistenfreund» beschimpft wurde und von sozialdemokratischen Parlamentariern zum Rücktritt gedrängt worden war, demissionierte Pilet-Golaz im November 1944 und zog sich in sein Landhaus in Essertines-sur-Rolle am Genfersee zurück. Ohne sich für seine politische Haltung je erklärt zu haben, verstarb er 1958 in Paris.
So bedenklich wie die Rede von Pilet-Golaz ist die lange Zeit vom Schweizerischen Bundesrat vernebelte «Eingabe der Zweihundert» vom 15. November 1940. Diese Petition zur Aufhebung der Pressefreiheit geht auf die Verbindung von Vertretern des «Volksbundes für die Unabhängigkeit der Schweiz» mit Georg Trump[65], Presseattaché der deutschen Gesandtschaft in Bern, zurück. Als Reichsminister Joseph Goebbels unentwegt über die Schweizer Medien lästerte, brachte Trump seine Schweizer Gesinnungsgenossen zum Handeln. Auffallend ist, dass die Mehrheit der insgesamt 173 Petitionäre bekannte Professoren, Ärzte, Anwälte, Offiziere und Unternehmer aus dem Establishment der Deutschschweiz waren. Mitunterzeichner aus den Westschweizer Kantonen und dem Tessin lassen sich indessen an einer Hand abzählen.[66] Die «Eingabe der Zweihundert» an den Schweizerischen Bundesrat forderte unter dem Vorwand der schweizerischen Neutralität, Rücksicht auf die freundschaftlichen Beziehungen zu den Nachbarstaaten (gemeint waren natürlich Deutschland und Italien) zu nehmen und kritische Journalisten und Beamte zu entlassen. Ausserdem sei der Völkerbund aus der Schweiz auszuweisen. In einem internen Papier des «Volksbundes» waren vorgängig die zu entlassenden Chefredaktoren der liberalen Neuen Zürcher Zeitung, des Berner Bunds und der Basler Nachrichten sowie der Weltwoche, der National-Zeitung und der Nation namentlich aufgeführt.
Einer der Wortführer der Initianten war Hans Brändli, Direktor und späterer Verwaltungsrat des Rüstungsunternehmens Contraves AG. Er titulierte die Journalisten in einem Schreiben als «Rudel wirklicher Windhunde». Mit folgenden Worten, die aus dem Munde Mussolinis stammen könnten, postulierte er das sozialdarwinistische «Recht des Stärkeren»: «Man geht bei uns mit der Bemitleidung alles Schwachen, allen Unglücks und alles Übels entschieden zu weit. Die Individualität eines Verrückten ist nicht gleich derjenigen eines leistungsfähigen, brauchbaren Menschen».[67] Bundesrat von Steiger versicherte der Öffentlichkeit, die rechtsextremen Forderungen abzulehnen. Gleichzeitig empfing er aber eine Delegation der Petitionäre und gab ihnen die Zusicherung, ihre Anliegen ernst zu nehmen und weiter zu verfolgen.
Am 19. November 1940 verbot der Bundesrat die «Nationale Bewegung der Schweiz (NBS)», die für einen Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland einstand, und 1943 verschwand die letzte Frontenbewegung aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit.
Zur Ruhe kam die Schweiz nach Kriegsende aber lange nicht. Die restriktive Flüchtlingspolitik des Bundes erhitzte die Gemüter bis etwa 1950.