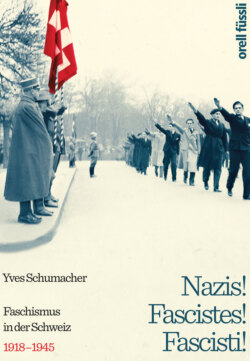Читать книгу Nazis! Fascistes! Fascisti! - Yves Schumacher - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hilflose Definitionsversuche
ОглавлениеRechtsextreme feiern heute wieder fröhliche Urstände. US-Präsident Donald Trump donnert gegen alle Medien und grenzt einwanderungswillige Muslime ganzer Länder pauschal aus; zu Beginn seiner Amtszeit stand im Hintergrund sein Einflüsterer Stephen Bannon, Ex-Chef des ultrarechten Onlinemagazins Breitbart News Network. Ob mächtige Anhänger der US-amerikanischen Alt-Right-Bewegung, die kleine «Partei National Orientierter Schweizer (PNOS)», die «Alternative für Deutschland (AfD)», die «Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)», die Jobik-Partei Ungarns oder die türkische «Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)» – sie alle bedienen sich im ideologischen Zeughaus der Urfaschisten mit Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Machismo und blindem Aktionismus.
Umberto Eco, der italienische Literat und Professor für Semiotik, führt in seinem Werk Vier moralische Schriften[8] vierzehn Merkmale auf, die den Faschismus festmachen. Je mehr sich die einzelnen Erkennungszeichen zusammenballen, desto akuter ist die Gefahr einer faschistischen Machtübernahme. Dennoch ist der Faschismus wissenschaftlich nicht generisch zu definieren. Der soziale Tatbestand hängt von subjektiven Einschätzungen sowie vom gesellschaftlichen Kontext ab. Versuche, Ecos Merkmale im konkreten Fall als Lackmustest für den Faschismus zu bemühen, scheitern deshalb, weil es eben keinen Faschismus-Koeffizienten gibt. Führende Vertreter der aktuellen Faschismusforschung finden auch keinen definitorischen Konsens.[9] So liefert auch die Diskussion, ob terroristische Organisationen wie der islamische Jihadismus ins faschistische Lager gehören, keinen Erkenntnisgewinn.
Eine mittlerweile überholte Interpretation sieht den Faschismus als Produkt der spezifischen politischen Bedingungen des frühen 20. Jahrhunderts und hat für die Gegenwart keine Relevanz. Im Zentrum dieser historisierenden Argumentationsschiene stehen die gesellschaftlichen Umwälzungen infolge des Ersten Weltkriegs und die Machtübernahme der Bolschewiken in Russland. Bekanntester Vertreter dieser These ist der konservative deutsche Historiker und Philosoph Ernst Nolte, der sie in den 1960er Jahren postuliert hatte. Er stützte sich auf eine vergleichende Interpretation des italienischen Faschismus, der «Action française» und des Nationalsozialismus. Noltes Ansatz ist phänomenologisch orientiert und verschliesst sich jedem von aussen herangetragenen Interpretationsmuster. Demnach lässt sich das Phänomen Faschismus nicht etwa ideengeschichtlich oder ökonomisch deuten, sondern nur aus dem Eigenverständnis der Bewegung selbst heraus. Aus diesem Blickwinkel erscheint der Faschismus in erster Linie als Gegenbewegung zum Kommunismus bzw. Marxismus, die sich als Bollwerk gegen die sozialistische Revolution in Russland und ihren Funkensprung nach Westeuropa verstand. So gesehen konnte der Faschismus auch Ängste der Liberalen und Konservativen instrumentalisieren, um mit ihnen ein Bündnis einzugehen, das sich letztlich gegen diese selbst wendete. Faschismus sei, so Ernst Nolte, eine «Gegenrevolution mit revolutionären Mitteln». Noltes Thesen haben noch in den 1990er Jahren eine heftige Kontroverse ausgelöst, die im Vorwurf gipfelte, Nolte relativiere den Faschismus und verharmlose ihn dadurch.[10]
Eine der frühesten und zugleich populärsten Interpretationen reduziert den Faschismus auf den Totalitarismus, der sämtliche Bereiche des staatlichen, gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens durchdringt und somit den von Mussolini schon früh angestrebten «stato totalitario» bildet. Dieser bestechende, aber zugleich simplizistische Definitionsversuch blendet jedoch spezifische Aspekte wie den Antisemitismus aus. Vor allem zu Zeiten des Kalten Krieges diente dieses Interpretationsmuster der Gleichstellung von faschistischen und kommunistischen Regimen, um deren Abwertung auf die gleiche Stufe zu stellen.[11]
Die marxistische Theorie hingegen deutet den Faschismus nicht als eigenständige Bewegung, sondern als besondere Ausprägung des Kapitalismus. Die historische Entwicklung zeigt jedoch, dass sich die Grossindustrie Italiens, Deutschlands und Österreichs vorerst auf die Seite der konservativ nationalen Kräfte schlug und die faschistische Bewegung erst im Zuge ihrer Erfolgsgewinne deutlich unterstützte. Auch spricht die ausgesprochen antikapitalistische Haltung der frühen rechtsextremen Bewegungen gegen die Behauptung, der Faschismus sei durch das Kapital planmässig gesteuert worden.[12] Die im Dezember 1933 am 13. Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale von Georgi Dimitroff vorgetragene Definition, wonach der Faschismus «die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals» gewesen sei,[13] traf in Italien zu keinem Zeitpunkt zu.
Eine interessante Diskussion in der Forschung dreht sich um die Frage des Verhältnisses des Faschismus zur Moderne und Aufklärung, die der deutsche Historiker Dr. Bernd Kleinhans im Online-Portal Zukunft braucht Erinnerung klar zusammenfasst: «Dabei stehen sich grundlegend zwei Positionen gegenüber: Die erste betrachtet den Faschismus mit seinen pseudoreligiösen Ritualen, seiner unhaltbaren Rassenlehre und den weltanschaulichen Mystizismen als Rückfall in vormoderne Verhältnisse. Faschismus erscheint in dieser Perspektive geradezu als Gegenpol zur Aufklärung und Vernunft. Andererseits hat der Faschismus selbst – abgesehen von einigen politisch bedeutungslosen Splittergruppen innerhalb der Bewegung – keinen Rückgang in vormoderne, mittelalterliche Zeiten angestrebt. Im Gegenteil: Sein ausgesprochener Fortschritts- und Technikfanatismus, sein Jugend- und Körperkult und der Glaube an die nahezu unbegrenzte Machbarkeit spiegeln eher moderne Tendenzen. Propagandaminister Goebbels hat beispielsweise die ‹stählerne Romantik› als Hingabe und Technik gegenüber der alten rückwärtsgewandten Romantik eingefordert. Begreift man die Leistung von Aufklärung und Moderne als Ausgestaltung von liberalen, individualistischen und pluralistischen Gesellschaftsmodellen, dann ist der Faschismus fraglos eine reaktionäre Bewegung. Sieht man indessen die in der Gründerzeit eingesetzte Entwicklung der Technik und Effizienz nicht etwa als eine von Gott gegebene, sondern als Merkmale einer beliebig gestaltbaren Sozietät, dann kann der Faschismus als Bewegung der Moderne gesehen werden.»[14]
Der konservative US-amerikanische Historiker Stainly Payne – emeritierter Professor für Neuere Geschichte an der University of Wisconsin-Madison – lehnt sich mit seinem umfassenden Werk Geschichte des Faschismus: Aufstieg und Fall einer europäischen Bewegung an die Forschungen des Historikers George L. Mosse an und geht von einem generischen Faschismus aus.[15] Er meint, dass die faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede aufweisen. Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen faschistischen Organisationen und dem autoritären Nationalismus der radikalen und konservativen Rechten sieht er mitunter im politischen Stil der Faschisten, die durch Massenmobilisierungen unter einem Führerprinzip ein antikommunistisches und antiliberales «faschistisches Minimum» bildeten.
Roger Griffin, emeritierter Professor der Oxford Brookes University in England, bringt die komplexen Aspekte des Faschismus in seiner 1991 erschienenen Monografie Nature of Fascism[16] unter einen einfachen Nenner: Faschismus lässt sich am besten als revolutionäre Form von Nationalismus definieren, die eine politische, soziale und ethische Revolution sein will, indem sie Menschen in einer dynamischen Gemeinschaft unter neuen Eliten mit einem Aufguss von heroischen Werten zusammenschweisst. Der Kernmythos, der dieses Projekt nährt, ist die Vorstellung, dass nur eine populistische, klassenübergreifende Katharsis die Flut der Dekadenz einzudämmen vermag.
Ganz anders argumentiert Robert O. Paxton, ein emeritierter Professor der Columbia Universität, New York, und renommierter Forscher des faschistischen Geschehens in Vichy-Frankreich. Er definiert den Faschismus anhand seiner Taten. In seiner The Anatomy of Fascism[17] teilt er die Entwicklung des Faschismus in fünf Stufen ein, die von seiner Entstehung über die Machtergreifung und Radikalisierung bis hin zum Niedergang reichen. Dabei analysiert und vergleicht er die spezifische Geschichte der einzelnen faschistischen Bewegungen und Regimes in jeder Entwicklungsstufe. Er kommt zum Schluss, dass nur jene faschistischen Bewegungen das Stadium der Machtergreifung erreichen konnten, denen es gelungen ist, mit den «traditionellen Eliten» ein Bündnis einzugehen. Paxtons Synthese kommt einer Definition gleich, wonach der Faschismus eine Form des politischen Verhaltens sei, das sich in obsessiver Weise mit Niedergang, Demütigung oder Opferrolle einer Gemeinschaft beschäftigt und dies durch Kulte der Einheit, Stärke und Reinheit kompensiert. Wenn Paxton meint, dass das Mussolini-Regime in einen konservativen Autoritarismus abgedriftet sei, derweil sich die Nationalsozialisten in Richtung einer grenzenlosen Machtausübung radikalisiert hätten, unterschätzt er möglicherweise den mörderischen Weg der italienischen Faschisten.
Werden diese zahlreichen Interpretationsmuster als Fragestellungen zu bestimmten Problemen herangezogen, mögen sie durchwegs hilfreich und klärend sein. In diesem Zusammenhang ist dann allerdings die Frage nach dem Verhältnis des Faschismus zu den gegenwärtigen besorgniserregenden politischen Entwicklungen in verschiedenen Ländern von besonderer Aktualität.[18]