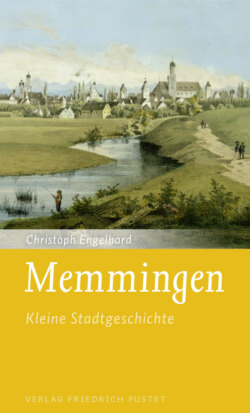Читать книгу Memmingen - Christoph Engelhard - Страница 11
Privilegierung der Stadt
ОглавлениеIm Oktober 1268 ließ Karl von Anjou den letzten staufischen Herzog von Schwaben Konradin auf dem Marktplatz von Neapel hinrichten. Damit war Schwaben herrenlos. In Memmingen konnte sich nun eine »universitas civium« als eigene Rechtspersönlichkeit gegenüber dem König und seinem Vertreter vor Ort, dem Ammann, emanzipieren. Erster Beleg dieser Entwicklung war 1270 ein eigenes »sigillum civitatis« (Stadtsiegel).
Der erste Habsburger auf dem Königsthron, Rudolf I. von Habsburg, versuchte verloren gegangene Besitztümer und Rechte des Reiches wieder geltend zu machen. Im Rahmen dieser Revindikationspolitik etablierte er Reichslandvogteien, darunter diejenige für Oberschwaben mit dem Allgäu und den Gebieten vom Oberlauf des Lechs bis hinunter zu den regionalen Metropolen Augsburg und Ulm (späteres »Vorderösterreich«).
Gleichzeitig befreite der König die »cives imperii« von den Fesseln der Feudalherrschaft von Adel und Kirche. 1286 garantierte er der Stadt Memmingen, sie weder zu verpfänden – was bei königlicher Finanznot häufig vorkam (1273, 1297, 1339, 1349) – noch zu vertauschen, und verlieh ihr subsidiär die Rechte der Stadt Überlingen. Per Stadtrechtsprivileg König Adolfs von Nassau kamen ab 1296 subsidiär die Ulmer Rechte zur Anwendung. Die Reichsstadt Ulm wurde zu einem wichtigen Orientierungspunkt der Memminger Stadtpolitik, zu dem sich später auch Augsburg und Nürnberg gesellten.
König Rudolf I. von Habsburg verlieh Memmingen 1286 erste Stadtrechte, subsidiär diejenigen der Stadt Überlingen.
HINTERGRUND
STADTRECHT UND BÜRGERRECHT
Die beiden Stadtrechtsprivilege von 1286 und 1296 fixierten einen mehrere Jahrhunderte getrennten Status von (freier) Stadt- und (leibeigener) Landbevölkerung, der erst mit der Aufhebung der Leibeigenschaft (zu Beginn des 19. Jhs.), der Gleichstellung von Stadt- und Landgemeinden und einer allgemeinen Partizipation der Bevölkerung unabhängig von Besitz oder Geschlecht (zu Beginn des 20. Jhs.) ein Ende fand.
Im Zentrum des hochmittelalterlichen Stadtrechts standen das Marktrecht und das Recht auf Immobilienbesitz als wesentliche Merkmale des Bürgerrechts. In die Stadt konnten sich Grundholden aus ihrer Leibeigenschaft befreien, indem sie nicht mehr zur Abgabe des Todfalls gegenüber ihren früheren Herren verpflichtet waren. Sie genossen nun den Schutz der Stadt, waren aber gegenüber der Stadtgemeinschaft zu Wehr- und Wachdiensten sowie Abgaben verpflichtet.
1396 führte Stadtschreiber Marquard Neidhardt aus Ulm die Inhalte der bislang erhaltenen Privilegien zu einer neuen Stadtrechtssammlung zusammen, die verschiedene Rechtsmaterien (u. a. Ahndung von Diebstahl, Totschlag, Mord und Unzucht, Pfändung, Bürger-, Erbschafts- und Vormundschaftsrecht, Zoll und Gült, Gewerbe) systematisierte und bis ins 16. Jh. hinein Gültigkeit behalten sollte.
»Bürger« nannten sich in den ersten Jahrzehnten zunächst nur die Angehörigen der Führungsschicht. Später weitete sich der Kreis auf diejenigen Stadteinwohner, die ein Haus ihr Eigen nannten. Um neu aufgenommen zu werden, mussten eine Aufnahmegebühr bezahlt und ein Bürgereid abgelegt werden. Heiratete ein Bürger eine Leibeigene, erwarb diese gemäß Privileg König Heinrichs VII. von 1312 das Bürgerrecht. Hinzu kamen Pfahl- und Ausbürger, die im Umland wohnten, einen bürgerlichen Status genossen oder als Adelige eng mit den Interessen der Stadt verbunden waren. Anders als die Bewohner des Landes und die Mägde, Knechte und Tagelöhner innerhalb der Stadtmauern waren die Bürger (und ihre Frauen) frei von feudalen Herrschaftsbeziehungen.