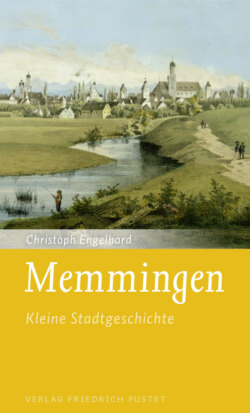Читать книгу Memmingen - Christoph Engelhard - Страница 15
Stadtgestalt
ОглавлениеEine im oberschwäbischen Vergleich gewaltige Stadtmauer mit einst sieben Toren und 26 Türmen umschloss Memmingen mit seinen etwas mehr als 800 Anwesen. Die Stadtbefestigung erfuhr ab dem späten 14. Jh. zwar keine Erweiterung mehr, jedoch verschiedene Anpassungen an moderne Wehrtechniken. Allerdings stagnierten die Wirtschafts- und Bevölkerungszahlen, vergleichbar der Entwicklung auch in anderen oberschwäbischen Städten. Um 1420 dürften etwa 5.000 Menschen in Memmingen gelebt haben.
In einer Unterstadt gruppierten sich die großen Häuser der Ministerialen und Kaufleuten samt einigen Häusern von Handwerkern im welfisch-staufischen Siedlungskern um Sankt Martin und den Marktplatz. Im Osten war diese verwinkelte Memminger Urzelle schon zu staufischer Zeit um eine Vorstadt planmäßig und für Zwecke des Marktes erweitert worden. Markt und Gesellschaft benötigten einen öffentlichen, besonders geschützten Raum und Friedensbereich. Auswärtige Handelsleute, die dem Stapelzwang unterworfen waren, mussten für ihre Waren Verkehrs- und Verbrauchsabgaben entrichten.
Durch das Kalchtor führte man bayerisches Salz zum Salzstadel und dann weiter durch das Wester- oder das Lindauer Tor ins Württembergische oder an den Bodensee. Südlich von Elsbethenkloster und Kornhaus bestand eine Oberstadt mit vorwiegend kleineren Handwerkeranwesen, Stadtbauernhöfen und Mietshäusern. Sie umschloss das Gerberviertel am Stadtbach und reichte bis zur Frauenkirche und zum südlichen Stadtausgang am Kempter Tor. Eine kleine Niedergassen-Vorstadt schloss sich im Norden an.
Giebelständige, meist verputzte Fachwerkhäuser mit vorkragenden Obergeschossen über markanten Korbbogenfriesen prägten das Memminger Stadtbild. Im Inneren der Häuser teilte ein Durchgang zum Hof das Erdgeschoss in Werkstatt und Laden. Eine schmale Treppe führte in die oberen Geschosse, dessen oberstes in der Regel der Vorratshaltung diente.
Zwischen Ober- und Unterstadt errichteten einige Zünfte am Holz- und Weinmarkt ihre Zunfthäuser – die Gerber 1444, die Weber 1478, die Merzler 1454, die Metzger 1487. Dort erwarben auch die Kramer 1479 ein Haus, das bis dahin den Künstlern Conrad Menger und Ivo Strigel als Werkstatt gedient hatte.
Zu den beiden Spitälern gesellten sich im Spätmittelalter kleinere Pfründehäuser innerhalb und Siechenhäuser vor der Stadt. Einer verbesserten Hygiene dienten einige Badstuben entlang des Stadtbaches oder an Quellen im näheren Umkreis der Stadt.
Verwaltung und Justiz hatten am Marktplatz ihren Sitz – zunächst über den Kramerläden beim Münzturm (»Steuerhaus«). Die hohe Gerichtsbarkeit bedurfte eines Bannbezirkes mit einem freistehenden Gebäude. Vermutlich über der Stadtwaage in der nordöstlichen Ecke des Marktplatzes wurde 1488 eine neue Ratsstube auf der oberen Laube errichtet, von der aus man die Beschlüsse und Satzungen des Rates verkündete; das Archiv mit den Privilegien und Urkunden verblieb im Steuerhaus.
HINTERGRUND
HEILIG-GEIST-SPITAL
Nach einem Brand 1223 ließ der »Spitalmeister« – so hieß der Memminger Klostervorstand – sein Spital neu errichten; zur Finanzierung von Bau und Unterhalt trugen zahlreiche Besitzungen bei, die der Heilig-Geist-Orden durch Stiftungen oder von Pfründnern erhielt. 1341 schenkte der Kaiser dem Orden das Patronat zu Unser Frauen; 1346 folgte die Inkorporation der Pfarrei durch den Augsburger Bischof, wobei bis 1479 kein Ordensmann, sondern ein Weltgeistlicher die Pfarrstelle besetzte.
Vergleichbar der Entwicklung in anderen Städten, gelang es 1365/67 der Reichsstadt, den Vorstand des Klosters aus der Verwaltung des Spitals zu drängen, um – wie es hieß – einen finanziellen Ruin dieser Sozialeinrichtung zu verhindern. Der Kloster- und Spitalkomplex wurde in ein Unterhospital (Spital) mit der Dürftigenstube im Erdgeschoss und in ein Oberhospital (Kloster) mit der Spitalkirche, den oberen Geschossen des Kloster- und Konventbaues sowie allen bis dahin erworbenen Kirchenrechten geteilt.
Das Unterhospital war seither das Zentrum mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Wohltätigkeit mit Spital, Waisenhaus, Pfründenhaus, Krankenhaus und auch einem Brauhaus. Es besaß und erwarb (vor allem zur Mitte des 15. Jhs., dann nochmals 100 Jahre später) zahlreiche Höfe in einem Umkreis von 10 bis 15 Kilometern sowie Gerichts- und Patronatsrechte u. a. in Steinheim, Buxach, Dickenreishausen, Memmingerberg, Frickenhausen, Arlesried und Woringen, sodass Memmingen schließlich in mehr als 30 Dörfern präsent war.
Das Oberhospital (Kloster) blieb dagegen für Spitalangehörige und Gläubige von prägender Bedeutung für ihr religiöses und geistig-kulturelles Leben. In Unser Frauen besaß der Heilig-Geist-Orden die Patronatsrechte – wie auch in Erkheim, Breitenbrunn, Volkratshofen und Holzgünz.