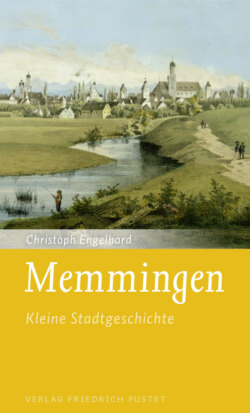Читать книгу Memmingen - Christoph Engelhard - Страница 18
Verfassungskonflikte zwischen Kaufleuten und Handwerkern
ОглавлениеIn einer zunehmenden Bürokratisierung der Verwaltung (Kanzlei) sowie einer Verlagerung der Entscheidungskompetenzen von den Zünften hin zum Rat angesichts wachsender wirtschaftlicher Schwierigkeiten und Versorgungskrisen werden die Ursachen für innerstädtische Auseinandersetzungen gesehen, die von 1471 bis 1473 sogar vor das kaiserliche Kammergericht gelangten. Die Familien der Kaufleute beklagten eine zunehmende Ausgrenzung, etwa dadurch, dass der Bürgermeister keine Stimme im Rat habe oder die Zunftmeister vor den Ratssitzungen Vorgespräche führten und gegebenenfalls einzelne Gegenstände von der Tagesordnung nahmen. Im Übrigen würden unfähige Personen zu Reichs- und Städtetagen gesandt und zu großzügig Leibeigene benachbarter Herrschaften ins Bürgerrecht aufgenommen. Die Beschränkung der Verwandtschaft im Rat solle gelockert und das Amt des Kämmerers häufiger auch mit Kaufleuten besetzt werden.
Die Klagen erhielten jedoch letztlich im kaiserlichen Urteil kein Recht. Gleichwohl festigte sich in der weiteren Folge die Vormachtstellung der Geschlechter im Stadtregiment, die sich in ihrer Lebensführung und ihrer Konzentration auf Großhandel und Finanzgeschäfte sowie in ihrem Streben nach herrschaftlichen Rechten dem Landadel annäherten.
Während aus so manchem Landgut ein adeliger Stammsitz wurde, stiegen in der Stadt einige zünftische Familien wie die Zehender, Span, Metzger, Löhlin oder Zangmeister in den Kreis des Patriziats auf. Die Spannungen innerhalb der Stadtgesellschaft verschärften sich; 1519 probten die Weber den Aufstand, da ihnen im Textilverlag mehr Mitsprache verweigert blieb; sechs Jahre später sympathisierte so mancher »gemeine Mann« mit den aufständischen Bauern.
PORTRÄT
ALBRECHT KUNNE
Aus Duderstadt im Eichsfeld stammte Albrecht Kunne (geb. um 1435), bei Gutenbergs Nachfolgern in Mainz dürfte er die Kunst des Buchdrucks erlernt haben. Ein Jahr nach der Gründung einer Papiermühle 1478 in Memmingen zog Kunne aus Trient in die schwäbische Reichsstadt, um hier in den folgenden drei Jahrzehnten mehr als 100 Einzeldrucke (wie etwa Ablassbriefe) und Bücher zu drucken – überwiegend theologischen, aber auch medizinischen oder geografischen Inhalts. Sein erstes Buch war 1482 die Weltgeschichte des Kartäusermönchs Werner Rolevinck »Fasciculus temporum«, ein damals viel gelesenes Geschichtsbuch. Später druckte er eine Geschichte Europas aus der Feder Ennea Silvio Piccolominis, des späteren Papstes Pius II., sowie 1486 erstmals in Deutschland ein Autorenbildnis (Paulus Attavanti Florentinus). Kunnes Lebensende nach 1520 liegt im Dunkeln.
Mit ausführlichen Bestimmungen legt Elisabeth Lauginger verh. Vöhlin 1490 die Grundlagen für ein Seel- und Schwesternhaus (»Vöhlins Klösterle«).
An den zahlreichen Altären von Sankt Martin lasen die Kleriker der Stadt für Bürger, Bruderschaften und Zünfte die Heilige Messe. Im Chorgestühl – von Memminger Handwerker und Bildschnitzern (u. a. Hans Herlin/Daprazhauser, Heinrich Stark, Hans Thoman, Christoph Scheller, Michael Zeynsler, Heinrich Heidelberger) zwischen 1501 und 1507 gefertigt – verrichteten sie das ihnen als Kollegiatstift auferlegte Chorgebet. Dabei waren sie umgeben von den maßgeblichen politischen und kirchlichen Vertretern der Reichsstadt, geformt zu einer Reihe höchst bemerkenswerter Wangenfiguren und Reliefs, die Bürgermeister, Stadtammann und ihre Ehefrauen, den Generalpräzeptor der Antoniterniederlassung bzw. Pfarrer von Sankt Martin, die Prediger, Kirchenpfleger sowie Handwerker und Künstler symbolisieren.
PORTRÄT
ERHARD VÖHLIN UND ELISABETH LAUGINGER
Über Generationen zählte die Kaufmannsfamilie Vöhlin zu den bedeutendsten und reichsten Memminger Geschlechtern. Zugezogen aus dem Bodenseeraum wird sie ab der Mitte des 14. Jhs. zunächst als Salz- und Weinhändler erwähnt. Um 1400 wandte sich die Familie dem Handel mit Baumwolle, Leinwand und Barchent zu – über Brenner und Fernpass nach Venedig oder Frankreich nach Süden, über Wien in den Osten und über Frankfurt bis nach Flandern oder ins Fränkische nach Nürnberg. Zu einem weiteren Erwerbszweig wurde schließlich der Handel mit Pfeffer aus Ostindien (über Venedig, Genua oder Portugal).
Erhard Vöhlin (1419–1484) erweiterte mit seinen beiden Eheschließungen (1441 mit Barbara oder Ursula Imhof aus Ulm, gest. 1452, und Elisabeth Lauginger aus Augsburg) die wirtschaftlichen Beziehungen in die benachbarten Reichsstädte wesentlich. Er bekleidete als Rat, Stadtammann, Geheimer oder Bürgermeister zahlreiche öffentliche Ämter. Mit dem Erwerb der Herrschaft Frickenhausen wurde Erhard Vöhlin 1460 Grund- und Gerichtsherr sowie Patronatsherr der zugehörigen Pfarrkirchen. Zu Sankt Martin stiftete er 1479 eine Prädikatur, auf die 34 Jahre später ein Theologe namens Christoph Schappeler berufen werden sollte. Erhard Vöhlin verstarb 1484. Im darauffolgenden Jahr war das Vöhlinsche Haus unweit des Salzstadels Quartier für Kaiser Friedrich III. Erhards Witwe Elisabeth (gest. 1509) stiftete 1490 im Einvernehmen mit ihren Vormündern (Hans Vöhlin und Anton Welser) ein »Seel- und Schwesternhaus« für häusliche Krankenpflege, das bald als »Vöhlinsches Klösterle« firmierte. Im Gebet gedachten die Schwestern der verstorbenen Familienangehörigen; im wohltätigen Arbeiten sorgten sie für deren Seelheil.
1496 schlossen sich mit den Memminger Vöhlin und den Augsburger Welser zwei der reichsten Handelsfamilien beider Reichsstädte zur Gesellschaft »Anton Welser, Konrad Vöhlin und Mitverwandte« zusammen. Firmensitz wurde die bedeutend stärkere Metropole Augsburg, wo Stadtschreiber Dr. Konrad Peutinger, verheiratet mit Margrete, einer in Memmingen geborenen Tochter Anton Welsers, die überseeischen Aktivitäten des Unternehmens unterstützte (u. a. 1505 nach Ostindien und 1529 nach Venezuela).