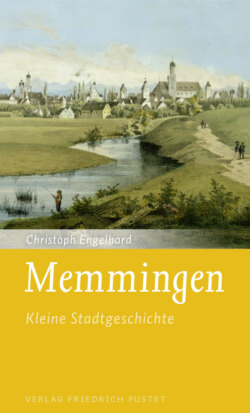Читать книгу Memmingen - Christoph Engelhard - Страница 17
Kirche, Kunst und Kultur
ОглавлениеDie Kirche Sankt Martin war schon seit Jahrzehnten eine Großbaustelle. Erfahrene Kirchenpfleger aus der Mitte der städtischen Gesellschaft sammelten das nötige Geld. Mit Conrad von Amberg gelang es ab 1404 das Langhaus zu vollenden. Bei der Verlängerung des Langhauses ab 1489 und beim abschließenden Hochchor 1496 kam der Ulmer Münsterbaumeister Matthäus Böblinger zu Hilfe. Nicht bekannt sind der Baumeister des oktogonalen Turmabschlusses von 1538, jedoch die Memminger Instrumentenbauer – Jörg Wier d. Ä. (tätig zwischen 1510 und 1530) und d. J. (um 1485–1549) –, die damals für viele Türmer und Stadtpfeifer in Europa gebogene und gedrechselte Krummhörner herstellten, damit ihre kirchlichen und weltlichen Signale ausreichend Gehör und ihre Musik bei Hochzeiten, Schützenfesten oder in der Fasnacht gefälligen Anklang fand.
Bürgerlicher Wohlstand ermöglichte eine Förderung von Kunst und Kultur. Kraft ihrer finanziellen Möglichkeiten erteilten die Besserer, die Funk, Haintzel, Imhof, Vöhlin und Zangmeister den Bildhauern, Malern und Baumeistern der Stadt Aufträge zur Bemalung der Kirchenwände, zur Aufrichtung von Altären, Gestaltung von Altarbildern oder Fertigung von liturgischen Gerätschaften (»vasa sacra«). Manche Kapelle blieb allerdings den Augen der Öffentlichkeit verschlossen, so die Kirchen der Augustinerinnen zu Sankt Elsbeth (»schwarze Schwestern«) beim Kornhaus und der ab 1444 in der Krankenpflege tätigen Franziskanerinnen bei Maria Garten (»graue Schwestern«) unweit der Frauenkirche.
1475 erhielt Hans Strigel den Auftrag, den neuen Kreuzgang im Elsbethenkloster mit Fresken auszustatten. Die Kreuzigungsszene zeigt im Hintergrund eine Ansicht der Stadt Jerusalem (mit Ähnlichkeiten zur damaligen Reichsstadt Memmingen).
Schon zur Mitte des 15. Jhs. war die neue Augustinerklosterkirche vollendet. Von 1467 bis 1470 erweiterten die Franziskanerinnen ihr Kloster Mariengarten. Ab 1464 wurden Chorgewölbe und Langhaus von Unser Frauen freskiert, 1475 der neue Kreuzgang bei Sankt Elisabeth (Elsbeth). Von 1480 bis 1484 ersetzte Spitalmeister Andreas Aichelberger die alte Spitalkirche durch einen Neubau.
Eine Modernisierung erfuhr 1484 auch die Dreikönigskapelle; 1399 hatte der Bürger Nikolaus Tagbrecht – sein Lebensende vor Augen – hier an der Kalchstraße eine »Kapelle mit ewig Seelgerät und Seelhaus« gestiftet. Aus den grundherrschaftlichen Erträgnissen des Dorfes Lauben verrichteten Geistliche Gebete für das Seelenheil der Stifterfamilie und betreuten Pfleger und Pflegerinnen mindestens vier arme Menschen.
PORTRÄT
HANS, IVO UND BERNHARD STRIGEL
Auf Handelswegen oder den Spuren der Antoniter gelangte so manches Werk der Memminger Künstlerfamilie Strigel in spätgotische Kirchen in Tirol oder Graubünden. Aber auch in Memminger Kirchen sind von Hans Strigel d. Ä. (gest. 1462) herausragende Fresken erhalten, Hans d. J. und Ivo (1430–1516) traten künstlerisch in die Fußstapfen ihres Vaters. In Ivos Werkstatt am Weinmarkt (ab 1479 in der Kalchstraße) wurden Skulpturen geschnitzt und farblich gefasst, Bildnisse vorwiegend religiösen Inhalts gemalt und Altäre gezimmert.
Sein Neffe Bernhard (um 1460–1528) entdeckte neue Möglichkeiten in Komposition, Farbigkeit und Lichtgestaltung. Als Hofmaler Kaiser Maximilians war er in seiner Heimatstadt auch als Zunftmeister und Rat, aber auch als Gesandter in Religionsangelegenheiten unterwegs.
Stadt und Kirche bildeten eine »Sakralgemeinschaft«, sichtbar in der jährlichen Gregorius-Prozession mit dem Heiltum oder in der vierteljährlichen »Großen Spende« für die Armen der Stadt in und vor der Martinskirche. Laien und Klerus waren im Alltag vielfältig miteinander verbunden, am Schwörtag in der Augustinerkirche, bei der Verwaltung des Heilig-Geist-Spitals, in der Verwaltung kirchlicher Stiftungen oder im Wirken der Bruderschaften zum Seelenheil ihrer Mitglieder.
In Memmingen veröffentlichte Stadtarzt Dr. Ulrich Ellenbog (um 1435–1499) eine Schrift über giftige Dämpfe (1473) und eine Anleitung gegen die Pestilenz (1494). Sein Sohn Nikolaus (1481–1543), ein Ottobeurer Benediktiner, gilt neben Konrad Peutinger in Augsburg als wichtigster Vertreter des Humanismus in Schwaben, der mit vielen Größen seiner Zeit, darunter Erasmus von Rotterdam, in regem Austausch stand. Neue medizinische Erkenntnisse und die Enge der Kirchhöfe bei Unser Frauen und Sankt Martin veranlassten den Rat 1529, auf dem Areal des einstigen Schottenklosters vor der Stadt einen neuen »Gottesacker« einzurichten (heute Alter Friedhof); Pestkranke waren schon zuvor außerhalb der Stadt bei Sankt Leonhard begraben worden.
PORTRÄT
PETRUS MITTE DE CAPRARIIS
1439 übertrug der Abt zu Saint-Antoine dem bisherigen Gesandten und Ordensvisitator Petrus Mitte de Caprariis (um 1416–1479) die Pfründe des Antoniterspitals in Memmingen. Ohne seine Ordensaufgaben aufzugeben und nach Absolvierung eines Theologiestudiums in Heidelberg vergrößerte der neue Generalpräzeptor ab 1454 das Spital zu einer höchst bemerkenswerten Vierflügelanlage. Die Antoniterkirche (heute Kinderlehrkirche) erhielt ihre heutige Gestalt, die Pfarrkirche Sankt Martin Gewölbe und Fresken. Seine Deutschkenntnisse verbesserte er soweit, dass er auch pastorale Aufgaben übernehmen und zu den Gläubigen predigen konnte. Zeit seines Lebens verwandte Petrus Mitte auch Kraft, Geld und Zeit auf die Förderung von Kunst und Literatur; per Testament wurde seine Studienbibliothek zum Grundstock der Memminger Stadtbibliothek.
Stadtarzt Jakob Stoppel (1470–1535) gab 1519 bei Albrecht Kunne ein Repertorium aller »Meere, Quellen, Flüsse, Berge, Völker, Staaten und Städte der bereits bekannten Welt« in Druck. Darin widmete er einige Absätze auch dem neuen Kontinent »America«.