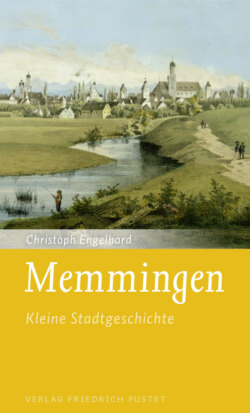Читать книгу Memmingen - Christoph Engelhard - Страница 9
Welfischer Herrschaftssitz
ОглавлениеMemmingen wird – anders als so mancher Ort der Region – in Urkunden des 8. Jhs. nicht genannt, wenngleich die verkehrsgeografische Lage Memmingens doch für eine durchgehende Siedlungskontinuität und die Existenz eines Königshofes sprechen würde.
Eine Traditionsnotiz auf Pergament zum Gründungsvermögen des Benediktinerklosters Ochsenhausen, ausgestellt am 26. März 1128, berichtet, dass am 31. Dezember 1099 die vier Schwestern von Hawin, Adelbert und Konrad, der Söhne Hattos von Wolfertschwenden, auf einem welfischen Hoftag in deren Ochsenhausener Klosterstiftung einwilligten. Herzog Welf IV. von Bayern hatte dazu seine »comprovinciales« ins (erstmals erwähnte) »oppidum mammingin« geladen. Memmingen war somit ein Ort von Rechtsgeschäften und ein Zentrum welfischer Herrschaft, die von Weingarten-Ravensburg über Memmingen und Kaufbeuren bis nach Schongau reichte. Am westlichen flachen Hang des Memminger Trockentales dürfen wir einen befestigten Herrensitz annehmen. In seiner unmittelbaren Umgebung (»Herrenstraße«) gingen Ministerialen, Handwerker und Handelsleute innerhalb eines »umfriedeten Raumes« ihren Diensten bzw. Tätigkeiten nach.
Die »Historia Welforum« erzählt von bewaffneten Auseinandersetzungen der Welfen mit den staufischen Herzögen. Es ging um die Macht in Schwaben und um die deutsche Königskrone. Um 1130 ließ Stauferherzog Friedrich II. von Schwaben Memmingen niederbrennen; bei Grabungen stoßen die Archäologen bisweilen auf eine entsprechende Brandschicht. Dieses einschneidende Ereignis bedeutete aber nicht das Ende der Siedlung. »In villa nostra Maemingen« fertigte Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen, 1142 eine Schenkungsurkunde aus – zur Vergebung seiner und seines Vaters Sünden im Kampf um die Macht. 1151 traf sich derselbe in Memmingen mit seinem Onkel Welf VI. und mit Stauferherzog Friedrich, um den Streit zwischen Staufern und Welfen zu beenden.
Während 1152 Friedrichs Sohn Friedrich Barbarossa den deutschen Königsthron bestieg, verstärkten die Welfen ihre Herrschaft in Ostschwaben durch diverse Stützpunkte, zu denen neben Landsberg und München (1158) auch die »villa« Memmingen gezählt werden darf.
PORTRÄT
HERZOG WELF VI.
Eine Burg oder ein Schloss sucht man in Memmingens Geschichte und Stadtbild vergeblich. Das hat auch mit der Emanzipation der Siedlung von ihren frühen Stadtherren zu tun, zu denen an entscheidender Stelle auch ein Herzog aus dem Geschlecht der Welfen zählt, dessen Ursprünge in karolingische Zeit zurückreichen. Welf VI., Enkel des bayerischen Herzogs Welfs IV. und Sohn Heinrichs des Schwarzen wurde 1115 geboren. Durch seinen Vater (seit 1120 Herzog von Bayern) und seine vier Schwestern (verheiratet mit Bregenzern, Staufern, Zähringern und Vohburgern) war sein Leben (in Regensburg) früh mit den bedeutendsten, um die Vorherrschaft in Schwaben rivalisierenden Geschlechtern verbunden. Als der Vater 1126 starb, wurde Welf zum Vertreter des welfischen Besitzes vor allem in Oberschwaben und sein Bruder Heinrich der Stolze (wenig später verheiratet mit einer Tochter des Königs) bayerischer Herzog.
1152 belehnte ihn König Friedrich I. Barbarossa mit dem Herzogtum Spoleto und der Markgrafschaft Tuszien (Toskana), um das Reich gegen die Ansprüche des Papstes abzusichern. Zweimal nahm Welf an Kreuzzügen ins Heilige Land teil. Die »Historia Welforum« berichtet von prachtvollen Festen Welfs VI. in Memmingen und andernorts; den Klöstern und Künstlern gegenüber zeigte er sich wohlgesonnen. Seinem Wunsch gemäß bestattete man ihn 1191 im Kloster Steingaden.
Eine »muralia« aus Kalktuffsteinen, wohl im frühen 13. Jh. vollendet und 1270 erstmals in den Quellen erwähnt, schützte die Siedlung, die man von Osten am Heilig-Geist-Spital vorbei betrat, und die bis zum heutigen Weinmarkt reichte. Im Stadtbild dominierten damals neben einigen Wohntürmen vor allem Fachwerkbauten – um den Kirchhof von Sankt Martin herum und am Marktplatz. Südlich von Memmingen stand eine der Gottesmutter Maria geweihte, 1258 erstmals erwähnte Kirche, deren Patronatsrechte ebenso wie bei Sankt Martin zunächst in der Hand des Königs lagen.
Herzog Welf VI. (um 1115/16–1191) stiftete vor seiner Reise 1167 ins Heilige Land »extra muros«, also außerhalb der Memminger Stadtmauern, ein kleines Benediktinerkloster iroschottischer Ausprägung. Nach dem Tod seines einzigen Sohnes zog er sich aus dem Konflikt mit den Staufern zusehends zurück und übergab seinen Besitz 1178 dem Stauferkaiser, um ihn zeitlebens als Lehen übertragen zu erhalten. Memmingen blieb ein bevorzugter Aufenthaltsort des Herzogs bis zu seinem Tod am 15. Dezember 1191.
Alljährlich zogen Bürgerschaft und Geistlichkeit der Reichsstadt am Tag des Heiligen Gregorius (12. März) mit einer Wunderhostie (»Heiltum«) um die Stadt. Das Gemälde Johann Friedrich Sichelbeins zeigt im Hintergrund die Silhouette Memmingens im ausgehenden 17. Jh.