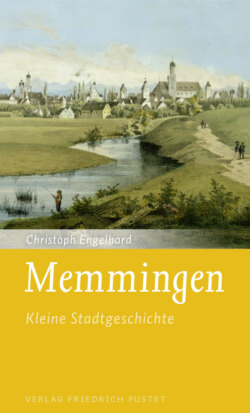Читать книгу Memmingen - Christoph Engelhard - Страница 13
Zünftisch verfasste Reichsstadt: Memmingen im späten Mittelalter
ОглавлениеDas Jahr 1347 gilt als epochale Wende in der Memminger Stadtgeschichte; es steht am Beginn einer 200-jährigen Blütezeit, die – trotz einiger Krisen, Kriege und Seuchen – alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche umfasste und das Bild der Stadt bis zur Mitte des 16. Jhs. nachhaltig prägte. Wurde Memmingen im ausgehenden 13. Jh. mit einigen Freiheiten gegenüber der adeligen Feudalherrschaft des Umlandes privilegiert, erhielten die Bürger der Stadt nun eine verfassungsmäßige Teilhabe an der Gestaltung des Gemeinwesens. Zusammen mit den Familien der Salz-, Wein- und Textilienhändler, die sich zur Großzunft zusammenschlossen, bildeten die Zünfte der Handwerker die Basis der Stadtverfassung. An ihrer Spitze standen Zunftmeister, die die wirtschaftlichen, aber auch politischen und gesellschaftlichen Aufgaben der Zünfte koordinierten.
Als Schwur- und Eidgenossenschaft verpflichteten sich die Bürger zu gegenseitiger Treue und Gehorsam gegenüber dem Stadtregiment sowie zur Begleichung von (Vermögens-)Steuern und (Verbrauchs-)Abgaben zur Finanzierung gemeinschaftlicher Aufgaben. Rat und Amtspersonen erwiderten dies durch Ablage von Amtseiden.
1350 verlieh König Karl IV. das Ammann-Amt an Rat und Bürgerschaft – zunächst befristet, später nach mehrfacher Verlängerung und einjähriger Verpfändung endgültig. Die Kompetenz des Ammanns war von hoher Bedeutung, war er doch seit 1403 Träger des Blutbannes, konnte also ohne Zutun von Reichsgerichten Lebens- und Leibstrafen verhängen. Mit der Verleihung der Blutgerichtsbarkeit 1438 an die Reichsstadt unter Oberhoheit des Königs und seines Vertreters, des Reichslandvogtes, war die Entwicklung Memmingens zur Reichsstadt weitgehend abgeschlossen. Die Stadt hatte einen Sitz im Reichstag, war aber auch zur Zahlung von Reichssteuern und zur Abstellung von Landsknechten (»Reisigen«) für das Reichsheer verpflichtet.
HINTERGRUND
ZUNFTVERFASSUNG
Die ab 1347 geltende Zunftverfassung kennt – nach einigen Jahren der Konsolidierung – elf Handwerkerzünfte, nämlich in der Reihenfolge ihrer Leistungsfähigkeit und Pflicht zur Aushebung von Wehrpflichtigen: Kramer (mit Apothekern, Bleichern, Gürtlern, Seilern, Weinschenken); Metzger; Merzler und Müller; Schuhmacher; Zimmerer und Maurer; Weber; Schneider; Gerber; Bäcker und Bräuer; Schmiede, Schlosser, Uhrmacher und Zinngießer; Lodner und Färber. Die Kaufleute (»Geschlechter«) schlossen sich zur zwölften Zunft, der sog. Großzunft bzw. Gesellschaft zum Goldenen Löwen zusammen.
Der Rat setzte sich aus den zwölf Zunftmeistern und weiteren zwölf von den Zünften vorgeschlagenen Räten zusammen, die jährlich im Frühjahr von den sog. Elfern (Zunftvertretern) gewählt wurden. Die Zünfte bestimmten über die Besetzung der beiden wichtigsten Ämter der Stadt: Bürgermeister und Ammann. Die Amtszeiten waren häufig beschränkt, Wiederwahlen nach ein- oder zweijähriger Amtszeit (so beim Ammann) verboten, um zu verhindern, dass wie bislang wenige Familien zu sehr die Geschicke der Stadt beeinflussten. Bei grundlegenden Entscheidungen fanden sich Rat und Elfer zur Gemeinde zusammen. Sollte die Legitimation von Ratsbeschlüssen nochmals erhöht werden, traten jeweils zwei Vertreter aus jeder Zunft zum Großen Rat hinzu.
Formell besaßen alle zwölf Zünfte gleichermaßen Mitwirkungsrechte am Stadtregiment, waren also die Basis eines als gerecht angesehenen Partizipationsmodells. Die Verfassungswirklichkeit legte allerdings offen, dass sich die Mitglieder der Großzunft weit mehr als Handwerker öffentlichen Aufgaben widmeten bzw. für derartige zeitraubende Tätigkeiten abkömmlich waren. Ihre gesellschaftliche Vorrangstellung kam auch dadurch zum Ausdruck, dass ihre »Bürgerzech« in unmittelbarer Nähe des Rathauses stand, während sich die Versammlungshäuser der Handwerkerzünfte um den Weinmarkt gruppierten.
Mit Brief und Siegel wurde 1347 in Memmingen eine Zunftverfassung eingeführt. Die Pergamenturkunde galt bis 1551/52 als Grundgesetz der Reichsstadt. Das an ihr hängende Wachssiegel zeigt das damalige Stadtwappen: Gespalten, vorn (in Silber) ein durchgehendes (rotes) Tatzenkreuz, hinten (in Gold) ein halber (rot bewehrter schwarzer) Adler am Spalt (seit dem 16. Jh. Seiten gewechselt).