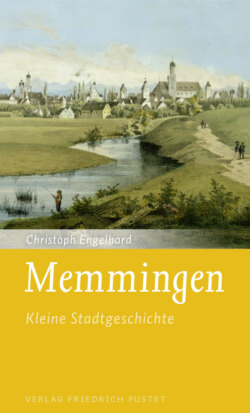Читать книгу Memmingen - Christoph Engelhard - Страница 14
Zentral- und Gerichtsort im Netz schwäbischer Städte
ОглавлениеDem Ausbau einer geordneten königlichen Gerichtsbarkeit diente das seit 1342 quellenmäßig fassbare Landgericht Marstetten, das zunächst in Memmingen tagte, ehe es in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. nach Weißenhorn verlegt wurde. Memminger Bürger waren Beisitzer dieses Gerichts, ab 1424 war dieses sogar an die Stadt verpfändet. Sein Einflussbereich reichte vermutlich vom Bodensee und den Alpen bis an den Lech und die Donau, schloss in jedem Falle Oberschwaben und die Herrschaft Eisenburg (Amendingen, Eisenburg, Trunkelsberg, Schwaighausen) mit ein. Nach 1489 trat an seine Stelle die Landvogtei Schwaben, die damals allerdings bereits von einer Reichsinstitution zu einem habsburgischen Herrschaftsinstrument geworden war.
Mit der Legitimation Memmingens als Reichsstadt ging eine Stärkung der Zentralörtlichkeit in der Region einher. Die Stadt sorgte sich um die Handelswege und Illerübergänge. Brücke und Zoll zu Marstetten befanden sich jedoch in der Hand des Truchsess von Waldburg; spätestens 1510/11 errichtete Memmingen bei Egelsee eine weitere Brücke über die Iller.
Um bürgerliche Interessen gemeinsam zu vertreten, das Räuberunwesen zu bekämpfen, Ansprüche benachbarter Adeliger abzuwehren und sich vor Verpfändungen zu schützen, schlossen sich oberschwäbische Städte zu Bündnissen zusammen. Doch waren laut Goldener Bulle von 1356 derartige Städtebünde untersagt. König Karl IV. sah 1370 jedoch Möglichkeiten für ein Landfriedensbündnis gegen die regionalen Rittergesellschaften. Als er aber begann, einzelne Städte an Bayern oder Württemberg zu verpfänden, schlossen sich 1376 14 Reichsstädte einschließlich Memmingen zum Schwäbischen Städtebund unter Führung der Reichsstadt Ulm gegen fürstliche Ansprüche zusammen. Bis 1389 tobte ein Krieg zwischen Städten und Rittern, die sich zu Ritterbünden zusammenfanden – auch um ihrerseits dem Raubrittertum wie auch den Interessen der herzoglichen Familien (Habsburger, Wittelsbacher) Einhalt zu gebieten.
1422 waren Memminger Bürgersöhne an den Feldzügen gegen die Hussiten beteiligt, 1441 »mit der großen Büchs« beim Rachefeldzug im Hegau, 1449 gegen den Grafen Ulrich und 1452 gegen Hans von Rechberg, dessen Feste Ruckburg bei Bregenz ein Memminger Büchsenmeister in Schutt und Asche legte. Im Fürstenkrieg 1458–1463 kämpften Memminger gegen Albrecht Achilles, den Markgrafen von Brandenburg-Ansbach.
1488 zogen wehrpflichtige Memminger Bürger – in Harnisch und blaue Röcke mit Streifen in den Stadtfarben schwarz-rot-weiß gekleidet – nach Brügge, um König Maximilian aus der dortigen Gefangenschaft zu befreien. Der König erinnerte sich wenig später der Solidarität des Reiches und war auch in seiner und des Heiligen Römischen Reichs Stadt Memmingen regelmäßig zu Gast. Ab 1490 war Memmingen eine Station an der ersten organisierten Postlinie zwischen Rom und den Niederlanden.
Um den Landfrieden nachhaltig zu wahren, vereinigten sich 1488 die Reichsstände Schwabens, darunter die großen Territorialstaaten, der Hohe Adel, die Prälaten der Reichsklöster und alle 20 Reichsstädte zum »Schwäbischen Bund«. Seine Organisation mit Versammlung, Räten und Bundeshauptleuten wurde zu einem wesentlichen und beispielhaften Element der Reichsreformen unter den Kaisern Friedrich III. und Maximilian I. Der Bund war aber auch ein habsburgisches Instrument gegen wittelsbachische Expansionsbestrebungen in Schwaben oder gegen die schweizerische Eidgenossenschaft im sog. »Schweizerkrieg« 1499. Ab 1500 bestanden neben Hauptleuten und Bundestag ein Bundesgericht und eine Kasse zur Finanzierung eines Bundesheeres, etwa gegen Herzog Ulrich von Württemberg 1519 oder gegen die aufständischen Bauern in Franken und Schwaben 1525.
Als der Schwäbische Bund 1534 zerbrach, übernahm der zu Beginn des 16. Jhs. errichtete schwäbische Reichskreis vollends Zuständigkeiten in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Polizei, Zoll- und Münzwesen, Handelspolitik, Medizinalwesen, Reichssteuern und Landesverteidigung. Neben Fürsten, Adeligen und Klöstern saßen auch städtische Vertreter in den Kreistagen; Direktor des Augsburger Kreisviertels, zu dem u. a. die Reichsstadt Memmingen zählte, war der Bischof von Augsburg.