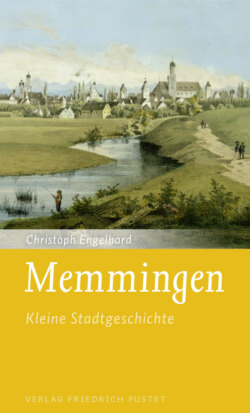Читать книгу Memmingen - Christoph Engelhard - Страница 7
ОглавлениеVor- und Frühgeschichte: Erste Siedlungsspuren im Memminger Raum
Naturkundliche Grundlagen
Seinen »Mineralogischen Briefen« legte 1805 der ehemalige Kanzleidirektor der Reichsstadt Memmingen und nunmehrige Bergkommissar, Friedrich von Lupin (1771–1845) eine »petrographische Charte« bei, mit der er im Raum Schwaben und Tirol die Gebirgszüge und die dort zu findenden Gesteinsarten beschrieb. In den folgenden Jahrzehnten kam die Forschung zur Erkenntnis, dass der Gebirgsbildung in der Tertiärzeit vor 2,4 Millionen Jahren im Quartär diverse Klimaschwankungen folgten; abfließendes Wasser aus dem Lech-Iller-Gletscher trug zur typischen Nordsüdgliederung des Memminger Landes bei, bis sich schließlich nach dem Rückzug des Gletschers vor 18.000 Jahren die für das Voralpenland so typischen Moränen der Gletscher und daran anschließende Schotter-Terrassen auf Molasse bildeten und den großen Wasserreichtum (samt einiger Heilquellen) begründen.
Auf diesen geologischen Gegebenheiten bildete sich eine Flora, die in den vergangenen Jahrhunderten mehrfach intensiv erforscht wurde, u. a. von Pfarrer Christoph Ludwig Köberlin (1794–1862), Apotheker Julius Rehm (1830–1887) und Arzt Dr. Christoph Huber (1830–1913). Sie entdeckten so manche botanische Seltenheit, darunter Gelber Lein, Schachbrettblume, Gauklerblume und Frauenschuh sowie die Riednelke (Armeria purpurea) unterhalb des Memminger Trockentales im Hochmoor des heute sog. Benninger Riedes.
Dieses Ried besitzt mit der Memminger Ach (Stadtbach) sowie dem Haienbach östlich von Memmingen zwei Abflüsse nach Norden in Richtung Iller. An diesem wasserreichen Ort, der sich – anders als die höheren und niederschlagsreicheren Zonen weiter südlich – auch für den Anbau von Feldfrüchten gut eignete, siedelten sich Menschen an. Damit begann in einer noch weitgehend schriftlosen Zeit die Geschichte Memmingens und die Umgestaltung eines Naturraumes zu Kulturlandschaft und Siedlungsraum, dem so manche Tierart (z. B. der Bär) gewichen ist.
Bei ersten Grabungen an Hügelgräbern bei Volkratshofen fand Studienlehrer Jakob Friedrich Unold 1823 verschiedene Grabbeigaben. Die Fundstücke wurden 1882 der neuen Memminger Altertumssammlung (heute Stadtmuseum) übergeben.
Keltische und römische Spuren
Wohl im Zusammenhang mit Illerübergängen stehen die keltischen Nekropolen aus der Hallstattzeit bei Tannheim, Buxheim und Volkratshofen aus dem 8. bis 5. Jh. v. Chr. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Grabplätze für Angehörige der Oberschicht, die in Holzkammern unter aufgeschütteten Hügeln samt Waffen, Schmuck und Keramikgefäßen (für Nahrungsmittel) bestattet wurden; Überreste von Gehöften mit Wohn-, Stall- und Vorratsgebäuden wurden im Memminger Raum bislang nicht gefunden.
Nur wenige Spuren hinterließen hier auch die Vindeliker. Im Jahr 15 v. Chr. eroberten die Stiefsöhne von Kaiser Augustus, Tiberius und Drusus, das vindelikische Alpenvorland. Funde zeugen von der Bewirtschaftung und Kultivierung des Landes: Münzen in Kellmünz und auffällig häufig an weiteren Stellen, eine villa rustica in Amendingen aus dem 2./3. Jh. n. Chr., Haushaltsgegenstände im Bereich des Antonierhauses aus ebenjener Zeit, Reste eines Ziegelofens und eines Bades am Königsrain bei Dickenreishausen.
Mitglieder der Anthropologischen Gesellschaft (ab 1887 des Altertumsvereins) machten sich im späten 19. Jh. auf, die Vor- und Frühgeschichte im weiten Umkreis um Memmingen zu erforschen. Sie entdeckten einen römischen Burgus aus der Zeit Kaiser Valentinians auch im Bereich der Martinskirche, berichteten solches dem Generalkonservatorium der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns, unterließen jedoch eine exakte Vermessung der Fundstelle, um den Fund und seine tatsächliche Datierung und Bedeutung nachvollziehen zu können. Moderne archäologische Grabungen haben gezeigt, dass in der römischen Spätantike von einer kleinräumigen Besiedlung (villae rusticae, burgi) auszugehen ist. An der Handelsstraße von Caelio monte (Kellmünz) nach Cambodunum (Kempten) dürfte auch in Memmingen eine solche römische Siedlung gewesen sein, bis Alemanneneinfälle ab der Mitte des 3. Jhs. zur allmählichen Aufgabe römischer Kastelle und Villen zwangen. Man geht davon aus, dass zur Mitte des 5. Jhs. das Ende der Römerherrschaft in Schwaben besiegelt war.