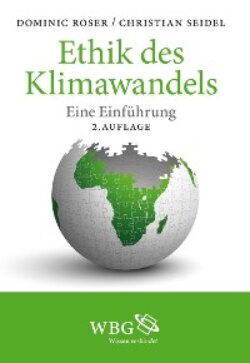Читать книгу Ethik des Klimawandels - Dominic Roser - Страница 10
Die ethischen Besonderheiten der Klimaproblematik
ОглавлениеDen moralischen Kompass zu erstellen, ist allerdings ebenfalls alles andere als einfach. Denn der Klimawandel weist einige Eigenheiten auf, die die Beantwortung der klimaethischen Leitfragen erschweren. Das sieht man an folgendem Beispiel:
Es ist Nacht. Sie sitzen auf Ihrem Fahrrad und um schneller nach Hause zu kommen, nehmen Sie eine Abkürzung, fahren querfeldein über den Acker eines benachbarten Bauern und schaden so seiner Ernte. War es falsch, die Abkürzung zu nehmen?
Andere Situation: Es ist Nacht und um schneller nach Hause zu kommen, nehmen Sie anstelle des Fahrrads das Auto. Dabei stoßen Sie CO2 aus; zusammen mit den Emissionen vieler anderer Menschen verändert dies langsam das Klima. Diese Veränderung führt nach Jahrzehnten zu Ernteeinbußen bei Bauern in fernen Entwicklungsländern. War es falsch, das Auto zu nehmen?
Auf die erste Frage antworten viele spontan mit „Ja“, auf die zweite Frage hingegen auch nach längerem Nachdenken mit einem „Tja“. Obwohl sich die beiden Situationen auf den ersten Blick sehr ähneln, sind wir uns unserer moralischen Urteile beim Klimawandel weniger sicher als in alltäglichen Situationen. Der Klimawandel scheint unser Gespür für richtig und falsch auf den Kopf zu stellen. Was aber ist in moralischer Hinsicht so besonders und verwirrend am Klimawandel?
Wenn man die beiden Situationen genauer vergleicht, kann man mehrere Unterschiede ausmachen. Der erste besteht darin, dass die Wirkung Ihrer Handlung beim Klimawandel sehr viel später eintritt als bei Ihrer Querfeldeinfahrt – möglicherweise leben Sie gar nicht mehr, wenn es zu den Ernteeinbußen für die Bauern in den Entwicklungsländern kommt. Das liegt daran, dass viele Treibhausgasemissionen zeitverzögert wirken: Der heute feststellbare Klimawandel geht zum großen Teil auf vergangene Emissionen zurück und die gegenwärtigen Emissionen entfalten ihre volle Wirkung erst in Jahrzehnten. Unsere heutigen Handlungen betreffen also nicht heute lebende, sondern vor allem zukünftige Menschen – unsere Kinder und Kindeskinder. Das macht den Klimawandel zu einem intergenerationellen Problem zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (vgl. Abb. 1). Das bedeutet insbesondere, dass die Vor- und Nachteile von klimaschädlichen Handlungen nicht von derselben Person getragen werden: Heute in die Ferien zu fliegen nützt uns, schadet aber unseren Nachkommen. Umgekehrt bedeutet Klimaschutz (in Form eines Flugverzichts) ein Opfer für uns, während er unseren Nachkommen (in Form ausbleibender Klimaschäden) nützt. Diese zeitliche Kluft zwischen Ursache und Wirkung macht den Klimawandel moralisch kompliziert, denn unsere Alltagsethik ist auf den zeitlichen Nahbereich ausgerichtet: Wenn wir Mord, Diebstahl oder eine Lüge moralisch bewerten, dann handelt es sich stets um Handlungen, bei denen die Wirkungen (eine Leiche, ein leeres Tresorfach, eine herbe Enttäuschung) mehr oder weniger direkt auf die Ursache folgen. Beim Klimawandel hingegen liegen Jahrzehnte und Jahrhunderte dazwischen.
Abbildung 1: Klimawandel als intergenerationelles Problem
Zweitens klaffen Ursache und Wirkung des Klimawandels nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich auseinander. Der Bauer im ersten Fall ist Ihr Nachbar. Die betroffenen Bauern im zweiten Fall hingegen sind Ihnen unbekannt und über den ganzen Globus verteilt. Der Klimawandel ist dabei in zwei Hinsichten ein globales Phänomen. Da sich Treibhausgase in der Atmosphäre verteilen, spielt es zum einen auf der Ursachenseite keine Rolle, wo auf der Welt die Emissionen anfallen. Ein Flug in Europa trägt genauso zum weltweiten Klimawandel bei wie der Fleischkonsum in Australien oder der Reisanbau in Indien. Zum anderen fallen auch die Wirkungen auf der ganzen Welt an, denn fast jede Region der Welt ist auf die eine oder andere Weise davon betroffen. Wie schon bei der zeitlichen Kluft, so bedeutet auch die räumliche Kluft zwischen Ursachen und Wirkungen, dass die Vor- und Nachteile klimaschädlicher Handlungen nicht denselben Personen zufallen: Wenn Sie ein Flugzeug nehmen, dann fallen Ihnen die Vorteile zu, während die damit verbundenen Nachteile von anderen getragen werden. Und wenn Sie umgekehrt auf die Flugreise verzichten, haben Sie einen Nachteil, während die Vorteile eines geschützten Klimas anderen zugutekommen. Diese räumliche Kluft macht den Klimawandel ebenfalls moralisch kompliziert, denn unsere Alltagsethik ist auf den räumlichen Nahbereich ausgerichtet. Das Wohlergehen von Menschen, die wir von Angesicht zu Angesicht kennen, berührt uns viel mehr als das Wohlergehen von Fremden, die in anderen Regionen der Welt leben; wir sprechen von „Nächstenliebe“, aber nicht von „Fernstenliebe“; sozialen Ausgleich gibt es vor allem innerhalb von Gemeinschaften statt zwischen Gemeinschaften.
Querfeldeinfahrt und Klimawandel unterscheiden sich aber nicht nur darin, dass die Ursachen und Wirkungen einmal nah beieinander liegen und einmal global verteilt sind; der wichtigste Aspekt dabei ist, dass Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels global ungleich verteilt sind. Wenn Sie mit dem Fahrrad über das Feld fahren, schadet die Handlung eines wohlhabenden Menschen einem anderen recht wohlhabenden Menschen. Die Bauern, deren Ernte durch die Emissionen Ihres Autos verringert wird, leben hingegen in den Entwicklungsländern und sind vergleichsweise arm. Von den Emissionen eines Bürgers aus einem reichen Industrieland sind also arme Bauern in den Entwicklungsländern betroffen. Das macht den Klimawandel zu einem Problem globaler Ungleichheiten. Zum einen haben die Menschen in den Industrieländern in der Vergangenheit pro Kopf mehr zum Klimawandel beigetragen als die Menschen in den Entwicklungsländern und sie tun dies auch heute noch. Im Jahr 2008 waren die Treibhausgasemissionen pro Kopf in reichen Länder rund viermal höher als im Rest der Welt (World Bank 2012b: 172). Zwar kann man nicht pauschal sagen, dass im Einzelfall jedes reiche Land höhere Pro-Kopf-Emissionen aufweist als jedes arme Land, weil einige Entwicklungs- und Schwellenländer (wie Malaysia, Indonesien oder Brasilien) durch Waldrodung auch stark zum Klimawandel beigetragen haben. Aber insgesamt liegen die Ursachen für den Klimawandel überproportional stark bei den Industrieländern mit ihren hohen Pro-Kopf-Emissionen. Zum anderen aber sind die Entwicklungsländer viel stärker von den gegenwärtigen und zukünftigen Klimaschäden betroffen: Sie sind stärker auf die Landwirtschaft angewiesen, die durch den Klimawandel empfindlich beeinträchtigt wird; viele Entwicklungsländer liegen zudem in klimatisch sensiblen Regionen wie dürre- oder überschwemmungsgefährdeten Gebieten, in denen der Klimawandel zusätzliche Probleme schafft; und schließlich sind die Entwicklungsländer ärmer und haben darum weniger Ressourcen, um sich erfolgreich an den Klimawandel anzupassen. Insgesamt entfallen die Klimaschäden also überproportional stark auf die Entwicklungsländer, während die verursachenden Emissionen überproportional stark bei den Industrieländern liegen. Es herrscht, mit anderen Worten, gleich eine doppelte globale Ungleichheit (vgl. Abb. 2).
Ein dritter Unterschied zwischen der Fahrt über den Acker und dem Klimawandel hat mit der Fragmentierung der Ursachen zu tun. Der Klimawandel wird durch viele kleine Alltagshandlungen hervorgerufen: Wir duschen heiß, fahren mit dem Auto, fliegen, essen ein Steak oder lassen das Licht brennen. Für sich genommen erscheinen diese Handlungen harmlos, denn wir können den Schaden, den z.B. eine heiße Morgendusche anrichtet, nicht unmittelbar sehen. Erst in der Summe führen viele Handlungen zu wahrnehmbaren Klimaschäden, aber einen direkten, unmittelbaren Zusammenhang zwischen einer einzelnen Handlung und einem konkreten Schaden gibt es beim Klimawandel nicht. Unser moralisches Gespür ist aber für Fälle gemacht, in denen der Schaden klar wahrnehmbar ist, eine dafür verantwortliche Person leicht identifiziert und die verursachende Handlung eindeutig benannt werden kann: Wenn Sie – noch dazu mit Absicht – über den Acker des Bauern fahren, dann ist der Schaden klar wahrnehmbar, die dafür verantwortliche Person leicht identifiziert und die verursachende Handlung ohne Problem zu nennen. Doch wie wäre es, wenn gleichzeitig mit Ihnen hunderttausend weitere Menschen über das Feld fahren? Soll man dann sagen, dass Sie nicht verantwortlich sind, weil Sie keinen Schaden anrichten, der nicht ohnehin entstanden wäre? Aber das könnte man ja von jedem sagen und so würde am Ende niemand als verantwortlich gelten. Soll man stattdessen besser sagen, dass Sie für ein Hunderttausendstel des Schadens verantwortlich sind? Fragen dieser Art bringen uns ins Grübeln, weil unsere Alltagsethik nicht für Probleme mit fragmentierten Ursachen wie den Klimawandel gemacht ist.
Abbildung 2: Klimawandel als Problem doppelter globaler Ungleichheit
Eine vierte Komplikation ergibt sich aus der Tatsache, dass unser Wissen über die Auswirkungen unserer Handlungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Um es ganz klar zu sagen: Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es heute keine Unsicherheit mehr darüber, dass der Klimawandel stattfindet und dass der Mensch hauptsächlich durch Treibhausgasemissionen dazu beigetragen hat. Auch wenn aus populären Darstellungen in den Medien leicht der Eindruck erwachsen kann, die Klimawissenschaft sei sich diesbezüglich gar nicht sicher oder in zwei gleich große Lager gespalten: Es gibt Studien, die die Frage des Konsenses in der Klimawissenschaft selbst wissenschaftlich untersucht haben und zum Ergebnis kommen, dass (a) 97 bis 98 Prozent der weltweit aktivsten publizierenden Klimawissenschaftler der Auffassung vom menschengemachten Klimawandel explizit zustimmen und dass (b) die klimawissenschaftliche Reputation derjenigen, die dieser Auffassung nicht zustimmen, signifikant schlechter ist (Anderegg u.a. 2010). So gesehen ist es ein Mythos, dass es hinsichtlich dieser klimawissenschaftlichen Resultate Uneinigkeit und Unsicherheit gebe. Die meisten Überlegungen, die einige Menschen zum Leugnen des Klimawandels verleitet haben, lassen sich relativ einfach ausräumen; ausgewogene und verständliche Widerlegungen finden sich in den Merkblättern des deutschen Umweltbundesamts und des ProClim-Forums der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (ProClim 2010; Umweltbundesamt 2004).
Auch wenn es keine Unsicherheit darüber gibt, dass der Klimawandel menschengemacht ist, gibt es doch erhebliche Unsicherheit darüber, wie viel Klimawandel wir genau verursachen werden. Die Spannbreite der geschätzten Temperaturerhöhung ohne zusätzliche Klimaschutzbemühungen beträgt bis zum Ende des 21. Jahrhunderts 2,5 bis 7,8 Grad (IPCC 2014). Und auch in diese Schätzungen fließen kontroverse Annahmen ein – es könnte auch mehr oder weniger werden. Das Klimasystem ist einfach sehr komplex und daher sind Aussagen über seine Entwicklung immer mit Unsicherheiten behaftet. Niemand ist sich dessen deutlicher bewusst als die Wissenschaftler selbst. Um sich größere Klarheit über den Stand der Klimawissenschaft zu verschaffen, wurde 1988 von UNO-Institutionen der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gegründet. Der IPCC betreibt weder Politik noch eigene Forschung; seine Aufgabe ist vielmehr, alle fünf bis sieben Jahre den Stand der Wissenschaft zu sichten, zusammenzufassen und einzuschätzen. In diesem Zusammenhang verwendet der IPCC auch große Mühe darauf, nicht bloß Schätzungen über klimawissenschaftliche Zusammenhänge abzugeben, sondern insbesondere in jüngerer Zeit an viele dieser Schätzungen ein „Etikett“ zu heften, das Aufschluss über das Ausmaß an Unsicherheit, die Einigkeit der Experten und die Qualität der Evidenzen bei den einzelnen Detailinformationen gibt.
Diese Art der Unsicherheit darüber, wie viel Klimawandel wir mit unseren Emissionen genau verursachen, ist für die Ethik sehr relevant. Denn wenn wir annehmen, dass wir angesichts des Klimawandels tatsächlich moralisch verpflichtet, bestimmte Auswirkungen – etwa einen Temperaturanstieg von mehr als zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter – zu verhindern, dann müssen wir unsere Emissionen senken. Doch wenn nun Unsicherheit darüber herrscht, welche Menge an Emissionen im Einzelnen welche Auswirkungen haben wird, dann gehen wir mit jeder Klimapolitik unvermeidlich auch ein gewisses Risiko ein: Denn dass Unsicherheit herrscht, heißt ja nichts anderes, als dass jede Emissionsmenge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch zu mehr als zwei Grad Erwärmung führen kann. Und das wirft die – ethische – Frage auf, wie hoch diese Wahrscheinlichkeit eigentlich aus moralischer Sicht noch sein darf, welches Risiko wir in Kauf nehmen dürfen. Die Klimawissenschaft kann in diesem Zusammenhang beispielsweise Aussagen der folgenden Art anstreben: „Wenn man die zwischen 2000 und 2050 global ausgestoßene Menge CO2 auf eine Billion Tonnen begrenzt, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine Erwärmung von mehr als zwei Grad 25 Prozent“ (vgl. Meinshausen u.a. 2009). Aus ethischer Sicht fragen wir uns dann: Ist dieses Risiko von 25 Prozent moralisch vertretbar? Die Frage, wozu wir angesichts des Klimawandels verpflichtet sind, wird damit gleich komplizierter, denn nun müssen wir nicht nur die erwarteten Folgen ethisch bewerten, sondern auch noch darüber nachdenken, wie man mit Risiken bezüglich dieser Folgen umgehen sollte und welche Risiken moralisch akzeptabel sind. Der Klimawandel ist darum auch ein Problem des Umgangs mit Unsicherheit. Und wiederum ist unsere vertraute Alltagsethik dafür nicht gemacht. Während es einigermaßen unstrittig ist, dass man nichts tun darf, was Unschuldige mit Sicherheit töten wird, ist es schon wesentlich schwieriger zu entscheiden, wie die Grenze zwischen erlaubten und verbotenen Handlungen zu ziehen ist, wenn die Handlung Unschuldige nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit töten wird. Wenn wir mit dem Auto zum Supermarkt fahren, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir andere Menschen in einem Verkehrsunfall töten; im Normalfall ist das ein akzeptables Risiko und es ist erlaubt, zum Supermarkt zu fahren. Wenn wir aber nachts übermüdet mit 120 km/h über eine unübersichtliche Landstraße fahren, dann ist das Risiko für einen Unfall, bei dem andere getötet werden, wesentlich erhöht. Ist das moralisch noch akzeptabel? Und wie wäre es, wenn man nicht nur übermüdet, sondern auch angetrunken ist und mit 180 km/h fährt? Wenn wir wissen wollen, welche Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Schaden – welches Risiko – gerade noch akzeptabel ist, dann helfen uns Regeln, die für den Fall gemacht sind, in dem wir so gut wie sicher wissen, was passiert, einfach nicht weiter. Doch der Klimawandel ist gerade solch ein Fall, in dem es auch um die Grenzen für akzeptable Risiken geht.
Es gibt also insgesamt vier Besonderheiten, die die ethische Auseinandersetzung mit dem Klimawandel verkomplizieren: Der Klimawandel ist ein Problem des Umgangs mit globalen Ungleichheiten und großen Unsicherheiten, dessen Ursachen fragmentiert sind und dessen Auswirkungen nachfolgende Generationen betreffen. Das ist alles andere als ein „normales“, uns aus dem Alltag vertrautes ethisches Problem. Und darum ist es nur zu verständlich, dass wir ins Grübeln kommen, wenn wir versuchen, uns auf den Klimawandel einen ethischen Reim zu machen. Eigentlich, so scheint es, bräuchten wir dafür nämlich eine Art „Ethik 2.0“. Doch wo soll dieses „neuartige“ ethische Nachdenken über den Klimawandel seinen Anfang nehmen, wie soll man vorgehen?