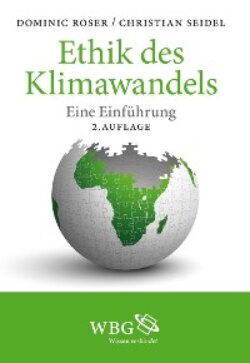Читать книгу Ethik des Klimawandels - Dominic Roser - Страница 8
Drei klimaethische Leitfragen
ОглавлениеWarum stellen sich in Bezug auf den Klimawandel überhaupt moralische Fragen? Ist er nicht einfach ein natürliches Phänomen wie das Kreisen des Mondes um die Erde? In Bezug auf andere natürliche Phänomene stellen wir uns schließlich auch keine moralischen Fragen – warum also sollte man das in Bezug auf den Klimawandel tun? Es ist zwar richtig, dass sich die wenigsten Menschen jemals gefragt haben, was sie oder die Politik in Bezug auf das Kreisen des Mondes um die Erde tun sollen. Das liegt daran, dass Menschen dabei ihre Finger nicht im Spiel haben: Weder haben Menschen die Bewegung des Mondes verursacht, noch können Menschen sie beeinflussen. Darum stellen sich beim Mond auch keine moralischen Fragen.
Beim Klimawandel liegt der Fall jedoch anders: Ein „natürliches“ Phänomen ist der Klimawandel nur insofern, als er „in der Natur“ stattfindet; anders als die Mondbewegung ist der Klimawandel zu einem substanziellen Teil menschengemacht und kann dementsprechend durch menschliches Handeln gestoppt, verlangsamt oder beschleunigt werden. Wie genau nimmt der Mensch Einfluss auf das Klima? Ganz knapp kann man das so erklären (für ausführlichere Einführungen vgl. Maslin 2004; Rahmstorf und Schellnhuber 2006): Unser Planet ist von der Atmosphäre umgeben, die wie eine Isolationsschicht wirkt; sie lässt die Strahlung der Sonne hinein, aber nicht in gleicher Weise wieder hinaus. Das ist der sogenannte „Treibhauseffekt“, der in natürlichem Maß das uns bisher bekannte Klima und Temperaturniveau auf der Erde ermöglicht. Allerdings hängt der Treibhauseffekt von der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ab. Steigt die Konzentration wird weniger Strahlung in den Weltraum zurückgegeben und folglich wird es im Treibhaus Erde wärmer. Die wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4). Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre hat im Laufe der Erdgeschichte schon immer geschwankt; aber mit der Industrialisierung haben die Menschen begonnen, in enormem Ausmaß fossile Energieträger (Kohle, Erdöl und Erdgas) zu verbrennen und Wälder zum Zweck der Besiedlung oder der landwirtschaftlichen Nutzung abzuholzen. Reisanbau, Autos, Flugzeuge, mit Öl oder Gas betriebene Heizungen, Zement- und Stahlherstellung und Kohlekraftwerke für die industrielle Produktion haben zwar zu großem Wohlstand beigetragen; damit hat die Menschheit aber auch die atmosphärische Konzentration von Treibhausgasen gleich auf zwei Weisen erhöht: Zum einen werden beim Verbrennen fossiler Energieträger viele Treibhausgase frei, zum anderen dienen Wälder als natürliche CO2-Speicher – weniger Wälder bedeuten also mehr frei in der Atmosphäre verbleibendes CO2. Infolgedessen ist die Konzentration von CO2 seit Beginn der Industrialisierung von 280 ppm (parts per million) um über 35 % gestiegen. Das liegt weit außerhalb der natürlichen Bandbreite in den letzten 650.000 Jahren. Die Emissionen sind in den letzten Jahrzehnten fortwährend angestiegen, weil es immer mehr Menschen gibt, die zudem immer wohlhabender werden und somit zusammen immer mehr emittieren. Die bekannteste Folge davon ist ein Temperaturanstieg. Und der Trend geht weiter: Wenn keine zusätzlichen Anstrengungen zur Emissionsreduktion unternommen werden, dann wird für das Jahr 2100 eine Erwärmung zwischen 2,5 und 7,8 Grad gegenüber der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erwartet (IPCC 2014).
Der Klimawandel und das Kreisen des Mondes um die Erde unterscheiden sich jedoch nicht nur in der Rolle des Menschen auf der Ursachenseite, sondern auch in ihren Wirkungen auf den Menschen. Der Mond beeinflusst vielleicht Schlafwandler und – über die Gezeiten – auch Fischer. Der Klimawandel hingegen hat viel weiter reichende Auswirkungen auf unser Leben. Wenn es wärmer wird, schmelzen die Gletscher, die wie Wasserspeicher für den Sommer funktionieren; ihr Schmelzwasser landet in Flüssen, die die Menschen mit Wasser versorgen. Ohne Gletscher gibt es im Sommer weniger Wasser für die Landwirtschaft, die Energieproduktion und den täglichen Gebrauch. Bei höheren Temperaturen schmilzt das Eis an den Polkappen und das Wasser in den Weltmeeren dehnt sich aus; aufgrund des folgenden Meeresspiegelanstiegs schwinden die Landmassen und versalzt das Grundwasser in Küstennähe, wo ein beträchtlicher Teil der Menschheit lebt. Meeresströmungen und Niederschlagsmuster verändern sich; die in der Folge verstärkt auftretenden Extremwetterereignisse wie Wirbelstürme, Überschwemmungen und Dürren werden Menschen obdach- und besitzlos machen und Hungersnöte vergrößern, weil die Ernteerträge sinken. Geringere Ernteerträge sind gleichbedeutend mit Migration, weniger (und weniger gutes) Wasser ist gleichbedeutend mit mehr Konflikten. Alte und schwache Menschen werden unter häufigeren Hitzewellen leiden und daran sterben. Mehr Menschen werden von tropischen Krankheiten betroffen sein, weil die übertragenden Insekten bei einem wärmeren Klima in neuen Regionen ansässig werden können.
Wenn man die Lage so betrachtet, ist es eigentlich offenkundig, dass der Klimawandel moralische Fragen aufwirft. Denn einige der zu erwartenden Auswirkungen wie Not, Hunger, Tod und Leid erzeugen offensichtlich einen Handlungsbedarf, und der scheint darin zu bestehen, sein Möglichstes zu tun, um den Klimawandel zu vermeiden: Wir sollten, so scheint es, die Treibhausgasemissionen reduzieren und die natürlichen Senken für Treibhausgase (wie Wälder) erhalten und ausbauen. Anders gesagt: Wir haben eine moralische Pflicht zum Klimaschutz.
Manchen geht diese Schlussfolgerung allerdings zu schnell. Man könnte zu bedenken geben, dass die Wissenschaft vielleicht falsch liegt und es gar keinen Klimawandel geben wird oder dass er auch positive Seiten haben wird, die die negativen überwiegen. Man könnte auch der Auffassung sein, dass der Klimawandel ferne Zukunftsmusik ist und keinen gegenwärtig lebenden Menschen betrifft und dass man gegenüber Menschen, die nicht existieren, auch zu nichts verpflichtet sein kann. Es ist also genauer zu prüfen, ob wir angesichts des Klimawandels überhaupt zu etwas verpflichtet sind. Das ist die erste grundlegende moralische Frage zum Klimawandel. Wir werden sie in Teil I diskutieren.
Einmal angenommen, die Antwort auf diese erste Frage fiele positiv aus: Wir müssen Klimaschutz leisten. Nun ist Klimaschutz nicht ein Entweder-Oder, sondern eine graduelle Angelegenheit: Man kann das Klima mehr oder weniger schützen. Selbst wenn also feststeht, dass man angesichts des Klimawandels etwas tun muss, so wäre es immer noch eine offene Frage, wie viel man tun muss: In welchem Ausmaß müssen wir das Klima schützen? Wie umfangreich müssen unsere Bemühungen sein? Diese zweite grundlegende moralische Frage zum Klimawandel diskutieren wir in Teil II. Sie führt zu einer weiteren Frage: Denn selbst wenn wir wissen, wie viel Klimaschutz wir leisten müssen, so ist noch nichts darüber gesagt, wie man das zu erbringende Maß an Klimaschutz auf verschiedene Schultern verteilen muss. Wer muss im Einzelnen genau was tun? Welches Land muss welchen Beitrag leisten und welche Lasten tragen? Das ist die dritte grundlegende moralische Frage zum Klimawandel und sie ist Gegenstand von Teil III.