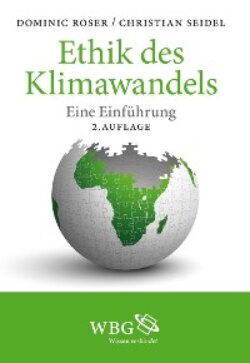Читать книгу Ethik des Klimawandels - Dominic Roser - Страница 11
Wie beginnen?
ОглавлениеManchmal hört das ethische Nachdenken schon auf, bevor es so richtig begonnen hat. Bisweilen werden moralische Fragen nämlich mit dem Hinweis beiseitegeschoben, dass es keine objektiven Antworten auf solche Fragen gebe: Letztlich sei das eine subjektive Angelegenheit, jeder habe seine eigene Meinung dazu und damit sei es gut. Lohnt es sich also überhaupt, über Antworten auf die klimaethischen Leitfragen nachzudenken?
Ja. Denn oft gehen wir mit moralischen Fragen so um, als könne jemand recht und der andere unrecht haben. Wenn Ihr Nachbar beim Abendessen verkündet, es sei aus moralischer Perspektive ganz in Ordnung gewesen, die Kolonien auszubeuten, dann würden Sie wohl kaum sagen „Gut, das ist deine Meinung, ich sehe das zwar anders, aber was soll’s. Lass uns nicht streiten.“ Im Gegenteil: Sie würden eher sagen, Ihr Nachbar habe Unrecht, liege falsch oder sei im Irrtum. Sie werden mit Ihrem Nachbarn diskutieren und versuchen, ihn mit Argumenten vom Gegenteil zu überzeugen. Darin unterscheiden sich Antworten auf moralische Fragen von Geschmacksurteilen wie „Mir gefällt das blaue Hemd“ – hier widerspricht man nicht, fängt keinen Streit an, versucht nicht zu überzeugen und spricht nicht von Unrecht oder Irrtum.
Der Verweis auf den vermeintlich subjektiven Charakter ethischen Nachdenkens ist manchmal eher eine Ausrede, wenn es schwierig wird. Und zugegeben: Schwierig sind ethische Fragen nur zu oft. Aber das gilt auch für andere Fragen. Es ist z.B. auch schwierig zu beantworten, ob 131.071 eine Primzahl ist. Dennoch käme niemand auf die Idee, daraus zu schließen, dass es keine objektive Antwort auf diese Frage gebe. Entscheidend ist, dass ethische Fragen oft eine klare Antwort haben: Darf man jemanden kaltblütig ermorden? Ist es falsch, eine Katze anzuzünden? Oder eben: Ist es falsch, mit dem Fahrrad über den Acker des Bauern zu fahren? Auch das sind moralische Fragen, doch ihre Beantwortung fällt uns nicht schwer.
Aber werden moralische Fragen – man denke nur an kontroverse Themen wie Sterbehilfe – nicht oft auf verschiedene Weise und noch dazu mit verschiedenen Begründungen beantwortet? Wie soll inmitten großer Uneinigkeit und widerstreitender Meinungen eine objektive Antwort möglich sein? Richtig ist, dass in vielen moralischen Fragen mehrere Antworten vertreten und begründet werden. Aber das heißt nicht, dass alle vorgebrachten Antworten und Begründungen gleich gut sind. Ebenso wie in anderen Bereichen gibt es auch in der Ethik gute und weniger gute Argumente, überzeugende und weniger überzeugende Begründungen. Und genau darum geht es in der Ethik: Mittels begrifflicher Unterscheidungen und vor allem mit Argumenten werden gut begründete von schlecht begründeten Antworten auf moralische Fragen unterschieden. Ethik zu betreiben heißt sich zu fragen, was für und gegen einzelne Antworten auf moralische Fragen spricht und aufzudecken, wo eine Position schlecht gestützt ist oder wo sich aus ihr Folgerungen ergeben, die anderen zentralen moralischen Überzeugungen widersprechen. Beim ethischen Nachdenken über den Klimawandel geht es also darum, mit Argumenten bestimmte Antworten auf die klimaethischen Leitfragen zu begründen und zu prüfen. Und das klingt doch nach einer recht „objektiven“ Angelegenheit.
Doch von welchen Argumenten und Begründungen ist hier die Rede? Worauf berufen wir uns in moralischen Diskussionen, von welcher Basis gehen wir aus? Eine argumentative Ressource, auf die sich viele Menschen berufen, ist der Verweis auf das Eigeninteresse. Tatsächlich wird das Eigeninteresse beim Aufruf zum Klimaschutz nicht selten bemüht: Die Schäden des Klimawandels seien sehr hoch, die Kosten zu ihrer Vermeidung verhältnismäßig gering; wer rechne, der reduziere die Emissionen, denn das liege im eigenen Interesse. Doch dieser Bezug auf das Eigeninteresse hat einen Haken: Er verkennt den intergenerationellen und globalen Charakter des Klimawandels. Wenn wir heute Emissionen reduzieren, dann profitieren nicht wir, sondern vor allem zukünftige Menschen rund um den Globus davon. Der Verweis auf das Eigeninteresse ist also insofern irreführend, als es gar nicht um eine Aufrechnung von Aufwand und Ertrag im eigenen Interesse geht, sondern viel eher um einen Ausgleich zwischen den Interessen aller heute und künftig lebenden Menschen. Nicht unser eigenes Wohl, unsere eigenen Interessen und Belange, sondern das Wohl, die Interessen und Belange aller Menschen bilden also die argumentative Ressource für die Beantwortung der klimaethischen Leitfragen.
Es gäbe noch eine weitere argumentative Ressource. Statt das Wohl der Menschen zum alleinigen argumentativen Bezugspunkt zu machen, könnten wir auch das Wohl der Tiere einschließen. Denn auch die Tierwelt wird vom Klimawandel stark betroffen sein: Als empfindungsfähige Wesen leiden Tiere natürlich auch unter klimatischen Stressfaktoren wie Extremwetterereignissen. Da sich die Lebensräume und Rückzugsgebiete durch den Klimawandel schneller verändern werden als sich die meisten Tierarten anpassen können, ist zudem mit einem massiven Artensterben zu rechnen: Von Eisbären, die bei schwindendem Packeis am Nordpol ertrinken, hat man vielleicht bereits gehört; viele Meerestiere werden aber aufgrund der Veränderungen in den Ozeanen (etwa Versauerung) ebenfalls aussterben; und wenn Eidechsen sich bei höheren Temperaturen länger am Tag aus der Sonne zurückziehen müssen, können sie nicht nach Futter suchen und sterben schneller – was über die Nahrungskette wiederum Auswirkungen auf Vogelarten hat. All dies gibt uns eigentlich zusätzliche Gründe, etwas gegen den Klimawandel zu tun.
Man könnte noch einen Schritt weiter gehen und auch Pflanzen, die unbelebte Natur oder ganze Ökosysteme einschließen. Eine solche sogenannte „ökozentrische“ Auffassung werden wir weitestgehend ausklammern. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist sie begründungslastiger als eine „anthropozentrische“, auf Wohl und Belange des Menschen ausgerichtete Argumentation oder auch der Einbezug der Tiere. Dass das Wohl von Menschen und Tieren zählt, ist kaum zu bestreiten; aber zählt der Verlust von Pflanzenvielfalt oder das Verschwinden von Gletschern auch für sich genommen – also auch dann, wenn es keinen Menschen gäbe, der davon in irgendeiner Weise betroffen wäre? Das ist bereits strittiger. Zum anderen ist ein Rückgriff auf eine ökozentrische Argumentationsstrategie gar nicht nötig, weil sie (abgesehen von zwei Stellen in Kapitel 4 und 18, an denen wir noch einmal kurz darauf verweisen) im Ergebnis keinen großen Unterschied macht. Denn wenn man zeigen kann, dass sich eine moralische Pflicht zum Klimaschutz bereits durch den alleinigen und weniger strittigen Bezug auf Wohl und Belange des Menschen (und der Tiere) rechtfertigen lässt, dann hat man schon eine Menge gewonnen, und der moralische Status der Pflanzen oder der unbelebten Natur muss einen im Hinblick auf unsere Klimaschutzpflichten nicht weiter beschäftigen. Ob man dies zeigen kann, wollen wir nun prüfen. Wenden wir uns also der ersten klimaethischen Leitfrage zu.