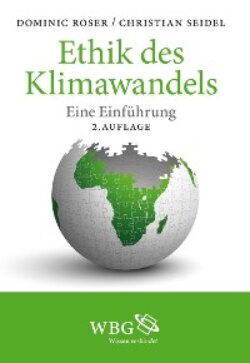Читать книгу Ethik des Klimawandels - Dominic Roser - Страница 15
Ist der Klimawandel überhaupt ein moralisches Problem, auf das man reagieren muss?
ОглавлениеMit welchen Argumenten könnte man die Grundlage einer Klimaschutzpflicht überhaupt in Zweifel ziehen? Stellen Sie sich dazu zunächst einen anderen Fall vor: Ihr Nachbar klopft wutentbrannt an Ihre Tür und behauptet, Ihre Tochter sei gerade dabei, sein Gemüsebeet zu verwüsten. Er fordert Sie auf, dringend etwas dagegen zu unternehmen. Ganz offenbar sieht der Nachbar Sie in der Pflicht, Ihre Tochter vom Verwüsten des Beets abzuhalten. Was könnten Sie ihm entgegnen, wenn Sie die Grundlage dieser Pflicht – den Sachverhalt, dass Ihre Tochter im Begriff ist, das Gemüsebeet des Nachbarn zu verwüsten – leugnen wollen?
Ihnen stehen mindestens vier verschiedene Wege offen. Erstens könnte es sein, dass Ihre Tochter viel zu klein ist, um den befürchteten Schaden anzurichten, oder dass der Nachbar ein wenig verwirrt ist und vergessen hat, dass er gar kein Gemüsebeet mehr besitzt; also gibt es den drohenden Schaden, zu dessen Verhinderung Ihr Nachbar Sie auffordert, gar nicht, und folglich unterstehen Sie auch keiner Gemüsebeet-Schutzpflicht. Nehmen wir aber an, Ihre Tochter wäre durchaus dazu in der Lage, den befürchteten Schaden anzurichten und der Nachbar hat auch ein Gemüsebeet, in dem auch tatsächlich gerade jemand wütet. Dann könnte es zweitens möglich sein, dass dieser Jemand gar nicht Ihre Tochter ist und Sie könnten dem Nachbarn entgegnen, dass er Ihre Tochter mit einem Wildschwein verwechselt hat; und da es gar nicht Ihr Kind ist, das gerade dabei ist, sein Gemüsebeet zu verwüsten, unterstehen Sie auch keiner Pflicht. Nehmen wir nun an, es ist doch Ihre Tochter, die da im Gemüsebeet herumstöbert. Dann könnten Sie dem Nachbarn drittens entgegen halten, dass Ihre Tochter vielleicht gar keinen Schaden anrichtet oder dass sie zwar einige Salatblätter zertritt, dass sie mit ihrem Spiel im Gemüsebeet aber auch den Boden umpflügt und Schnecken einsammelt und dem Nachbarn damit einen Teil der Gartenarbeit abnimmt, die er eigentlich noch verrichten müsste. Ihre Tochter, so könnten Sie sagen, macht doch auch etwas Gutes und das überwiegt das Schlechte. Also sollte man sie ungestört spielen lassen und wiederum stehen Sie nicht in der Pflicht, Ihre Tochter davon abzuhalten. Nehmen wir nun aber an, Ihre Tochter richtet tatsächlich Schaden an und dieser Schaden ist auch tatsächlich größer als der Nutzen, den ihr Herumtollen stiftet. Dann könnten Sie dem Nachbarn viertens erwidern, dass es ohnehin schon zu spät sei. Die Pflicht, Ihre Tochter von der Verwüstung des Gartens abzuhalten, haben Sie dann nicht mehr, weil Sie sie davon gar nicht mehr abhalten können – der Schaden ist ja bereits angerichtet. Das heißt natürlich nicht, dass Sie nicht andere Pflichten haben könnten, etwa die Pflicht, für den Schaden aufzukommen oder als Entschuldigung einen Kuchen zu backen; aber eine Gemüsebeet-Schutzpflicht haben Sie nicht mehr. Wieder sind Sie, was die Gemüsebeet-Schutzpflicht angeht, aus dem Schneider.
Kommen wir zurück zum ernsteren Thema des Klimawandels. Wer die Grundlage einer allgemeinen Pflicht zum Klimaschutz leugnen will, kann nun ganz ähnlich argumentieren: Erstens könnte man behaupten, dass es gar keinen Klimawandel gebe oder geben werde – so wie Sie zuvor behauptet hatten, es gebe gar keinen Schaden am Gemüsebeet, weil der Nachbar gar kein Gemüsebeet hat oder ihre Tochter noch zu klein ist. Zweitens könnte man behaupten, dass der Klimawandel zwar stattfinden werde, dass daran aber nicht der Mensch Schuld hat, sondern dass er ein natürlicher Lauf der Welt sei – so wie Sie zuvor behaupteten, dass nicht Ihre Tochter, sondern ein Wildschwein schuld sei. Drittens könnte man behaupten, dass der Klimawandel zwar stattfinden werde und auch vom Menschen verursacht sei, dass er aber gar nichts Negatives mit sich bringe oder dass er nicht ausschließlich negative, sondern auch positive Auswirkungen haben werde und dass sich das in etwa aufhebe – so wie Sie zuvor behaupteten, die Wohltaten Ihrer herumtollenden Tochter würden keinen Schaden anrichten oder den angerichteten Schaden überwiegen. Und viertens könnte man behaupten, dass es ohnehin schon zu spät sei, um den Klimawandel zu verhindern oder rückgängig zu machen – so wie Sie zuvor behaupteten, dass der Schaden bereits angerichtet und das Beet nicht mehr zu retten sei. Wenn nur eine oder mehrere dieser Überlegungen im Fall des Klimawandels zuträfen, so würde es keine grundsätzliche Pflicht zum Klimaschutz geben können – ganz so, wie zuvor auch die Gemüsebeet-Schutzpflicht erlosch, wenn eine Ihrer Behauptungen wahr wäre. Doch treffen die angeführten Überlegungen zu?
Mit der ersten Überlegung leugnet man, dass der Klimawandel ein moralisches Problem darstellt, indem man leugnet, dass der Klimawandel überhaupt stattfindet. Wir haben bereits im vorangegangenen Kapitel darauf aufmerksam gemacht, dass sich dieses Leugnen des Klimawandels nicht halten lässt: Zwar gibt es durchaus Unsicherheiten in Bezug auf das genaue Ausmaß der globalen Klimaerwärmung; gesichert ist hingegen die Erkenntnis, dass es zu einer globalen Erwärmung kommt (tatsächlich hat sie bereits begonnen). Auch die bisweilen anzutreffende Behauptung, die Sorge um den Klimawandel sei politisch motiviert und die Arbeit der Klimaforscher sei von eigenen Interessen nach Aufmerksamkeit und Forschungsgeldern geleitet, lässt sich nicht aufrecht erhalten. Es ist einfach nicht sehr glaubhaft, dass 97 bis 98 Prozent der – unabhängig voneinander forschenden – Klimawissenschaftler ihre Ergebnisse so manipuliert haben, dass sie ihren je eigenen und unterschiedlichen Interessen dienen und trotzdem auf dasselbe hinauslaufen.
Ganz ähnlich kann man auch den zweiten Grund für das Leugnen der Grundlage der Klimaschutzpflicht ausräumen: Wer behauptet, wir hätten keine Pflicht zum Klimaschutz, weil der stattfindende Klimawandel gar nicht von uns Menschen verursacht werde, sondern ein natürlicher Lauf der Welt sei, der behauptet etwas, was einfach nicht dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entspricht. Denn darüber, dass der eingetretene und anstehende Klimawandel zu einem großen Teil menschengemacht („anthropogen“) ist, besteht keine Unsicherheit mehr. Alle natürlichen klimaerwärmenden Einflüsse reichen zusammengenommen nicht aus, um den beobachteten Anstieg der globalen Temperatur zu erklären; erst wenn man den Einfluss der menschlichen Aktivitäten mit berücksichtigt, kann man erklären, was man beobachtet. Auch die zweite Überlegung stellt somit keinen triftigen Grund dar zu leugnen, dass der Klimawandel ein moralisches Problem ist.
Wie steht es um den dritten Grund – der Behauptung, der Klimawandel bringe gar nichts moralisch Schlechtes mit sich oder er bringe zwar etwas Schlechtes, aber auch einiges Gutes mit sich, das das Schlechte aufhebe? Hier muss man zwei Fälle unterscheiden: Wer erstens behauptet, der Klimawandel habe gar keine moralisch bedenklichen Folgen, der kennt entweder die wissenschaftlichen Fakten nicht oder trifft ein falsches moralisches Urteil über die moralische Bedeutung dieser Fakten. Denn die prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels lassen keinen Zweifel daran, dass zumindest einige Auswirkungen moralisch problematisch sind: Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben, Dürre und Wassermangel schüren Kriege und verstärken Hunger, tropische Krankheiten werden auch in einst gemäßigten Klimazonen Einzug halten und Extremwetterereignisse führen zu Obdach- und Besitzlosigkeit. Wer glaubt, dass es nicht zu diesen Konsequenzen kommen wird, der kennt die Fakten nicht. Und wer die Fakten kennt, aber glaubt, das sei nicht weiter schlimm, der hat eine falsche (und bedenkliche) moralische Auffassung. Denn üblicherweise halten wir Vertreibung, Krieg, Hunger, Krankheit, Tod, Obdach- und Besitzlosigkeit für moralisch schlecht. Man muss also schon zugestehen, dass zumindest einiges am Klimawandel moralisch schlecht ist. Wer dies zugesteht, aber zweitens behauptet, der Klimawandel habe auch etwas Gutes, das das Schlechte aufhebe, der hat in einer Hinsicht recht und in einer anderen Hinsicht unrecht. Richtig ist, dass der Klimawandel auch einige positive Auswirkungen haben wird; beispielsweise wird man in Norwegen Wein anbauen können, vormals unwirtliche Steppen in Russland können landwirtschaftlich genutzt werden und der Absatz von Eiscreme wird sich vermutlich erhöhen. Falsch ist allerdings, dass diese Vorteile die Nachteile aufwiegen oder gar überwiegen. Denn wer wirklich ernsthaft behauptet, die Erschließung neuer Anbaugebiete oder erhöhter Eiscremekonsum würden Hunger, Tod und Krankheit aufwiegen, der sieht die Sache moralisch offenbar falsch: Die negative Seite wiegt moralisch gesehen ungleich schwerer als die positive Seite. Und selbst wenn es anders wäre: Manchmal muss man auch dann etwas Schlechtes vermeiden, wenn man damit etwas Gutes tun könnte, das das Schlechte überwiegt. Wenn ein Arzt fünf Menschen das Leben retten könnte, indem er einen Passanten von der Straße betäuben, ihm Herz, Lunge, Leber sowie beide Nieren entnehmen und diese Organe fünf kranken Menschen verpflanzen würde, so scheint das Gute (fünf Leben gerettet) das Schlechte (ein Leben geopfert) zu überwiegen – und dennoch sollte es der Arzt, moralisch gesehen, nicht tun. Auch wenn also das Gute das Schlechte überwiegen würde, ist es dennoch möglich, dass man das Schlechte vermeiden muss. Im Fall des Klimawandels heißt das: Selbst wenn die „Nettobilanz“ des Klimawandels positiv ausfiele, so hebt das die Pflicht, das Klima zu schützen (also: das Schlechte zu vermeiden), nicht unbedingt auf. Auch das dritte Argument dafür, es gebe keine Grundlage für eine Klimaschutzpflicht, überzeugt also nicht.
Kommen wir zur vierten Überlegung: Kann man um die Klimaschutzpflicht herumkommen, indem man darauf verweist, dass es bereits zu spät ist und sich der Klimawandel nicht mehr aufhalten lässt? Zwar trifft es zu, dass die klimaerwärmende Wirkung von Treibhausgasen erst zeitverzögert eintritt; wir müssten also selbst dann noch mit einem gewissen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur rechnen, wenn die gesamte Menschheit von heute auf morgen aufhörte, Treibhausgase zu emittieren. Aber der Einwand verkennt, dass es bei der Klimaschutzpflicht nicht darum geht, jeglichen Klimawandel zu vermeiden, sondern nur darum, einen gefährlichen oder moralisch problematischen Klimawandel zu vermeiden. Welches Maß an Klimawandel gefährlich und ungefährlich ist, ist selbst eine ethische Frage und sie hängt eng zusammen mit der zweiten klimaethischen Leitfrage, auf die wir in Teil II genauer eingehen. An dieser Stelle ist es nur wichtig zu sehen, dass es durchaus noch möglich ist, den gefährlichen Klimawandel – der z.B. einer Erwärmung von mehr als zwei Grad entsprechen könnte – zu vermeiden. Zugegebenermaßen wird das Zeitfenster dafür zunehmend kleiner, aber immerhin gibt es nach Einschätzung der beteiligten Klimaforscher noch ein solches Zeitfenster (Meinshausen u.a. 2009, Knutti und Rogelj i. E.). Es trifft also einfach nicht zu, dass es bereits zu spät ist, um den gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. Und selbst wenn dies einmal nicht mehr möglich sein sollte, so könnte man den gefährlichen Klimawandel immer noch begrenzen: Weil mehr Emissionen auch eine größere Temperaturerhöhung (und damit mehr Schäden) zur Folge haben, haben weniger Emissionen auch eine geringere Temperaturerhöhung (und damit weniger Schäden) zur Folge – das gilt selbst dann, wenn das Schadensausmaß die moralisch zulässige Grenze überschreitet. Indem man die Treibhausgasemissionen reduziert, würde man in diesem Fall zwar nicht alle moralisch problematischen Schäden verhindern, aber man würde den Schaden doch so klein wie möglich halten. Auch das vierte Argument entkräftet also die Pflicht zum Klimaschutz letztlich nicht.
Es ist somit schwer zu leugnen, dass der Klimawandel überhaupt ein moralisches Problem darstellt und dass etwas dagegen getan werden muss. Dennoch gibt es immer wieder Personen, die eben dies tun. Insbesondere für diejenigen, die in den Medien oder im Politikbetrieb mit solchen Fällen konfrontiert sind, stellen sich dabei moralische Anschlussfragen: Darf man eigentlich leugnen, dass der Klimawandel ein moralisches Problem ist? Und darf man Menschen, die genau das tun, eigentlich Aufmerksamkeit schenken?