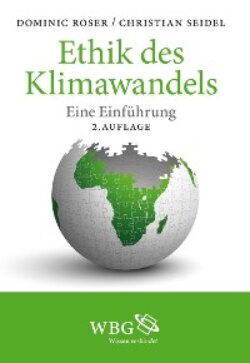Читать книгу Ethik des Klimawandels - Dominic Roser - Страница 18
3 Grundsätzliche Zweifel an unserer Zukunftsverantwortung
ОглавлениеDie zweite Art, die Pflicht zum Klimaschutz zu leugnen, bestreitet nicht, dass der Klimawandel ein moralisches Problem darstellt und dass etwas dagegen getan werden muss. Sie bezweifelt allerdings, dass wir – die heute lebenden Menschen – es sind, die etwas dagegen tun müssen. Dieser Zweifel beruht auf einem viel grundsätzlicheren Zweifel daran, dass man zukünftigen Menschen überhaupt etwas moralisch schulden kann. Vielleicht haben Sie schon einmal erlebt, dass jemand in einer Diskussion über Weltarmut gesagt hat: „Das ist ja alles schlimm mit den armen und hungernden Kindern in Afrika; aber mal ganz ehrlich: Was habe ich damit zu tun? Was gehen mich diese Menschen in der Ferne an?“ So wie hier geleugnet wird, dass es Pflichten über räumliche Distanzen hinweg gibt, kann man auch leugnen, dass es Pflichten über zeitliche Distanzen hinweg gibt – also Pflichten zwischen verschiedenen Generationen: „Das ist ja alles schlimm für die Menschen in hundert Jahren; aber mal ganz ehrlich: Was habe ich damit zu tun? Was gehen mich diese Menschen in der fernen Zukunft an?“
An diesem Bedenken ist zunächst einmal etwas dran. Schließlich ist Klimaschutz ja tatsächlich ein intergenerationelles Problem (s. Kap. 1): Er kommt vor allem zukünftigen Generationen zu Gute. Denn jede Tonne CO2, die wir heute einsparen, wird vor allem das zukünftige Klima schützen. Insofern kann man Klimaschutz als etwas ansehen, das wir für zukünftige Generationen tun. Wieso – so könnte man fragen – sollen wir gegenüber den Menschen der Zukunft, die wir nicht kennen und mit denen wir nie etwas zu tun haben werden, eigentlich moralisch verpflichtet sein? Sie können uns niemals eine Gegenleistung erbringen, wenn wir für sie sorgen. Wenn wir zukünftigen Generationen tatsächlich gar nichts schulden würden, dann scheint es in Bezug auf den Klimawandel für uns auch keinen moralischen Handlungsbedarf mehr zu geben: Wir müssen also nichts tun.
Doch haben diese Stimmen recht damit, dass wir zukünftigen Generationen rein gar nichts schulden können? Ein erster Blick auf unsere Alltagsmoral lässt das zweifelhaft erscheinen: Das Rentensystem mancher entwickelter Sozialstaaten wie Deutschland oder der Schweiz beruht auf der Idee einer generationenübergreifenden Solidargemeinschaft; wir sind offenbar der Auffassung, dass es moralisch richtig ist, wenn nicht jede Generation ihre eigene Altersvorsorge erwirtschaftet und zurücklegt, sondern wenn der jüngere, arbeitende Teil der Bevölkerung Zahlungen an den älteren, nicht mehr arbeitenden Teil der Bevölkerung erbringt – und damit ein Anrecht erwirbt, in Zukunft, wenn er selbst zum älteren Teil der Bevölkerung geworden ist, von dem dann jüngeren Teil finanziert zu werden. Das ist mit der Idee des Generationenvertrags gemeint: Die heutige Generation erbringt eine Pflicht, die sich aus dem Recht einer früheren Generation ergibt, und damit erwirbt die heutige Generation zugleich ein Recht, zu dessen Gewährleistung die zukünftige Generation verpflichtet ist. Wenn heutige Generationen gegenüber zukünftigen Generationen aber Rechte haben können, wieso sollten sie dann nicht im Prinzip auch Pflichten haben können? Der Zweifel an der grundsätzlichen Möglichkeit von Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen scheint also nicht so leicht in Einklang zu bringen zu sein mit unserer Alltagsmoral. Die Vertreter dieser Variante müssen deshalb Argumente vorbringen, um uns davon zu überzeugen, dass wir entgegen unserem ersten Eindruck tatsächlich keine Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen haben können. In der klimaethischen Diskussion spielen dabei vor allem drei Argumente eine Rolle, die wir in diesem Kapitel nacheinander genauer prüfen möchten.