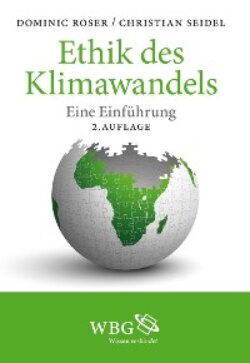Читать книгу Ethik des Klimawandels - Dominic Roser - Страница 9
Die Rolle der Ethik zwischen Naturwissenschaft und Politik
ОглавлениеIm Zentrum der ethischen Auseinandersetzung mit dem Klimawandel – und im Zentrum dieses Buches – stehen also drei grundlegende Fragen:
Die drei klimaethischen Leitfragen
1. Sind wir aufgrund des Klimawandels überhaupt zu etwas verpflichtet?
2. Falls wir zu etwas verpflichtet sind: Zu wie viel sind wir verpflichtet?
3. Wie sind diese Pflichten zu verteilen?
Bei diesen Fragen handelt es sich, wie bereits gesagt, um moralische Fragen. Für ihre Beantwortung ist nicht die Naturwissenschaft zuständig. Denn die Naturwissenschaft kann uns nur darüber Auskunft geben, wie die Welt ist. Doch aus Aussagen darüber, wie die Welt ist, folgt niemals etwas darüber, wie die Welt sein soll. Die Naturwissenschaft kann folglich nur Aussagen wie beispielsweise die folgende treffen (vgl. IPCC 2014): „Wenn wir die atmosphärische Treibhausgaskonzentration bis 2100 unter 450 ppm CO2e halten, dann vermeiden wir wahrscheinlich im 21. Jahrhundert eine Erwärmung von mehr als 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter.“ (Dabei steht „CO2e“ für „CO2 equivalent“; das ist eine Einheit, mit der die unterschiedlichen Klimawirkungen verschiedener Treibhausgase verglichen werden können). Aber die Frage, ob wir eine Erwärmung um mehr als 2 Grad vermeiden sollen, kann uns die Naturwissenschaft nicht beantworten. Solche Fragen – moralische Fragen – sind stattdessen Gegenstand der Ethik. Darum kann man die drei oben genannten grundsätzlichen moralischen Fragen zum Klimawandel auch als die drei klimaethischen Leitfragen bezeichnen.
Dass die drei klimaethischen Leitfragen nicht von der Naturwissenschaft beantwortet werden, heißt natürlich nicht, dass naturwissenschaftliche Erkenntnisse für ihre Beantwortung irrelevant sind – im Gegenteil: In der Ethik geht es darum, individuelles Handeln und klimapolitische Maßnahmen unter moralischen Gesichtspunkten zu bewerten. Dazu muss man wissen, welche Eigenschaften und Folgen diese Handlungen und Maßnahmen eigentlich haben, denn davon hängt die moralische Bewertung ab. Und genau diese Eigenschaften und Folgen beschreiben uns die Naturwissenschaften. Ethische Bewertung setzt also naturwissenschaftliche Beschreibung voraus.
Es gibt aber nicht nur eine enge Verbindung zwischen Naturwissenschaft und Ethik, sondern auch zwischen Ethik und Politik. Denn letztlich sollte das, was aus ethischer Sicht angesichts des Klimawandels richtig ist, ja auch in die Tat umgesetzt werden. Das geschieht einerseits durch individuelles Handeln, andererseits aber auch durch die politische Gestaltung von gesellschaftlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für dieses individuelle Handeln – mit anderen Worten: durch Klimapolitik. Staaten richten beispielsweise ihre Energiepolitik im Hinblick auf den Klimawandel neu aus und schließen internationale Abkommen zum Klimaschutz wie die 1992 verabschiedete Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) oder das 1997 verabschiedete Kyoto-Protokoll. Politiker und Wähler fragen sich dabei, welche Klimapolitik alles in allem betrachtet richtig ist, welche Maßnahmen man angesichts des Klimawandels also ergreifen sollte. Neben ökonomischen Aspekten sind dabei klarerweise auch ethische Gesichtspunkte relevant, insbesondere der Gesichtspunkt der Gerechtigkeit. Vermutlich entscheiden sich Politiker und Wähler nicht ausschließlich aufgrund von Gerechtigkeitserwägungen für eine bestimme Klimapolitik, aber die wenigsten würden eine Klimapolitik befürworten, die sie für äußerst ungerecht halten. Die Ethik hilft also bei den Überlegungen von Politikern und Wählern, und insofern spielt sie durchaus eine praxisrelevante Rolle. Hinzu kommt, dass ein als ungerecht empfundener internationaler Klimavertragsentwurf (der z.B. den armen und kaum für den Klimawandel verantwortlichen Entwicklungsländern die Hauptlasten aufbürdet) gerade darum nicht akzeptiert und damit auch nicht umgesetzt würde. Die ethische Kategorie der Gerechtigkeit ist somit auch ein – wenngleich keineswegs das einzige – Kriterium für eine erfolgreiche Klimapolitik, und auch das macht die Ethik für die Politik relevant. Ethisches Nachdenken ist damit in gewisser Hinsicht die Brücke zwischen Naturwissenschaft und Politik: Aufbauend auf der naturwissenschaftlichen Beschreibung der Tatsachen bewertet die Ethik verschiedene Optionen aus moralischer Sicht und gibt damit Empfehlungen für die moralisch richtige Klimapolitik ab.
Man sollte von der Ethik aber auch nicht zu viel erwarten: Ethisches Nachdenken allein verändert die Welt natürlich nicht. Die Welt wird nur besser, wenn das Richtige auch getan wird. Aber sorgfältiges ethisches Nachdenken ist der erste Schritt dahin. Denn um das Richtige zu tun, muss man zunächst wissen, was das Richtige überhaupt ist. Und genau darauf zielt das ethische Nachdenken ab. Es unterscheidet mit Hilfe von begrifflichen Klärungen und der kritischen Prüfung von Argumenten gute von schlechten Antworten auf die klimaethischen Leitfragen. Auf diese Weise liefert es jedem Einzelnen und insbesondere politischen Entscheidungsträgern einen moralischen Kompass, an dem sich die Klimapolitik (aber natürlich auch jeder einzelne in seinem individuellen Handeln) orientieren kann.
Es ist allerdings alles andere als einfach, diesem Kompass in der politischen Praxis auch zu folgen; bei der konkreten Umsetzung der moralisch idealen Klimapolitik ergeben sich nämlich Komplikationen, die eine Reihe weiterer ethischer Fragen aufwerfen. Es ziehen z.B. nicht immer alle Länder an einem Strang; manche kommen ihren Klimaschutzpflichten überhaupt nicht nach. Was bedeutet es nun für ein „pflichtbewusstes“ Land, wenn andere beim Klimaschutz nicht mitmachen? Muss es seine eigenen Anstrengungen erhöhen oder darf es sie ebenfalls vermindern? Auf welche Strategie sollte man denn nun beim Klimaschutz setzen: weniger Emissionen durch weniger Bevölkerung, durch weniger Wirtschaftswachstum oder durch sauberere Technologien? Und wie stellt sich das viel gepriesene Politikinstrument des Emissionshandels aus ethischer Sicht dar: Kann es legitim sein, dass reiche Menschen getrost weiter emittieren, solange sie nur einen „Ablass“ bezahlen, oder sollte nicht jeder zuerst vor der eigenen Haustür kehren? Diese ethischen Komplikationen der politischen Praxis diskutieren wird in Teil IV, nachdem wir durch die Beantwortung der drei klimaethischen Leitfragen in den Teilen I bis III sozusagen einen „moralischen Kompass“ für die ideale Klimapolitik erstellt haben.