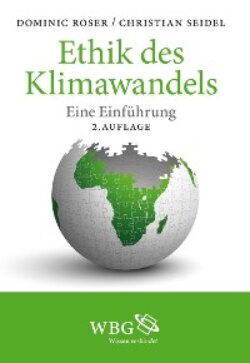Читать книгу Ethik des Klimawandels - Dominic Roser - Страница 19
„Nur wenn man miteinander zu tun hat“: beziehungsbasierte Auffassungen von Gerechtigkeit
ОглавлениеEin erstes Argument knüpft an den Gedanken des Generationenvertrags an und verallgemeinert die Idee einer generationenübergreifenden Solidargemeinschaft. Worauf, so könnte man nämlich fragen, basieren eigentlich unsere Gerechtigkeitspflichten gegenüber anderen Personen? Im Fall des Generationenvertrags im Rentenwesen liegt es beispielsweise nahe zu sagen, dass hier nur deswegen Pflichten ins Spiel kommen, weil die Generationen, die über diesen Vertrag in einem Verpflichtungsverhältnis stehen, sich eine gewisse Zeit lang überlappen und in dieser Zeit in einer engen Beziehung zueinander stehen: Eltern sorgen für ihre Kinder; Lehrer bringen Schülern etwas bei; in jedem größeren Unternehmen tragen Mitarbeiter mehrerer Generationen zum Erfolg und Misserfolg des Unternehmens bei; nicht berufstätige Ruheständler engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen und Gemeinden, was auch jungen Menschen zu Gute kommt; pflegebedürftige Menschen werden von ihren Angehörigen und Fachkräften umsorgt. Kurzum: Das gesamte Gefüge von sozialen Beziehungen innerhalb einer Gesellschaft ist durchdrungen von Beziehungen zwischen Mitgliedern verschiedener Generationen. Und von diesen Beziehungen profitieren beide Seiten – die „Jungen“ ebenso wie die „Alten“. Gerade das könnte man als eine Vorbedingung dafür ansehen, dass zwischen Jung und Alt Pflichten bestehen können: Indem nämlich ein Teil der Gesellschaft (Jung bzw. Alt) zum gemeinschaftlichen Wohl beiträgt, erwirbt er einen Anspruch, der vom anderen Teil (Alt bzw. Jung), der von diesem Beitrag profitiert, erfüllt werden muss. Und genau das, so könnte man sagen, ist immer der Fall, wenn wir jemandem etwas schulden: Es muss bereits zuvor eine Beziehung bestehen zwischen demjenigen, der eine Pflicht erfüllen muss, und demjenigen, dem die Pflicht geschuldet ist.
Das ist der Grundgedanke der „beziehungsbasierten Auffassung von Gerechtigkeit“: Gerechtigkeitspflichten kommen dort und nur dort ins Spiel, wo Personen oder Gemeinschaften in Beziehungen zueinander stehen. Welcher Art diese Beziehungen genau sind, wird in unterschiedlichen Varianten dieser Auffassung unterschiedlich ausbuchstabiert. Es könnten Beziehungen sein, in denen Personen zum gegenseitigen Vorteil kooperieren, Beziehungen innerhalb gemeinsamer staatlicher Institutionen oder auch Beziehungen innerhalb einer Gemeinschaft, die durch eine gemeinsame Herkunft und Kultur zusammengehalten wird. Wesentlich ist dabei, dass der beziehungsbasierten Auffassung von Gerechtigkeit zufolge irgendeine solche Beziehung notwendig ist, damit es Gerechtigkeitspflichten überhaupt geben kann. Nehmen wir an, wir haben zwei vollständig voneinander isolierte Inseln; die Bewohner der einen schwimmen wegen ihrer Bodenschätze geradezu im Wohlstand, während die Bewohner der anderen Insel aus dem kargen Boden gerade das Nötigste herausholen, um ihr Überleben zu sichern. Zwischen den beiden Inseln besteht kein Austausch, keine Kooperation und auch keinerlei sonstige Beziehung. Nach der beziehungsbasierten Auffassung haben die Bewohner der reichen Insel keinerlei Gerechtigkeitspflichten (etwa die Pflicht zu einem Wohlstandsausgleich) gegenüber den Bewohnern der armen Insel: Sie schulden ihnen nichts. Das schließt natürlich nicht aus, dass die Bewohner der reichen Insel aus Mitgefühl freiwillige Hilfe leisten, aber es wäre eben dies: eine freiwillige Tat und keine Pflicht.
Ausgehend von einer solchen beziehungsbasierten Auffassung von Gerechtigkeit kann man nun ein erstes Argument für die zweite Variante des Leugnens – die Auffassung, dass wir gegenüber zukünftigen Generationen überhaupt keine Pflichten haben können – konstruieren. Denn zwischen heute lebenden Personen und den Personen, die in der fernen Zukunft existieren werden, bestehen scheinbar überhaupt keine Beziehungen. Wir erwirtschaften mit den noch nicht geborenen Menschen keine Güter; wir helfen ihnen nicht über die Straße und sie pflegen uns nicht, wenn wir krank sind; sie arbeiten nicht ehrenamtlich in unseren Vereinen und wir helfen nicht bei ihren Straßenfesten. Die Menschen der fernen Zukunft gleichen somit eher Fremden, die wir nicht kennen und mit denen wir nichts zu tun haben. Doch wenn zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Generationen keine Beziehungbesteht und eine Beziehung notwendig für Gerechtigkeitspflichten ist, dann haben gegenwärtige Generationen keine Gerechtigkeitspflichten gegenüber zukünftigen Generationen. Das ist eigentlich nur eine Ausformulierung der eingangs bereits genannten Frage: „Was in aller Welt habe ich mit den Menschen in fernen Ländern und der fernen Zukunft zu tun?“ Auch hier wird unterstellt, dass es Pflichten nur da geben kann, wo es Beziehungen gibt.
Kann man diesem Argument etwas entgegensetzen? Man kann. Denn erstens können auch beziehungsbasierte Auffassungen von Gerechtigkeit nicht verneinen, dass wir sogar gegenüber Fremden gewisse Minimalpflichten haben. Sie sollten beispielsweise zugestehen, dass die Bewohner der reichen Insel nicht einfach eine Bombe auf die Bewohner der armen Insel werfen dürfen. Zumindest die Pflicht, andere nicht zu schädigen, oder die Pflicht, ihre Menschenrechte zu wahren, scheint unabhängig von Beziehungen bestehen, auch wenn alle darüber hinausgehenden Pflichten beziehungsbasiert wären. Und man kann sich fragen, ob sich nicht vielleicht auch einiges, wozu wir zukünftigen Generationen gegenüber verpflichtet sind, bereits aus solchen Minimalpflichten ableiten lässt: Schädigen wir denn zukünftige Generationen nicht, wenn unsere Treibhausgasemissionen z.B. dazu beitragen, dass tropische Wirbelstürme in Zukunft häufiger und vernichtender werden?
Zweitens braucht es nicht besonders viel Einfallsreichtum, um auch innerhalb beziehungsbasierter Auffassungen gewisse Pflichten gegenüber der Zukunft zu rechtfertigen – wenn auch in indirekter Weise. So kooperieren wir zwar nicht mit entfernten Nachfahren, aber doch mit den Mitgliedern einer Generation, die sich mit unserer Generation überlappt. Wir kooperieren mit unseren Eltern und Großeltern, aber auch mit unseren Kindern und Kindeskindern. Innerhalb einer beziehungsbasierten Auffassung lassen sich also durchaus Pflichten gegenüber den vorangegangenen und nachkommenden Generationen rechtfertigen, die mit uns eine Zeit lang gleichzeitig existieren. Wenn nun aber jede Generation derartigen Pflichten nachkommt und für die ihr folgenden Generationen (die sie ja noch von Angesicht zu Angesicht kennt) sorgt, dann entsteht eine Kette von füreinander sorgenden Generationen. Und über diese Kette ist schlussendlich für alle Generationen – auch die der fernen Zukunft – gesorgt. Zwar wäre es dann ganz richtig, dass wir keine direkte Pflicht gegenüber Menschen der fernen Zukunft hätten, aber eine solche Pflicht käme sozusagen indirekt zustande, weil wir gegenüber der nächsten Generation eine Pflicht haben, welche wieder gegenüber der darauf folgenden Generation eine Pflicht hat und so weiter. Nun könnte man allerdings einwenden, dass eine solche Verpflichtungskette im Fall des Klimawandels gar nicht zustande kommt, weil die klimaschädlichen Auswirkungen der heutigen Emissionen nicht unsere direkten Nachkommen betreffen, sondern erst spätere Generationen. Die Wirkungen unserer Handlungen „überspringen“ sozusagen das nächste Glied der Verpflichtungskette. Doch dieser Einwand beruht auf der empirischen Annahme, dass unsere heutigen Emissionen tatsächlich keinerlei problematische Auswirkungen auf die direkt nachfolgende Generation haben. Wie einige klimawissenschaftliche Studien zeigen, trifft das wohl nicht ganz zu: Auch die Emissionen, die eine 30 Jahre alte Frau heute verursacht, führen zu einer in bereits 50 Jahren spürbaren Klimaerwärmung (vgl. Friedlingstein und Solomon 2005; Hare und Meinshausen 2006). Ihr heute geborener Sohn, der dann 50 Jahre alt ist, wird also direkt von den Emissionen seiner Mutter betroffen sein. Unsere heutigen Emissionen haben somit in Wahrheit doch problematische Auswirkungen auf die unmittelbar nachfolgende Generation.
Drittens kann man den Spieß umdrehen und fragen, warum man eigentlich davon ausgehen sollte, dass sich Gerechtigkeitsfragen nur dort stellen, wo Menschen zueinander in Beziehungen stehen oder auf bestimmte Weise miteinander interagieren. Fällt man denn nicht schon allein deswegen in den Anwendungsbereich der Gerechtigkeit, weil man ein Mensch ist – unabhängig von der genauen Beziehung, in der man zu anderen Menschen steht? Ist es nicht ungerecht, wenn das Kind eines reichen Schweizer Managers in einer durchzechten Nacht für alkoholische Getränke so viel Geld ausgeben kann wie das Kind eines chinesischen Wanderarbeiters in fünf Jahren als Erntehelfer erarbeitet – unabhängig davon, ob sich die beiden Kinder kennen? Wenn man so fragt, dann stellt man die zentrale Prämisse der beziehungsbasierten Auffassung von Gerechtigkeit in Frage und entzieht dem ersten Argument gegen die Möglichkeit von zukunftsgerichteten Pflichten seine Grundlage. Nimmt man alle drei Entgegnungen zusammen, dann bleibt von diesem ersten Argument nicht mehr viel übrig: Es stellt keinen hinreichenden Grund dar, Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen für unmöglich zu halten.