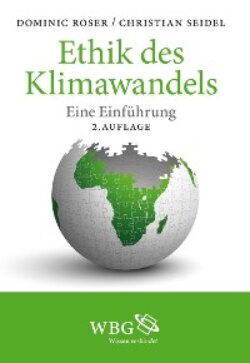Читать книгу Ethik des Klimawandels - Dominic Roser - Страница 20
„Und wenn es dich gar nicht gäbe?“: das Problem der Nicht-Identität
ОглавлениеEin zweites Argument für die Auffassung, dass wir gegenüber zukünftigen Generationen überhaupt keine Pflichten haben können, denkt einen Schritt weiter. Es geht von der Beobachtung aus, dass unsere Handlungen nicht ausschließlich die Konsequenzen haben, die wir beabsichtigen. Sie kaufen am Kiosk eine Zeitung und stecken Sie in die Tasche; ein Spaziergänger sieht dabei zufällig die Titelseite, entschließt sich, die Zeitung zu kaufen und – weil er schon dabei ist – gleich noch ein Lotterielos dazu. Er gewinnt den Hauptpreis, eine lebenslange monatliche Rente, die ihm und seiner Familie ein schönes Leben beschert. In gewisser Hinsicht hat Ihr Zeitungskauf als Nebenfolge das Leben des Spaziergängers erheblich verändert und den Lauf der Welt auf eine Weise beeinflusst, die Sie nicht beabsichtigten.
Diese Beobachtung bildet im Zusammenhang mit dem Klimaschutz den Ausgangspunkt für die folgende Überlegung: Eine der unerwarteten Nebenfolgen klimapolitischer Maßnahmen ist nämlich, dass wir damit auch beeinflussen, welche Menschen in Zukunft überhaupt leben werden. Man stelle sich beispielsweise eine Person namens Laura um 2200 vor. Der Klimawandel ist Realität geworden, die globale Durchschnittstemperatur ist um fünf Grad gestiegen. Laura leidet darunter und beklagt sich darüber, dass vor 200 Jahren nichts dagegen getan wurde. Wenn wir als ihre Vorfahren aber tatsächlich etwas für den Klimaschutz getan hätten und die Emissionen rechtzeitig reduziert hätten, so hätten wir damit nicht nur das Klima geschützt, sondern noch viel mehr verändert: Unternehmen hätten andere Investitionen getätigt und Maßnahmen zur Energieeffizienz umgesetzt; gewisse Branchen (z.B. die Erdölindustrie) wären weniger stark gewachsen, andere (etwa der Bereich der erneuerbaren Energien) dafür umso stärker. Steuermittel wären in andere Forschungszweige geflossen und es wären andere technologische Entwicklungen eingetreten. Menschen hätten andere Berufe ergriffen, andere Gehälter bezogen und andere Güter gekauft. Manches gesellschaftliche Ereignis (etwa eine Diskussion über Klimaschutzmaßnahmen) hätte nie stattgefunden und manche Menschen wären einander privat oder geschäftlich gar nie begegnet. Wenn man all diese Effekte über die Jahre hinweg summiert, so ist es äußerst zweifelhaft, dass sich genau die zwei Personen, die Lauras Eltern werden sollten, getroffen hätten und in derselben Nacht mit derselben Eizelle und demselben Spermium, die Lauras DNA bestimmen, ein Kind gezeugt hätten. Doch damit wäre Laura auch nie geboren. In dem Szenario, in dem wir rechtzeitig Klimaschutzmaßnahmen ergriffen hätten, würde es Laura also nicht besser gehen, sondern es würde sie gar nicht geben! Es würden ganz andere Menschen als Laura existieren. Zwar würde es diesen anderen Menschen mit den Klimaschutzmaßnahmen besser gehen als es Laura ohne Klimaschutzmaßnahmen ginge, aber Laura selbst ginge es nicht besser.
Mit der Klimapolitik beeinflussen wir also nicht nur, wie gut es Menschen in der fernen Zukunft geht, sondern auch, wer genau diese Menschen überhaupt sein werden. Auf den ersten Blick scheint dieser Gedankengang vielleicht eine abstrakte Spielerei zu sein. Doch er führt auf ein ernstes Problem, das auch als „Problem der Nicht-Identität“ bekannt geworden ist (Parfit 1984: Kap. 16): Denn unsere Pflicht zum Klimaschutz scheint darauf zu basieren, dass wir einige in Zukunft lebende Menschen schädigen würden, wenn wir heute keine Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Doch dass wir diese Menschen schädigen, scheint gerade zu bedeuten, dass es ihnen ohne unseren Klimaschutz schlechter geht als es ihnen mit Klimaschutz gehen würde. Klimaschutzpflichten scheinen damit auf der Idee zu basieren, dass es den betroffenen Menschen der Zukunft schlechter geht, wenn wir keinen Klimaschutz leisten, und besser, wenn wir doch Klimaschutz leisten. Dabei wird aber als eine Vorbedingung vorausgesetzt, dass die betroffenen Menschen in den beiden Szenarien identisch sind: Es muss ihnen mit Klimaschutz besser gehen als es ihnen ohne Klimaschutz geht. Doch wie wir gerade gesehen haben, ist diese Vorbedingung nicht erfüllt. Denn in dem Szenario, in dem wir Klimaschutz leisten, sind die Menschen, denen es dann gut gehen würde, ganz andere Menschen als die, denen es schlecht gehen würde, wenn wir keinen Klimaschutz leisten. Die Menschen, über die wir in den beiden Szenarien „mit Klimaschutz“ und „ohne Klimaschutz“ sprechen, sind also gar nicht identisch (daher heißt es auch „Problem der Nicht-Identität“). In der fernen Zukunft wird es somit niemanden geben, der sich darüber beklagen kann, dass es ihm selbst besser ginge, wenn wir das Klima geschützt hätten, denn in diesem Fall gäbe es ihn gar nicht. Es scheint daher, als würden unsere heutigen Treibhausgasemissionen eigentlich niemandem wirklich schaden; und damit kann es auch keine Klimaschutzpflicht gegenüber zukünftigen Generationen geben.
In Reaktion auf die merkwürdige Schlussfolgerung, die sich aus dem Problem der Nicht-Identität ergibt, ist eine umfangreiche Auseinandersetzung entstanden (vgl. Roberts 2009). Aus den verschiedenen Antworten sei hier diejenige herausgegriffen, die uns am vielversprechendsten erscheint: Das Problem der Nicht-Identität beruht erstens auf der Annahme, dass die Klimaschutzpflicht dadurch begründet ist, dass Menschen geschädigt würden, wenn wir keinen Klimaschutz leisteten. Dabei wird zweitens eine Konzeption von Schädigung vorausgesetzt, in der man ein und dieselbe Person in zwei verschiedenen Szenarien betrachtet und sich fragt, ob es dieser Person in einem Szenario besser oder schlechter gehen würde als es dieser Person in einem anderen Szenario gehen würde. Die Idee der Schädigung scheint also stets einen Vergleich zwischen zwei Zuständen ein und derselben Person zu enthalten.
Aber ist es plausibel, davon auszugehen, dass Klimaschutzpflichten nur durch die Idee der Schädigung begründet werden können? Und selbst wenn: Sollte man Schädigung dann als relative Schlechterstellung ein und derselben Person verstehen? Solange jemand eine gewisse Schwelle an Wohlergehen überschritten hat, ist es aus moralischer Perspektive oft weniger entscheidend, ob es ihm oberhalb dieser Schwelle besser oder schlechter geht; viel bedeutsamer ist es, ob Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, diese Schwelle zu überschreiten und ein ausreichend gutes Leben zu führen. Und dabei ist es dann nicht entscheidend, wem genau unsere Handlungen diese Möglichkeit nehmen, sondern nur, dass sie irgendjemandem diese Möglichkeit nehmen. Die Art und Weise, wie wir über Rechte denken, veranschaulicht dies gut: Wir gehen oft davon aus, dass jeder Mensch gewisse Rechte hat – etwa die Menschenrechte (das Menschenrecht auf Leben, auf freie Wahl des Aufenthaltsorts oder auf Eigentum) oder Ansprüche, die sich aus Erwägungen der Verteilungsgerechtigkeit ableiten lassen (etwa den Anspruch auf einen gewissen Teil der natürlichen Ressourcen). Wenn man Rechte ins Spiel bringt, dann hängt die Frage, ob man etwas tun darf oder nicht, davon ab, ob das Tun die entsprechenden Rechte verletzt oder nicht; und für die Frage, ob Rechte verletzt werden, ist es nicht entscheidend, wessen Rechte es sind, solange es irgendjemandes Rechte sind. Stellen Sie sich einfach vor, ein verrückter Wissenschaftler schickt heute eine Rakete in die Atmosphäre, die in genau 200 Jahren eine hochgiftige Substanz auf der ganzen Erde verteilt, an der viele Menschen sterben werden. Der Wissenschaftler macht seine Tat heute weltweit bekannt; alle Menschen wissen also, was auf sie und ihre Nachfahren zukommt. Mit dieser Entscheidung beeinflusst der Wissenschaftler ganz sicher auch, welche Menschen es in 200 Jahren gibt: Einige Menschen werden sich vielleicht denken „Wenn ohnehin alles bald zu Ende geht, dann brauchen wir auch keine Kinder mehr in die Welt zu setzen“, es wird Forschungsprojekte geben, die auf die Verhinderung dieser Katastrophe abzielen, und manche Menschen wären sich ohne den Raketenstart niemals begegnet. Die Welt in 200 Jahren wird mit dem Start der Rakete also eine andere sein als ohne den Start der Rakete. Doch das hat keinerlei Auswirkungen auf die Frage, ob es dem Wissenschaftler moralisch erlaubt ist, die Rakete zu starten. Denn der Grund dafür, dass er die Rakete nicht starten darf, ist einfach, dass er damit das Recht auf Leben von einigen Menschen, die in 200 Jahren leben werden, verletzt. Und dabei spielt es gar keine Rolle, wer diese Menschen in 200 Jahren genau sind. Entscheidend ist lediglich, dass die Handlung das Recht auf Leben verletzt; wessen Recht auf Leben sie verletzt, ist für die Begründung der Pflicht, die Rakete nicht zu starten, unerheblich.
Ganz analog könnte man im Fall des Klimaschutzes argumentieren: Unsere Emissionen sind wie die Rakete des Wissenschaftlers, auch sie verletzen die Rechte der zukünftig lebenden Menschen. Wenn unser Handeln z.B. zu vermehrten und verstärkten Wirbelstürmen führt, die Menschen der Zukunft töten, verletzen, besitz- und obdachlos machen und zur Migration zwingen, dann verletzt unser Handeln das Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, auf Eigentum und auf freie Wahl des Aufenthaltsorts. Entscheidend ist dabei nicht, ob es die Rechte von Laura oder Mauro sind, die verletzt werden, entscheidend ist einfach, dass überhaupt Rechte verletzt werden. Das reicht bereits um zu sagen: Wir müssen das Klima schützen. Dieser Vorschlag zeigt, dass es also auch Begründungsmöglichkeiten für Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen gibt, die nicht von der Idee der Schädigung Gebrauch machen, welche dem Problem der Nicht-Identität zugrunde liegt. Wir sind also nicht darauf angewiesen sind, zwischen zwei Zuständen ein und derselben Person zu vergleichen. Auch das zweite Argument spricht somit nicht dafür, dass es grundsätzlich keine zukunftsgerichteten Pflichten geben kann.