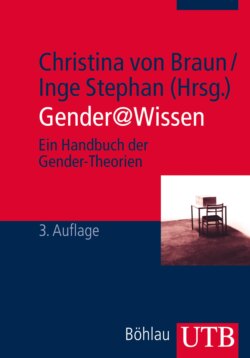Читать книгу Gender@Wissen - Группа авторов - Страница 26
Entwicklungsgeschichte des Begriffs
ОглавлениеIm Rahmen der Gender Studies erweist es sich als sinnvoll, den Körper in seiner individuell-persönlichen und seiner kollektiven Dimension zu untersuchen, denn auf beiden Ebenen materialisieren sich Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Kulturanthropologie und Geschichtswissenschaft haben gezeigt, dass eine Wechselwirkung zwischen der Wahrnehmung von Individual- und Gesellschaftskörper [<< 77] besteht.1 Die historisch sich wandelnden Körperkonzeptionen prägen die (geschlechtsspezifische) Selbstwahrnehmung, beeinflussen religiöse, sexuelle und politische Weltbilder und dienen der Herausbildung kollektiver (z. B. nationaler) Identitäten.2 Dabei wird gerade der weibliche Körper bevorzugt für (allegorische oder symbolische) Darstellungen des Gemeinschaftskörpers eingesetzt, weil er in der (abendländischen) Tradition als ‚natürlich‘ imaginiert wird und deshalb als privilegierte Matrix kultureller Zu- und Einschreibungen fungieren kann.3
Die Assoziation von Weiblichkeit und Natur bedeutet jedoch auch, dass beide zum Objekt der Unterwerfung und Austragungsort (wissenschaftlicher) Macht werden. Zwar richtet sich seit Descartes’ Gegenüberstellung von res extensa und res cogitans die Abwertung des Materiell-Animalischen nicht allein gegen den weiblichen, sondern auch gegen den männlichen Körper, doch kann Letzterer in der philosophischen Tradition leichter von der Aufwertung des Geistes profitieren. Vor dem Hintergrund der Auffassung, dass der männliche Körper die Norm darstelle und der weibliche Körper dessen Abweichung, bildet sich im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts eine ‚weibliche Sonderanthropologie‘ heraus. So wird das sogenannte ‚Ein-Geschlecht-Modell‘, demzufolge der weibliche Körper genauso ausgestattet ist wie der männliche, wenngleich mit nach innen gekehrten Geschlechtsteilen, allmählich vom ‚Zwei-Geschlecht-Modell‘ abgelöst, das männliche und weibliche Sexualorgane als grundsätzlich unterschiedlich auffasst und in ein hierarchisches Verhältnis zueinander setzt.4 Auch die philosophisch-moralische Begründung für den Ausschluss von Frauen aus der öffentlichen Wissensproduktion zugunsten ihrer Reduzierung auf Reproduktions- und Familienarbeit wird zunehmend mit biologisch-anatomischen Argumenten geführt, so dass die Vorstellung von je spezifischen „Geschlechtscharakteren“ 5 in eine naturwissenschaftlich fundierte „Ordnung der Geschlechter“ 6 mündet. Mit Blick auf die Konstruktion des weiblichen Körpers bedeutet dies – um auf [<< 78] ein Begriffspaar zurückzugreifen, auf das im nächsten Abschnitt noch eingegangen wird –, dass gender zu sex gemacht wird.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts kursieren unterschiedliche Körperkonzeptionen in den Gender Studies: Neben der Auffassung, der Körper sei ein quasi-natürlicher Garant für Identität oder Differenz steht die Überzeugung, der Körper müsse nicht nur als Objekt kultureller Überformungen und Einschreibungen verstanden werden, sondern werde überhaupt erst diskursiv hervorgebracht.7 Die wissenschaftshistorischen und politischen Hintergründe dieser divergierenden Konzepte werden im Folgenden dargestellt.