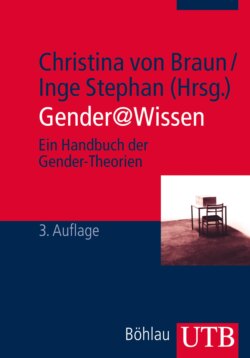Читать книгу Gender@Wissen - Группа авторов - Страница 31
Zeugung
Bettina Bock von Wülfingen Einleitung (vom Zeugen und Schaffen)
ОглавлениеÄhnlich wie der Begriff Geschlecht ist der deutsche Begriff der Zeugung umfassender und hat in anderen westlichen Sprachen wenig direkte Entsprechung. Er leitet sich vom althochdeutschen „giziogon“ für „fertigen“ bzw. im Mittelhochdeutschen „ziugunge“ ab, was sowohl einerseits auf „Beziehung“ und andererseits auf das „Geschaffene“ im Sinne von „Zeug“ verweist.1 Der Nominativ Zeug meint in seiner mittelalterlichen Bedeutung metallene Gegenstände wie vor allem Rüstzeug und später Schrifttypen in der Druckerei. Besonders die Verbindung des Begriffs mit der mittelalterlichen Zeugdruckerei,2 wobei von Modeln aus Holz oder Metall als ‚Zeug‘ Muster auf Stoffe gebracht wurden, verweist auf die Möglichkeit, dass bereits der damalige Begriff der Zeugung Vorstellungen von Abbilden und Ähnlichkeit implizierte. Eine solche begriffliche Belegung fand nach Jordanova im Englischen mit dem aus der Möbelindustrie stammenden Begriff der reproduction erst im 19. Jahrhundert statt, als dieser Begriff begann, den Begriff der generation zu ersetzen.3
Im Lateinischen wie Englischen wird die Zeugung, wenn nicht mit Reproduktion bzw. Befruchtung (mit dem Wortteil „fertil-“), dann mit „generation“ („to generate: 1. to bring into existence; originate; produce: to generate ideas […]; 4. […] procreate“)4 übersetzt. In beiden Fällen geht es um die Hervorbringung eines Lebewesens durch Befruchtung. Allerdings meint der lateinische Begriff „generation“, eine Übersetzung der aristotelischen Kategorie „genesis“,5 die Überführung vom Nicht-Sein zum Sein – [<< 97] „eine höchst und exklusiv männlich verstandene Zeugung, […][M]it ‚generatio‘ ist davon die Rede, dass einer etwas macht – vor allem etwas Lebendiges.“ 6 Vor allem, aber nicht nur, denn diese Fassung von Zeugung als Schöpfung im kreativen Akt der Befruchtung (wobei die Frucht, die eingesetzt wird, nicht organischer Art sein muss) bezieht sich sowohl auf die göttliche Schöpfung, wie auch die künstlerisch-kreative.7 Beides könnte kaum deutlicher in eins fallen als in dem quasi homosexuellen Zeugungsakt von Michelangelo, dem Fresko „Die Schöpfung Adams“ in der Sixtinischen Kapelle. So wird die Metapher der Zeugung auch im Umgang mit der Schriftkultur immer wieder, etwa in Literatur und Germanistik, bemüht, wenn es darum geht, die Erschaffung von Werken als ehrenhaft aus der eigenen Kraft heraus darzustellen.8
Entsprechend beschrieb die differenz- und symboltheoretische Analyse die kontinuierliche Aneignung weiblicher Produktivität 9 für die verschiedensten Wissensfelder. Eva Mayers psychoanalytisch angelegte Diskussion der „Selbstgeburt“ sieht in solchen Konzepten des unendlichen „Spiegelns“ vor allem das Bannen des Materiellen,10 eine Überwindung (von Sterblichkeit) durch Aneignung von Generativität, die sich, so auch die Biologin Elvira Scheich, ebenfalls in den naturwissenschaftlichen Traditionen der Theoriebildung fände.11
Mit zumindest als solchen diskutierten neuen technischen Möglichkeiten stellt sich zunehmend die Frage, wo denn das Lebendige beginne. Wurden Mary Wollstonecrafts [<< 98] Frankenstein und spätere Monster im 19. Jahrhundert von der industriellen Revolution, immer drängenderen Fragen nach der eigenen Identität und schließlich dem bewegten Bild angeregt, so geschieht dies neuerlich mit den aktuellen Technologieentwicklungen. Oder eher werden im Wechselverhältnis zwischen dem Willen zur „Verlebendigung der Technik“ 12 und den entstehenden Möglichkeiten, die Maschine mit dem Digitalen und teils auch dem Biotischen zu vermengen, lebendige Artefakte geschaffen, ohne auf das sterbliche Weibliche der Mutter rekurrieren zu müssen.13
Gleichzeitig erzeugen genetische Technologien und neuere Entwicklungen wie die Synthetische Biologie, die sich in der Lage sieht, biologische Zellen aus chemischen Einzelteilen herzustellen (und beschleunigt durch den Versuch des Genetikers Craig Venter, ein synthetisches Chromosom in ein Bakterium einzuführen und ‚zum Leben zu erwecken‘), eine analytische Entsprechung. Diese besteht in der sprachlichen Wendung, hier nun endgültig ginge es (zumindest den NaturtechnikerInnen und dem Kapital) um „life itself“, das Leben selbst.14
In der Geschlechterforschung wird die Zeugung einerseits, beginnend in den 1970er-Jahren, vorwiegend in ihren Dimensionen als Problem der künstlichen Befruchtung diskutiert. Andererseits richtet sich das Interesse auf einander historisch ablösende frühe bis aktuelle wissenschaftliche Zeugungstheorien als kulturtheoretisches Phänomen, die auf wechselnde Geschlechter- und Gesellschaftsordnungen verweisen (wie etwa von der Urzeugung bis zum Ein- und Zweigeschlechtermodell oder heutiger Merkantilisierung von Gameten und Embryonen). Wie die Geschlechterforschung seit über drei Jahrzehnten zeigt, sind Konzepte der Naturforschung und jeweilige kulturelle Hintergründe untrennbar über die Jahrhunderte mit Zeugungstheorien verknüpft. Auf diesen Aspekten, der Rolle von Geschlecht in verschiedenen Zeugungstheorien in der Naturforschung bis zur extrakorporalen Befruchtung, soll daher im Folgenden der Fokus liegen. [<< 99]