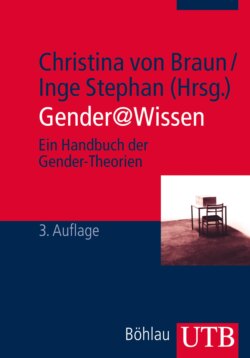Читать книгу Gender@Wissen - Группа авторов - Страница 33
Naturforschung im 19. und 20. Jahrhundert: Das gezeugte Geschlecht
ОглавлениеIn einer Fortführung des mechanistischen Konzepts vertraten seit den 1870er-Jahren die Embryologen bzw. Entwicklungsmechaniker Wilhelm His, Wilhelm Roux und Eduard Driesch die „Kontakt-Theorie“ 42, die auch als „physico-chemische“ Theorie firmiert.43 Der Beginn allen Wachstums läge im Ei begründet, das von einem Stimulus durch das Spermium profitierte: „Nicht die Form ist es, die sich überträgt, […] sondern die Erregung zum formerzeugenden Wachstum, nicht die Eigenschaften, sondern der Beginn eines gleichartigen Entwicklungsprozesses.“ 44 Der Präformationstheorie setzte Oskar Hertwig nach seiner Beobachtung der Fusion von Eizelle und Spermium unter dem Mikroskop 1876 eine „morphologische“ 45 Theorie entgegen. Die materielle Vereinigung der Kerne sowohl der Eizelle wie des Spermiums sei zur Zeugung und Weiterentwicklung nötig und er folgerte (entgegen der Präformationstheorie), alle Körperzellen und Embryonen enthielten die Fähigkeit, sich männlich oder weiblich zu entwickeln.46 Der Zoologe Edouard van Beneden verband diesen zellulären Hermaphroditismus mit der Idee des Energiemoments im Spermium: Er sah in der Befruchtung der Eizelle den Startpunkt eines notwendigen Verjüngungsprozesses der sich dann weiterentwickelnden Eizelle 47 und schloss ebenfalls aus seiner Beobachtung der gleichmäßigen Verteilung von Chromosomen bei der Zellteilung, dass alle Zellen und somit auch der Embryo sowohl männlich als auch weiblich seien.48 [<< 104]
Grundsätzlich bewirkten die Beobachtung der Chromosomen und die spätere Theorie der Vererbung durch sie, dass der Streit zwischen den verschiedenen Schulen des Präformismus um 1900 in der herkömmlichen Form beigelegt war, denn der materielle Beitrag beider Geschlechter in der Zeugung war nun schwer abzuweisen. Dies geschah schließlich auch auf Kosten der Theorie mehrgeschlechtlicher Entwicklungsfähigkeit von Embryonen: In der physiologischen wie ökonomischen Betrachtungsweise der Zeugung konnte der Embryo die verschiedensten Eigenschaften aus einer Anlage entwickeln, die alle Möglichkeiten barg, je nachdem ob ein bestimmtes Phänomen überwog (dies war je nach Theorie das graduelle Überwiegen eines Stoffes oder einer chemischen oder physikalischen Bedingung innerhalb oder außerhalb der Zellen). Nach der Theorie der materiegebundenen Eigenschaften dagegen entschieden konkrete Partikel über eine qualitative Differenz. Dass diese damit dann nicht mehr auf epigenetische Einflüsse der Umgebung, sondern einzig auf Abstammung zurückführbar war, scheint vor dem Hintergrund zunehmender, Kontinente überschreitender Mobilität und rassisierter Klassenkämpfe im die Naturforschung anführenden Vereinten Königreich und Preußen umso relevanter. Die Theorie der Vererbung von Eigenschaften über Chromosomen war nach ihrer Veröffentlichung 1906 relativ schnell akzeptiert. Allerdings war es gerade die Frage, ob und wie Chromosomen Geschlecht vererben, die die Durchsetzung der Theorie der chromosomalen Vererbung erschwerte, da selbst die Vertreter der Theorie Mendels daran festhielten, nicht der Moment der Zeugung entscheide über das Geschlecht, sondern später wirkende Konditionen. 49 [<< 105]