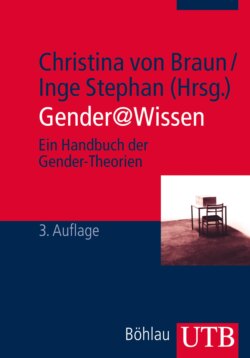Читать книгу Gender@Wissen - Группа авторов - Страница 27
Einordnung in die Wissenschaftsgeschichte
ОглавлениеDie Frauenbewegung der 1970er-Jahre wendet sich in Selbsterfahrungsgruppen, politischen Arbeitskreisen und wissenschaftlichen Diskussionszusammenhängen vor allem dem weiblichen Körper zu. Sie fordert Selbstbestimmung und Verfügungsgewalt über den eigenen Körper (u. a. in der Debatte um die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und Alice Schwarzers PorNO-Kampagne), argumentiert gegen die Medikalisierung weiblicher Sexualität (Menstruation, Schwangerschaft, Geburt und Menopause)8 und widmet sich der Rekonstruktion und Aufwertung weiblicher Körpererfahrungen und Wissensbestände 9 sowie der Suche nach neuen Ausdrucksformen weiblicher Lust jenseits von patriarchalen und heterosexuellen Zuschreibungen.
Vor allem in Frankreich verbinden sich dabei linguistische, philosophische und psychoanalytische Perspektiven, die sich kritisch mit abendländischen Denktraditionen bzw. den Weiblichkeitskonzepten von Sigmund Freud und Jacques Lacan auseinandersetzen.10 So entlarvt Luce Irigaray in parodistischen Relektüren die logozentrische und spekuläre Logik von westlicher Philosophie und freudscher Psychoanalyse und plädiert für eine Feier weiblicher Autoerotik und des mütterlichen Körpers sowie für die Entwicklung eines spezifisch weiblichen Sprechens bzw. Schreibens, das der rhythmisch-klanglichen [<< 79] Seite der Sprache besonderen Raum gibt.11 Julia Kristeva ergänzt Lacans Konzept des Symbolischen um die Kategorie des Semiotischen, das die präödipale Mutter-Kind-Dyade mit ihren primären Trieben und pulsierenden Bewegungen bezeichnet; auch nach der Ablösung des sich entwickelnden Kindes vom mütterlichen Körper destabilisiere das Semiotische in Form von rhythmischen und klanglichen Besonderheiten die sprachlichen Sinnbildungsprozesse der symbolischen Ordnung.12
Obwohl Theoretikerinnen wie Irigaray und Kristeva die écriture féminine nicht ausschließlich an Weiblichkeit binden, stehen sie im Verdacht, naturalistisch-essentialistische Vorstellungen fortzuführen. Ähnliche Vorwürfe richten sich gegen jene Differenz-Feministinnen, die überhistorische weibliche Erfahrungen rekonstruieren und positiv besetzen, weil sie damit die hierarchischen Dichotomien von Körper und Geist bzw. Natur und Kultur nicht überwinden, sondern eine „Geschlechtermetaphysik mit umgekehrten Vorzeichen“ betreiben.13
Auch über den französischen Feminismus der 1970er-Jahre hinaus erweist sich die kritische Verbindung von Psychoanalyse und Geschlechterforschung gerade für die Körpertheorie als fruchtbar. So verdeutlicht die umfangreiche Forschung zur Hysterie nicht nur die Verknüpfung von Weiblichkeits- und Krankheitsvorstellungen, sondern – über das Moment der ‚Lektüre‘ uneindeutiger Krankheitssymptome – auch die komplexen Wechselwirkungen zwischen Körper und Zeichen.14 Grundlegend bleibt auch Lacans Konzept der Subjektkonstitution im sog. Spiegelstadium. Laut Lacan glaubt das Kleinkind, in seinem Spiegelbild bzw. im anerkennenden Blick der Mutter seine eigene Gestalt als Ganzheit zu erkennen, ignoriert dabei jedoch seine tatsächliche Abhängigkeit und motorische Ohnmacht. Die Herausbildung eines Körperbildes qua Identifikation ist also laut Lacan ein Ergebnis von Verkennungen und verweist – trotz der Illusion von Autonomie und Ganzheit – auf den grundsätzlichen Mangel [<< 80] und die unhintergehbare Gespaltenheit des Subjekts, eine These, die in den Gender Studies zur kritischen Hinterfragung idealisierender Körperkonzepte beigetragen hat.15
Die Differenzierung in sex und gender, also in ein biologisches und ein soziokulturell konstruiertes Geschlecht, eröffnet im Verlauf der 1970er-Jahre neue Perspektiven auf den Körper.16 Etwa zeitgleich werden Michel Foucaults Studien rezipiert, die ebenfalls die historische ‚Gemachtheit‘ körperlicher Kategorien thematisieren. Die Arbeiten des französischen Philosophen untersuchen das Zusammenwirken von Macht und Wissen, durch das der Individualkörper, aber auch der Bevölkerungskörper auf historisch je spezifische Weise sowohl produziert als auch diszipliniert bzw. reguliert werden.17 Dies bedeutet, dass (Selbst- und Fremd-)Wahrnehmung von Körper und Geschlecht nicht biologisch konstant und mithin geschichtslos bzw. überhistorisch sind, sondern sozial und kulturell wandelbar. In der Folge haben sich die Geisteswissenschaften mit unterschiedlichen Körperkonzeptionen beschäftigt (z. B. der Körper der Säftelehre, der durchlässige bzw. groteske Körper, der Körper als Räderwerk, Maschine, Nervengeflecht oder Netzwerk)18 sowie mit der historischen und geschlechtsspezifischen Wahrnehmung verschiedener Körperzustände (z. B. der schöne, verführerische, (un)fruchtbare, kranke, verwundete, sterbende Körper).19
Weitere Impulse erhält die Körperforschung in den 1980er-Jahren durch die Historische Anthropologie, wenngleich gender-Perspektiven dort nicht leitend sind. In frühen Veröffentlichungen erhebt die „Wiederkehr des Körpers“ im Namen authentischer Erfahrungen Einspruch gegen die zunehmende Instrumentalisierung und Technisierung des Körpers; spätere, eher kultursemiotisch ausgerichtete Arbeiten [<< 81] untersuchen den Körper v. a. als Gegenstand und Gedächtnis (gewaltsamer) kultureller Einschreibungen.20
Andere Wege gehen seit Mitte der 1980er-Jahre Studien am Schnittpunkt von Geschichtswissenschaft, Geschlechterforschung und Ethnomethodologie, die mit der Unterscheidung zwischen Körper und Leib arbeiten, welche in der Phänomenologie und philosophischen Anthropologie von Maurice Merleau-Ponty, Helmut Plessner und Hermann Schmitz entwickelt wurde. Dabei steht die Kategorie des Leibes für Innenwahrnehmung, Selbsterfahrung und Ganzheitlichkeit, während der Körper als von außen wahrnehmbar, kulturell überformt, objektiviert und instrumentalisiert aufgefasst wird. Diese begriffliche Unterscheidung und die Rekonstruktion früherer Leibeswahrnehmungen zielen auf die Überwindung des cartesianischen Dualismus sowie auf die Freilegung ehemals unentfremdeter, aber durch Sexualwissenschaft und (Bio-)Medizin verschütteter Wissensbestände.21 Die Arbeiten der Körperhistorikerin Barbara Duden argumentieren überzeugend gegen die Rückprojektion gegenwärtiger Körperauffassungen auf frühere Zeiten, neigen jedoch dazu, vergangene Leiberfahrungen als ‚eigentlich‘, ‚natürlich‘ und vordiskursiv zu proklamieren. Die Soziologin Gesa Lindemann entwirft Leib und Körper als gleich ursprünglich, privilegiert in ihrer Studie zur Transsexualität allerdings insofern die Ebene des Leibes, als sie danach fragt, auf welche Weise ein gesellschaftlich-kulturell konstruierter Körper ‚unmittelbar‘ als geschlechtlicher Leib erfahren wird.22
Trotz seiner erkenntniskritischen Stoßkraft läuft das Begriffspaar sex und gender Gefahr, auf unterschwellige Weise überkommene Dichotomien von Natur / Biologie und Kultur fortzuschreiben. Vor diesem Hintergrund erhalten Körpertheorie und Gender Studies in den 1990er-Jahren wichtige Anregungen durch Judith Butlers radikal-konstruktivistische Infragestellung der Kategorie des biologischen Geschlechts (sex) als ebenso kulturell konstruiert wie gender. Butler fordert, den Körper nicht als (bereits vorhandene) Einschreibefläche kultureller Prägungen und Zurichtungen zu verstehen, sondern als Effekt, der durch diskursive, also sprachliche und kulturelle [<< 82] Operationen überhaupt erst produziert wird.23 Weder die Wahrnehmung von Körperteilen und -grenzen noch die Geschlechtlichkeit des Körpers können demnach als vorgängig gelten, sondern sie sind Sedimentierungen sozio-kultureller Prozesse bzw. müssen durch performative Praktiken des Zitierens beständig neu hervorgebracht werden.24 Dies bedeutet, dass auch die feministische Rede vom Körper keinen Ort unmittelbarer Erfahrung beanspruchen kann.
Vor allem Butlers Das Unbehagen der Geschlechter wird aus unterschiedlichen Richtungen kritisiert. So sehen Seyla Benhabib, Drucilla Cornell und Nancy Fraser die Handlungsfähigkeit des Subjekts bedroht und politische Perspektiven, z. B. im Kampf gegen Geschlechterdiskriminierung, Rassismus und Militarismus, vernachlässigt.25 Einige Körperhistorikerinnen sprechen dagegen von ‚Entkörperung‘ und ‚Verdrängung des Leibes‘, weil die Materialität des Körpers sowie die leibliche Selbstwahrnehmung unberücksichtigt blieben.26 Obwohl Butler in Körper von Gewicht das Verhältnis zwischen Performativität und Materialität des Körpers genauer bestimmt, hält sich die Kritik der 1990er-Jahre zum Teil hartnäckig.27
Insgesamt setzen sich jedoch seit den 2000er-Jahren Arbeiten durch, die eine Polarisierung zwischen essentialistischen und konstruktivistischen Ansätzen, die ja selber an der Fortschreibung des cartesianischen Dualismus beteiligt ist, zu überwinden suchen.28 Entsprechend problematisieren Begriffe wie derjenige der ‚Verkörperung‘ sowie von Butler ausgehende Forschungen im Kontext der Queer Studies die Privilegierung von gender gegenüber sex.29 Zahlreiche Studien argumentieren, dass die Konzepte von Performativität und Diskursivität nicht auf eine rein sprachliche Ebene reduzierbar [<< 83] sind, sondern sehr wohl (geschlechterpolitische) Fragen nach regulierenden Normierungen sowie den Möglichkeiten und Grenzen von agency, also der politischen Handlungsmächtigkeit des Subjekts stellen.30 Eine vermittelnde Position nehmen auch jene historischen Arbeiten ein, die von der diskursiven Konstruktion des Körpers ausgehen, sich aber zugleich gegen eine Aufgabe der Kategorie des ‚Subjekts der Geschichte‘ wenden und darauf beharren, dass Erfahrungen wie Lust und Schmerz die Grenzen der Diskursivität überschreiten und damit gewissermaßen widerständige Phänomene darstellen.31