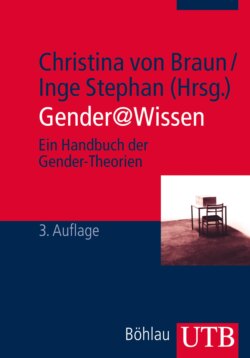Читать книгу Gender@Wissen - Группа авторов - Страница 32
Zeugung in der Naturforschung von der Antike bis zur Moderne:
Flüsse und Ökonomie
ОглавлениеDie bereits mit der antiken Mythologie einsetzende symbolische Zuschreibung der Geschlechter zu Logos / Geist einerseits und Materie / Körper andererseits findet in den Vorstellungen der frühen Naturforschung zur Zeugung ihre Entsprechung in der Differenz von Form versus Materie sowie von Hitze und Kälte nach der Temperamentenlehre der Humoraltheorie. Platons Interesse galt noch vor allem der Auflösung des Konfliktes zwischen Einheit und Differenz,15 wie in dem Urmythos von Zeugung und Eros deutlich wird, den er den griechischen Komödiendichter Aristophanes erzählen lässt.16 So habe es ursprünglich drei Geschlechter gegeben, indem immer zwei miteinander einen Kugelmenschen bildeten, zwei weibliche oder zwei männliche oder eine männlich-weibliche Kugel. Ihre Gesichter waren zueinander gewandt, die Geschlechtsteile nach hinten bzw. außen gerichtet. Da sie sich mit Zeus überwarfen, teilte er sie alle in zwei. Nun aber sehnten sie sich nacheinander und suchten und umarmen sich ständig, und kamen dadurch weder zum Arbeiten noch pflanzten sie sich fort. Zeus zeigte Einsicht und setzte ihre Geschlechter nach vorn. Hier liegt der Ursprung des Eros, bei Platon das Begehren nach Vereinigung gänzlich unabhängig von Zeugungsphantasien. Anders als für Platon stellt sich für Aristoteles hingegen mit der Frage nach der Zeugung auch stärker die Frage nach Differenz. Diese ist graduell und drückt sich nach der Philosophin Ingvild Birkhan in der männlichen Dominanz und Autorschaft aus.17
Männlichkeit und Weiblichkeit standen in der Antike nicht in binärer Opposition und waren auch nicht mit Genitalität verbunden,18 sondern mit den sich mischenden Temperamenten, wobei dem Männlichen das feurige und aktive zukommt.19 So wird nach Aristoteles „Über die Zeugung der Geschöpfe“ der allein nährende, die Materie [<< 100] darbietende weibliche Körper vom männlichen ‚Samen‘ befruchtet. Dabei sind diese Begriffe in ihrer heutigen Belegung irreführend, denn der dort so bezeichnete Samen ist reiner Impuls- und Formgeber.20 Begleitet wird die in diesem Konzept enthaltene Aktiv-passiv-Symbolik zugleich von der Gegenüberstellung männlicher Hitze zu weiblicher Kälte, es sei also die Hitze, die der weiblichen Samenmaterie (für Aristoteles das Menstruationsblut) bei der Zeugung zur Entwicklung verhelfe.21
Auch für die erfolgreiche Zeugung im Geschlechtsakt müsse ausreichend koitale Hitze herrschen, indem beide Geschlechter in Wallung sein müssten, heißt es noch in der Spätantike bei Soranus im 2. Jahrhundert in Rom 22 und bleibt Thema noch im 20. Jahrhundert. Bereits in der Antike gab es zwar mit Anaxagoras, Empedocles, Hippocrates und Parmenides Naturphilosophen, die die materielle Entstehung des Fetus sowohl dem männlichen wie auch weiblichen Samen zuschrieben.23 Dennoch wird das Aristoteles folgende Ein-Geschlechter- und Zeugungsmodell der Humoraltheorie von den griechischen Ärzten Galen und Soranus fortgeführt 24 und trägt sich über Paracelsus hinaus bis in die Aufklärung und damit bis zu den Ansätzen der heutigen Biomedizin.25 Und auch christliche wie jüdische Theoretiker behielten Aristoteles’ Verständnis des Männlichen als aktivierendes und formgebendes Prinzip über die Jahrhunderte bei.26
Mit der bürgerlichen Revolution gilt ab etwa dem 18. Jahrhundert das wissenschaftliche Interesse ganz der nicht nur graduellen, sondern qualitativen Geschlechterdifferenz und dies bezieht sich mit der Entwicklung der „Weiblichen Sonderanthropologie“ auch, allerdings leicht verspätet, auf den Prozess der Zeugung.27 In dem Maße, wie nachr [<< 102] evolutionär oder im deutschsprachigen eher biedermeierlich Generativität bzw. später Reproduktivität zunehmend dem ‚Weib‘ und dem Raum des Privaten zugeschrieben wurde,28 schwand das Interesse an der Suche männlicher Anteile an der Zeugung.29
Während in der Antike Spermien und Eizellen nicht bekannt waren, wurde auch nach der Entdeckung der Beteiligung von Gameten beider Geschlechter unter dem Mikroskop bis über die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts die Idee des ‚Samens‘ als Energie- und Bewegungsträgers aufrechterhalten, indem der männliche Beitrag nicht als materiell gesehen wurde. Dieser Haltung nach, die heute als epigenetisch bezeichnet wird, betrachtete die Naturforschung seit Aristoteles und bis zu den Arbeiten des Physiologen William Harvey im 17. Jahrhundert den Embryo als in einer graduellen Entwicklung aus unorganisierter Materie aus dem Blut im Uterus oder durch eine Vermengung der Samenflüssigkeit beider entstanden 30 und durch Gott in allen Lebewesen in der Anlage erzeugt.31 Harvey schließlich vertrat eine ganz unzeitgemäße epigenetische These der Befruchtung durch eine (damals noch rein hypothetische) Samenzelle. Eine solche heterosexuelle Befruchtung wurde im 18. und 19. Jahrhundert eher zur Ausnahme: Entdeckungen der Naturforscher Japetus Steenstrup, Richard Owen, Theodor von Siebold und Wilhelm Hofmeister zeigten in der Tier- und Pflanzenwelt eine ungeahnte Vielfalt: Generationswechsel von sexueller und asexueller Fortpflanzung, Parthenogenese (s. w. u.) und Hermaphroditismus wurden zu anerkannten Reproduktionsmodi,32 bis hin dazu, dass für Darwin sexuelle Fortpflanzung in keiner Spezies relevant schien.33
Weiterhin hielt sich auch nach Oskar Hertwigs Entdeckung von 1876, dass das Spermium im Befruchtungsprozess in die Eizelle gelangt, ein Nachhall galenscher Säftetheorie in den nun durch die Physiologie geprägten Theorien bis in die 1870er-Jahre, in der Annahme,34 für die Zeugung sei die Auflösung eines oder mehrerer Spermien [<< 102] in der Eizelle essentiell.35 In diesem Kontext verbreitete sich um die 1850er-Jahre die Vorstellung, der gezeugte Nachwuchs stelle den berechenbaren 36 materiellen Überschuss dar, der im Laufe des Lebens mit der Nahrungsaufnahme angesammelt würde. So finden sich in den Texten zur Fortpflanzung zwischen 1850 und 1880 etwa bei dem physiologisch ausgebildeten Zoologen Rudolf Leuckart wie auch bei Charles Darwin 37 vielfältige und metaphernreiche Bezüge zur Ökonomie wie die Begriffe Einnahmen, Ausgaben, Konsumption und Kapital. Diese Bezüge hingen offenbar von der physiologischen Theorie der Flüssigkeiten ab, denn sie wurden mit dem Übergang zu einer späteren morphologischen bzw. mechanischen Theorie der Weitergabe materieller Einheiten obsolet.38 Leuckart vertrat dabei die im Rahmen der Epigenese plausible und zeitgemäße Theorie,39 die Geschlechtsentwicklung geschehe graduell entsprechend äußerer Bedingungen. Die zwei Geschlechter seien lediglich ein Ausdruck der Entwicklung gemäß den Gesetzen der Arbeitsteilung.40
Mit zunehmender Hinwendung zur mechanistischen Theorie wurde dieses physiologische Konzept herausgefordert durch die bereits genannte und schon im 17. Jahrhundert manifest werdende Idee, die Entwicklung des Embryos von der Zeugung ab stelle eine Entfaltung bereits zuvor angelegter Strukturen dar, die durch einen mechanischen Impuls ‚in Gang gesetzt‘ würde. Dieser Theorie folgte auch die Annahme, notwendigerweise müsse diese Anlage entweder in der nun mit dem Mikroskop beobachteten weiblichen Eizelle oder im männlichen Samen zu finden sein. Hier nun entfaltet sich neben den weiterhin existierenden Epigenesistheorien der Streit zwischen Ovisten und Animaculisten, je nachdem, ob man die vollständigen (also auch geschlechtlichen) Anlagen des Menschen im weiblichen oder männlichen Samen sah.41 [<< 103]