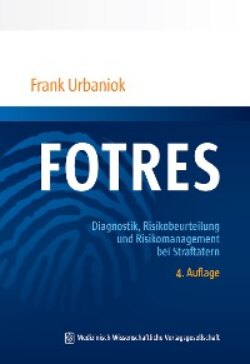Читать книгу Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter - Группа авторов - Страница 17
1.4.3 Bewertung der Entwicklungen im DSM-5 und ICD-11
ОглавлениеAus Sicht der Autoren dieses Beitrags ist die Weiterentwicklung des Begriffs der neuronalen Entwicklungsstörungen auf den Bereich von ADHS, Lernstörungen und motorischen Störungen sinnvoll und plausibel, nicht zuletzt deswegen, weil diese Störungen das Charakteristikum des frühen Beginns einer qualitativ auffälligen Entwicklung gemeinsam haben und es individuell zahlreiche Überlappungen und Grenzfälle gibt, die das Zusammenfassen dieser verschiedenen Störungen unter einer übergeordneten Kategorie nahelegen. Ferner ist zu begrüßen, dass auch Doppeldiagnosen von ASS und ADHS möglich geworden sind, da dies der klinischen Erfahrung entspricht und konsekutive Behandlungsversuche erleichtert. Auch die Vereinheitlichung der bislang kategorial gefassten autistischen Störungen zum dimensional gefassten Konzept eines „Autismus-Spektrums“ ist durchaus nachvollziehbar und sinnvoll, da aus klinischer Perspektive die bisherigen Subkategorien in der Tat absolut fließend ineinander übergehen, prognostisch weitgehend bedeutungslos sind und auch therapeutisch deutlich weniger Implikationen haben als z.B. – die intellektuelle Leistungsfähigkeit der Betroffenen (Cederlund et al. 2008; Howlin et al. 2004). Die von vielen Autoren für relevant erachtete Unterscheidung von (meist monogenetischen) sekundären Varianten von ASS, die z.B. im Rahmen von Syndromen wie dem fragilen-X-Syndrom auftreten können, von (wahrscheinlich komplex-polygenetisch vererbten) „primären“ ASS-Varianten (Aitken 2010; Tebartz van Elst et al. 2018, 2022) fand dagegen noch keinen Eingang in das DSM-5 und die ICD-11. Auch die in der Literatur verbreitete (dimensionale) Unterscheidung von niederfunktionalen (ohne differenzierte Sprache und mit beeinträchtigter Intelligenz) und hochfunktionalen Formen wurde nicht aufgegriffen. Allerdings kann mithilfe der neu eingeführten Einteilung des Schweregrads das Funktionsniveau im oben gemeinten Sinne bedingt abgebildet werden.
Vor allem dann, wenn die neue Kategorie der sozialen (pragmatischen) Kommunikationsstörung als Option zur Kodierung leichterer autistischer Varianten gedacht worden sein sollte, bleibt weitgehend unklar, warum gerade diese Spielart autistischer Auffälligkeiten aus dem „Spektrum“ als separate Kategorie ausgegliedert wurde (Baird u. Norbury 2016). Denn es gibt klinisch keine erkennbare Evidenz dafür, dass der Übergang von den schwereren, dann syndromalen ASS zur leichteren sozialen Kommunikationsstörung kategorial, also nicht-fließend sein sollte. Vielmehr zeigen auch die subsyndromalen, leichteren Varianten des Autismus klassische Symptome im Sinne des B-Kriteriums mit Rigidität, Bedürftigkeit nach erwartungsgemäßen Tagesabläufen, einer Empfindlichkeit gegenüber Reizüberflutung und typischen autistischen Stressreaktionsweisen, nur eben in weniger starker Ausprägung. Die psychosoziale Beeinträchtigung und sekundäre psychiatrische Symptome und Probleme haben auch dann oft in diesem Bereich ihre Wurzeln, wenn sie nicht ausgeprägt genug ist, um das B-Kriterium nach DSM-5 zu erfüllen. Somit ist es aus Sicht der Autoren wenig überzeugend, leichtere Varianten einer ASS unter Ausschluss der Symptome im Sinne des B-Kriteriums definieren zu wollen.
Unabhängig von diesen Überlegungen bleibt abschließend darauf hinzuweisen, dass momentan in Deutschland vor allem daran gearbeitet werden muss, dass gerade auch leichtere Varianten des Autismus überhaupt erkannt und in ihrer Bedeutung für sich daraus entwickelnde sekundäre psychiatrische Störungsbilder richtig eingeordnet werden (Tebartz van Elst et al. 2013; Riedel et al. 2015; Tebartz van Elst 2018, 2022). Denn dies ist Voraussetzung für ein adäquates, Akzeptanz-förderndes Krankheitsverständnis durch die Patienten und ihre Angehörigen und für eine angemessene Therapieplanung.
Aspies, Autisten, hochfunktionale Autisten, Menschen mit Autismus, Betroffene ...
Wie benennen wir, was wir meinen?
Noch vor wenigen Jahren war die Diagnose eines Autismus in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychotherapie eine ausgesprochene Seltenheit. Denn der Begriff war konzeptuell reserviert für sehr schwere Formen des frühkindlichen Autismus, bei dem Betroffene meist nicht über eine entwickelte Sprache verfügten. Durch die Entdeckung der Bedeutung des hochfunktionalen Autismus als Basisstörung für viele sekundäre psychische Erkrankungen (s. Sektion III) hat sich diese Situation grundlegend geändert. Die autistischen Eigenschaften werden als zeit- und situationsstabile Persönlichkeitseigenschaften an sich und in ihrer ursächlichen Bedeutung für daraus resultierende sekundäre Probleme und Symptome mehr und mehr erkannt. Dies führt aber auch dazu, dass immer häufiger Menschen autistische Eigenschaften an sich selbst erkennen, die zwar überzeugend vorhanden sind, aber deutlich weniger schwer ausgeprägt sind als etwa bei klassischen frühkindlich manifest werdenden Formen des Autismus. Wenn Betroffene zwar Eigenschaften aus allen Bereichen des Autismus im Sinne etwa der DSM-5 oder ICD-11 Definition aufweisen, aber ihr Leben erfolgreich leben, einen Beruf und Familie haben und in ihrer Lebensnische zufrieden sind, so kann eine Störungsdiagnose nicht gestellt werden, weil z.B. das D-Kriterium nach DSM-5 nicht erfüllt ist. Auch sollte nach Überzeugung der Autoren die Symptomatik in solchen Konstellationen eher als Eigenschaftscluster ganz im Sinne einer Persönlichkeitsstruktur mit Stärken und Schwächen aufgefasst werden (Tebartz van Elst 2018, 2022).
Die Frage, die sich für diese Konstellation auch für dieses Buch stellt, ist die, wie man das Gemeinte dann benennen sollte. Manche Betroffene nennen sich „Aspies“, andere nennen sich „Autisten“ oder „hochfunktionale Autisten“, weil sie sich nicht von den schwerer betroffenen Menschen abgrenzen wollen. Andere Formulierungen sind „Menschen mit Asperger-Syndrom“, „Asperger-Autisten“, „Betroffene“ oder „Menschen mit hochfunktionalem Autismus“. Wie oben im Text beschrieben, wird der Begriff „Asperger-Syndrom“ alltagssprachig in den Medien oft synonym für diese gemeinte Gruppe von Menschen verwendet, obwohl dies aus wissenschaftlicher Perspektive nicht ganz korrekt ist.
Für dieses Buch wurde überlegt, ob die Terminologie vereinheitlicht werden sollte, aber für jede Formulierung gab es ein Für und Wider und gänzlich unterschiedliche Sprachgefühle der unterschiedlichen Autoren.
Schließlich wurde vereinbart, die Terminologie in diesem Punkt offen zu lassen, was dazu führt, dass in den unterschiedlichen Buchbeiträgen alle der genannten Formulierungen für die gemeinte Gruppe – nämlich Menschen mit hochfunktionalem Autismus und einem variablen Grad an erfolgreicher psychosozialer Anpassung – teils sogar nebeneinander zur Anwendung kommen. Dies spiegelt in den Augen der Autoren die gelebte Sprachwirklichkeit am besten wider. Wichtig ist dabei, zu betonen, dass keine der gewählten Formulierungen in einem diskriminierenden, abwertenden oder einengend kategorialisierenden Sinne gemeint ist.